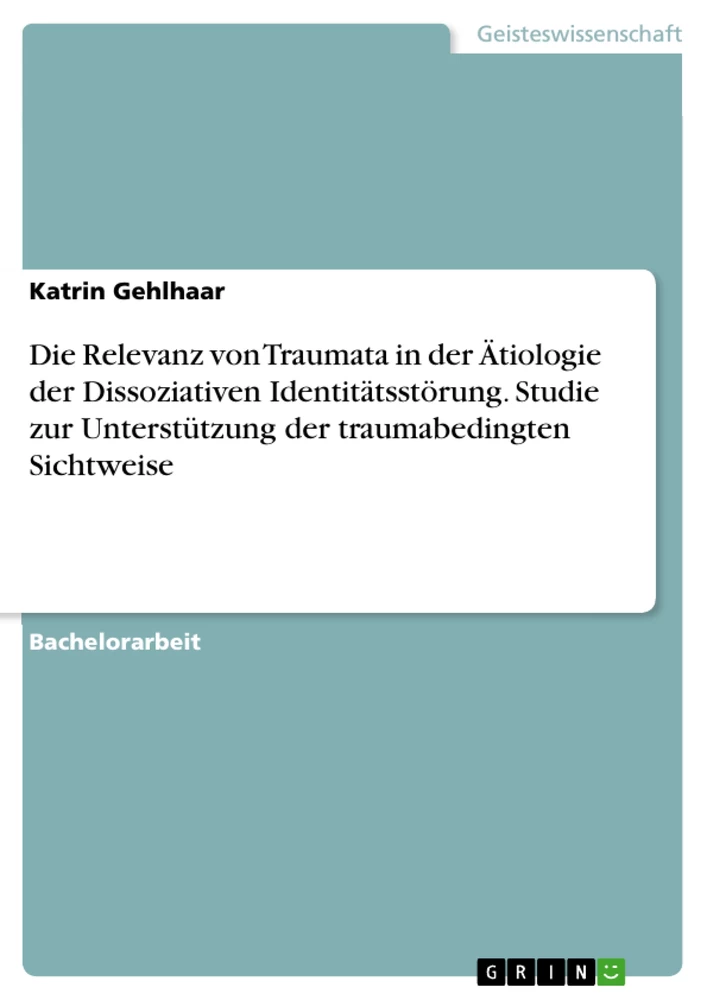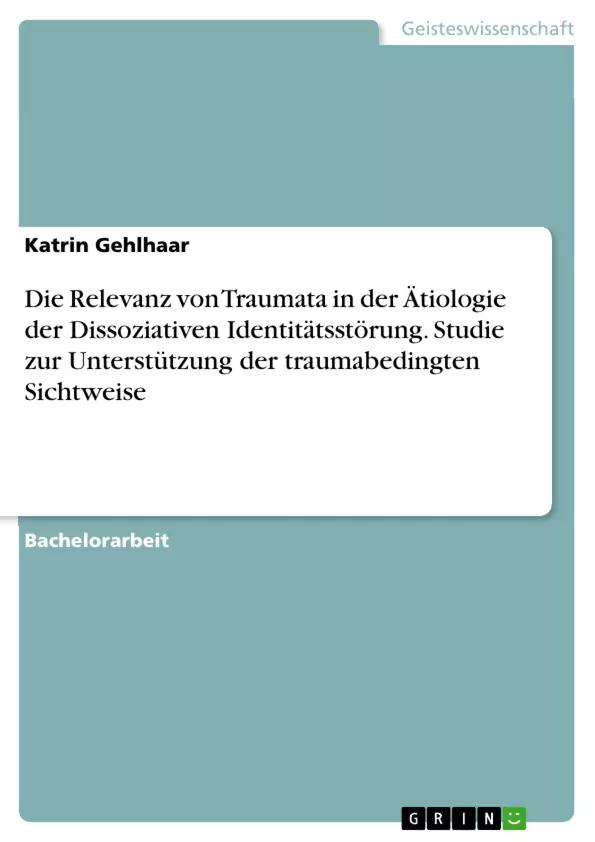Die Ursache der Dissoziativen Identitätsstörung (DIS) wird seit vielen Jahren kontrovers diskutiert. Während die Vertreter der soziokognitiven Sichtweise davon ausgehen, dass Faktoren wie Fantasie und Suggestion zu einer DIS führen, gehen die Vertreter der traumabedingten Sichtweise davon aus, dass schwerste Traumatisierungen zugrundeliegen. Die hier durchgeführte Studie soll diese traumabedingte Annahme weiter unterstützen.
In der Studie wurden 21 Patienten mit der Diagnose DIS und 20 Patienten mit der Diagnose Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ohne DIS anhand eines Fragebogen-Sets näher untersucht und miteinander verglichen.
100% der DIS-Patienten erfüllten die Kriterien einer Traumatisierung und zeigten sowohl eine stärkere Traumasymptomatik als auch signifikant stärkere allgemeine und somatoforme dissoziative Symptome als die PTBS Gruppe. 76.2% der hier untersuchten DIS-Patienten wurden neben anderen traumatischen Erlebnissen auch durch Folter traumatisiert. Zwischen der Schwere der Traumasymptomatik und der Ausprägung allgemeiner und somatoformer Dissoziation konnte ein hoher positiver Zusammenhang festgestellt werden.
Die Ergebnisse unterstützen die traumabedingte Sichtweise und zeigen, dass Traumatisierungen eine große Relevanz bei DIS Patienten haben. Es ist anzunehmen, dass die Entstehung der DIS eine Reaktion des Organismus auf Traumatisierung ist und die DIS auf demselben Grundmechanismus wie die PTBS beruht. Künftige Forschung sollte dies weiter bekräftigen. Außerdem sollte die DIS als schwere Traumafolgestörung deutlich mehr Beachtung in der Ausbildung von Therapeuten finden, sodass DIS Patienten besser adäquate Hilfe erhalten können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und theoretischer Hintergrund
- 1.1 Definition der Dissoziativen Identitätsstörung
- 1.2 Die soziokognitive Sichtweise
- 1.3 Die traumabedingte Sichtweise
- 1.3.1 Die Theorie der strukturellen Dissoziation
- 1.3.2 Befunde zur traumabedingten Sichtweise
- 1.4 Fragestellung und Hypothesen
- 2 Methoden
- 2.1 Versuchspersonen und Design
- 2.2 Messinstrument
- 2.3 Durchführung
- 2.4 Statistische Auswertung
- 3 Ergebnisse
- 3.1 Anteil der Traumatisierten unter den DIS Patienten
- 3.2 Ausprägung der traumaassoziierten Symptomatik
- 3.3 Ausprägung der allgemeinen und somatoformen Dissoziation
- 3.4 Korrelation der Schwere der Traumasymptomatik mit der Ausprägung der Dissoziation
- 3.5 Häufigkeit von Traumatisierung durch Folter
- 3.6 Sonstige Ergebnisse
- 4 Diskussion
- 4.1 Diskussion der Ergebnisse
- 4.2 Stärken und Limitationen der Studie
- 4.3 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die Relevanz von Traumata bei der Entstehung der Dissoziativen Identitätsstörung (DIS). Ziel ist es, die traumabedingte Sichtweise auf die Ätiologie der DIS zu unterstützen. Hierzu werden Ergebnisse einer empirischen Studie präsentiert und diskutiert.
- Die Definition und Abgrenzung der DIS gegenüber anderen dissoziativen Störungen.
- Vergleich der traumabedingten und soziokognitiven Erklärungsansätze der DIS.
- Analyse der Ergebnisse einer empirischen Studie zur Traumatisierung bei DIS-Patienten.
- Bewertung der Studienergebnisse im Hinblick auf die Unterstützung der traumabedingten Sichtweise.
- Diskussion methodischer Stärken und Limitationen der Studie.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung und theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel legt den Grundstein der Arbeit, indem es die Dissoziative Identitätsstörung (DIS) definiert und die bestehenden Erklärungsansätze – die soziokognitive und die traumabedingte Sichtweise – gegenüberstellt. Die traumabedingte Sichtweise, die von schweren Traumatisierungen als Ursache ausgeht, wird im Detail erläutert, inklusive der Theorie der strukturellen Dissoziation und relevanter Befunde. Das Kapitel mündet in die Formulierung der Forschungsfrage und der Hypothesen der empirischen Studie.
2 Methoden: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der durchgeführten Studie. Es werden die Stichprobenbeschreibung (Versuchspersonen und Studiendesign), das verwendete Messinstrument, die Durchführung der Studie und die statistischen Auswertungsmethoden erläutert. Es wird ein klares Bild der Vorgehensweise geliefert, um die Reproduzierbarkeit und die Validität der Ergebnisse zu gewährleisten.
3 Ergebnisse: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Studie präsentiert und detailliert beschrieben. Es werden Daten zum Anteil traumatisierter DIS-Patienten, zur Ausprägung traumaassoziierter und dissoziativer Symptome, sowie zur Korrelation zwischen Traumaintensität und Dissoziationsgrad vorgestellt. Die Ergebnisse zum Anteil der Traumatisierung durch Folter werden ebenfalls berichtet und eingeordnet. Die Ergebnisse werden klar und prägnant dargestellt, um ein umfassendes Verständnis zu ermöglichen.
4 Diskussion: Das Kapitel diskutiert die Ergebnisse der Studie im Kontext des Forschungsstandes und bewertet deren Bedeutung für die Unterstützung der traumabedingten Sichtweise auf die DIS. Es werden zudem die Stärken und Limitationen der Studie kritisch reflektiert, um die Aussagekraft der Ergebnisse einzuschätzen. Schließlich werden Ausblicke auf zukünftige Forschungsfragen und klinische Implikationen formuliert.
Schlüsselwörter
Dissoziative Identitätsstörung (DIS), Trauma, Traumatisierung, Soziokognitive Sichtweise, Traumabedingte Sichtweise, Strukturelle Dissoziation, Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Empirische Studie, Fragebogen, Korrelation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Dissoziative Identitätsstörung und Trauma
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Traumata und der Entstehung der Dissoziativen Identitätsstörung (DIS). Sie konzentriert sich auf die traumabedingte Sichtweise der DIS-Ätiologie und präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Studie zur Überprüfung dieser Hypothese.
Welche Theorien werden in der Arbeit verglichen?
Die Arbeit vergleicht die soziokognitive und die traumabedingte Sichtweise auf die Entstehung der DIS. Die traumabedingte Sichtweise, mit ihrer Betonung schwerer Traumatisierungen als Ursache, wird im Detail erläutert, inklusive der Theorie der strukturellen Dissoziation.
Welche Methoden wurden in der empirischen Studie angewendet?
Die Studie beschreibt detailliert die Methodik, inklusive Stichprobenbeschreibung (Versuchspersonen und Studiendesign), verwendetes Messinstrument, Studiendurchführung und statistische Auswertungsmethoden. Der Fokus liegt auf der Reproduzierbarkeit und Validität der Ergebnisse.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Arbeit präsentiert Ergebnisse zum Anteil traumatisierter DIS-Patienten, zur Ausprägung traumaassoziierter und dissoziativer Symptome und zur Korrelation zwischen Traumaintensität und Dissoziationsgrad. Auch Ergebnisse zur Traumatisierung durch Folter werden berichtet und eingeordnet.
Wie werden die Ergebnisse diskutiert?
Die Diskussion der Ergebnisse bewertet deren Bedeutung für die Unterstützung der traumabedingten Sichtweise. Methodische Stärken und Limitationen der Studie werden kritisch reflektiert, um die Aussagekraft der Ergebnisse einzuschätzen. Ausblicke auf zukünftige Forschungsfragen und klinische Implikationen werden formuliert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Dissoziative Identitätsstörung (DIS), Trauma, Traumatisierung, Soziokognitive Sichtweise, Traumabedingte Sichtweise, Strukturelle Dissoziation, Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Empirische Studie, Fragebogen, Korrelation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung und theoretischer Hintergrund (Definition der DIS, Vergleich der Erklärungsansätze, Forschungsfrage und Hypothesen); Methoden (Stichprobenbeschreibung, Messinstrument, Durchführung, statistische Auswertung); Ergebnisse (präsentiert die empirischen Befunde); und Diskussion (bewertet die Ergebnisse, reflektiert methodische Aspekte und gibt Ausblicke).
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt, insbesondere für Personen, die sich mit der Dissoziativen Identitätsstörung, Traumaforschung und klinischer Psychologie beschäftigen.
Wo finde ich den detaillierten Inhaltsverzeichnis?
Der detaillierte Inhaltsverzeichnis ist im ersten Abschnitt der Bachelorarbeit aufgeführt und beinhaltet alle Unterpunkte der einzelnen Kapitel.
- Quote paper
- Katrin Gehlhaar (Author), 2014, Die Relevanz von Traumata in der Ätiologie der Dissoziativen Identitätsstörung. Studie zur Unterstützung der traumabedingten Sichtweise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/419789