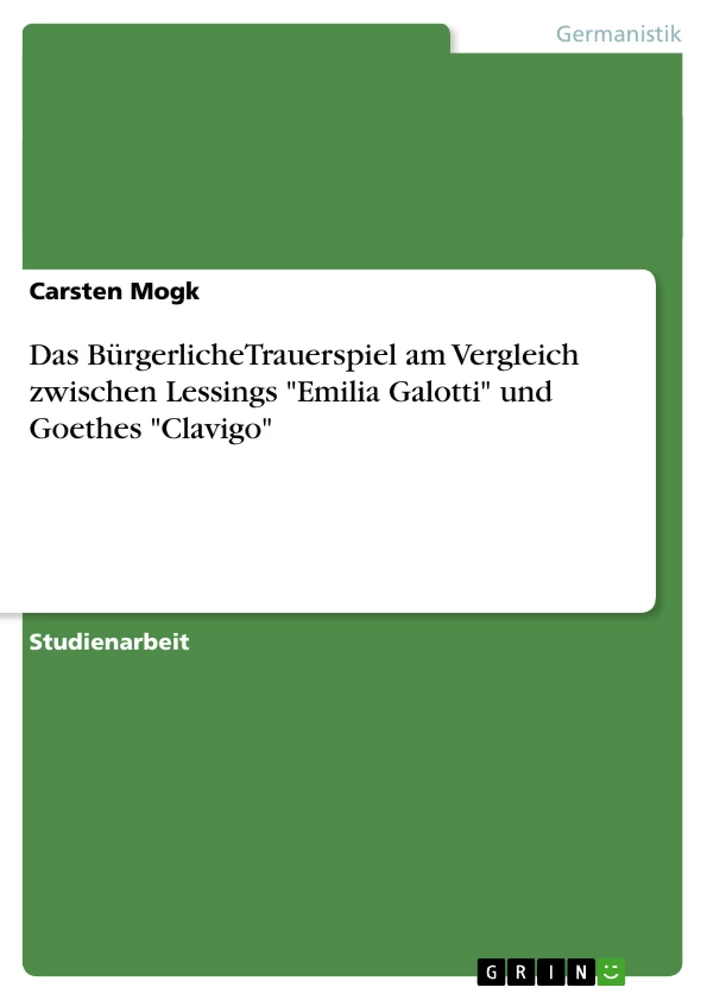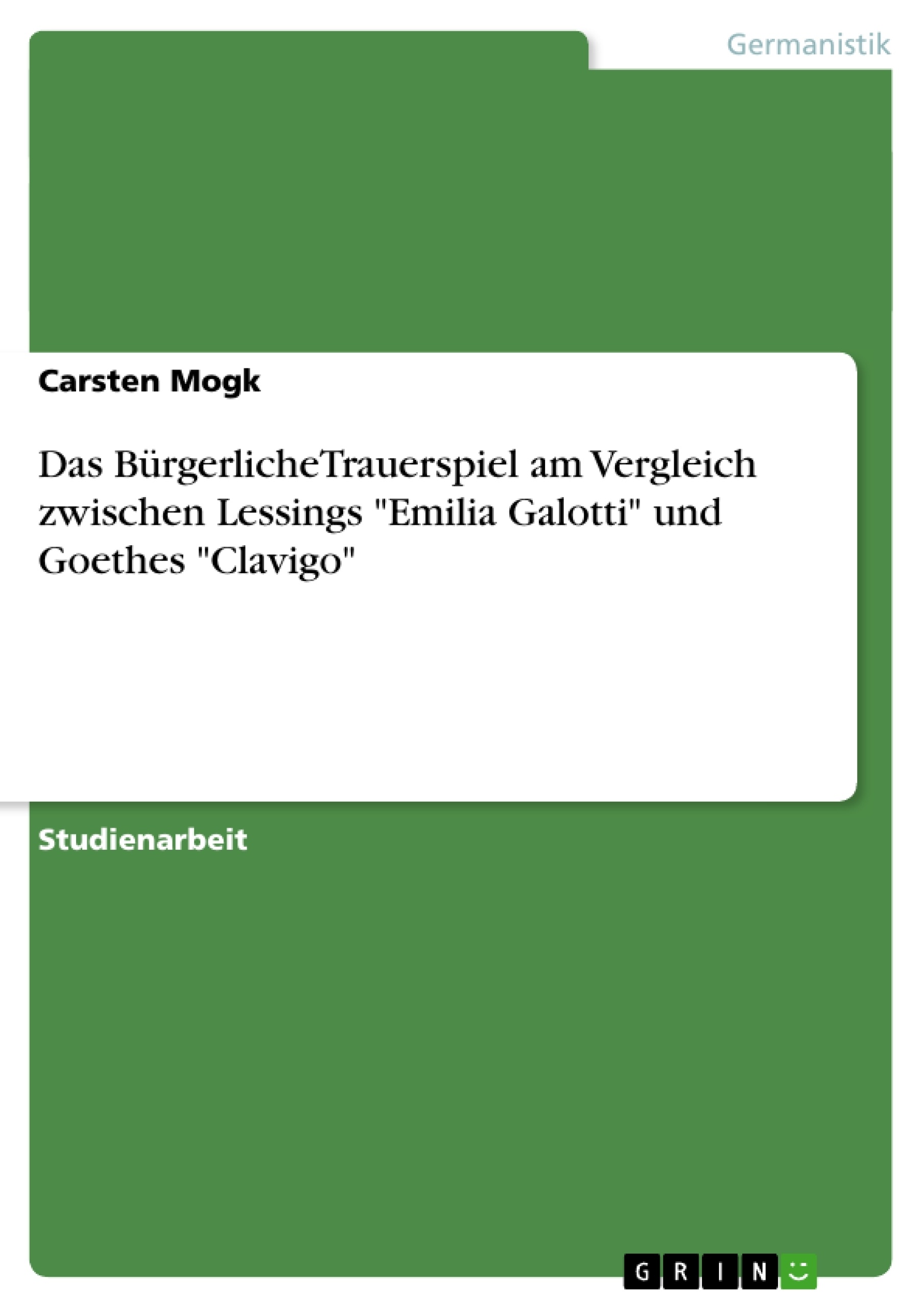Einleitung
Als ab der Mitte des 18. Jahrhunderts das bürgerliche Trauerspiel als neue dramaturgische Gattung die Bühnen Europas eroberte; war dies mit heftigen Diskussionen verbunden, da diese neue Dramenart einen Bruch mit den bis dahin bestehenden Gesetzen und Theorien der Dramaturgie bedeutete. Auch heute wird das bürgerliche Trauerspiel und seine Existenzberechtigung als vollwertige literarische Gattung kontrovers diskutiert.
In der vorliegenden Arbeit soll das Wesen und die theoretische Konzeption des bürgerlichen Trauerspiels erläutert werden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse möchte ich auf zwei Meilensteine der Gattungsgeschichte des bürgerlichen Trauerspiels, zum einen Lessings „Emilia Galotti“ und zum anderen Goethes „Clavigo“, anwenden und diese auf ihre Gattungsspezifik analysieren. Dabei soll vor allem der Bürgerlichkeitsbegriff im Vordergrund stehen. Ich habe mich für diese beiden Werke entschieden, da sie innerhalb ihrer Rezeptionsgeschichte unterschiedlicher kaum sein könnten. Auf der Einen Seite „Emilia Galotti“, das „klassische“ (wie klassisch es tatsächlich ist, wird noch zu zeigen sein) bürgerliche Trauerspiel. Auf der anderen Seite Goethes „Clavigo“, welches zunächst wenig Beachtung fand und innerhalb der Gattung oft an den Rand gedrängt zu sein scheint, dessen Gattungszugehörigkeit bisweilen sogar bestritten wird. Der Vergleich beider Werke soll zudem den Einblick in die Vielseitigkeit der Gattung des bürgerlichen Trauerspiels vertiefen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Theorie des bürgerlichen Trauerspiels
- 2.1. Begriffserläuterung
- 2.2. Entstehung und Verbreitung
- 3. Lessings „Emilia Galotti“
- 3.1. Die Handlungsorte als ständische Machtbereiche
- 3.2. Ständedifferenzierung innerhalb der Hauptpersonen
- 4. Der innere Standeskonflikt am Beispiel von Goethes „Clavigo“
- 4.1. Die Figur des Clavigo
- 4.2. Die Carlos-Figur
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Wesen und der theoretischen Konzeption des bürgerlichen Trauerspiels und analysiert zwei wichtige Werke der Gattungsgeschichte, Lessings „Emilia Galotti“ und Goethes „Clavigo“, anhand ihrer Gattungsspezifik. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Bürgerlichkeitsbegriff und dem Vergleich der beiden Werke, um die Vielseitigkeit der Gattung aufzuzeigen.
- Begriffserklärung und Entwicklung des bürgerlichen Trauerspiels
- Analyse der ständischen Unterschiede und Machtbereiche in „Emilia Galotti“
- Untersuchung des inneren Standeskonflikts in „Clavigo“
- Vergleich der beiden Werke hinsichtlich ihrer Gattungsspezifik und der Darstellung des Bürgertums
- Einblick in die Vielseitigkeit des bürgerlichen Trauerspiels
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema des bürgerlichen Trauerspiels ein, das als neue dramaturgische Gattung im 18. Jahrhundert auftrat und mit kontroversen Diskussionen verbunden war. Die Arbeit erläutert die theoretische Konzeption der Gattung und setzt diese in Bezug zu den Werken „Emilia Galotti“ und „Clavigo“, um deren Gattungsspezifik zu analysieren.
2. Die Theorie des bürgerlichen Trauerspiels
2.1. Begriffserläuterung
Dieser Abschnitt definiert den Begriff „bürgerliches Trauerspiel“ und beleuchtet die Besonderheiten, die diese Gattung von der klassischen Tragödie abgrenzen. Insbesondere wird auf die neuen Aspekte der „Bürgerlichkeit“ fokussiert, die sich in den Handlungsträgern, Handlungsmotiven und den Moralvorstellungen der bürgerlichen Gesellschaft widerspiegeln. Die Abgrenzung zwischen Privatheit und Öffentlichkeit wird ebenfalls thematisiert.
2.2. Entstehung und Verbreitung
Dieser Abschnitt beleuchtet die Entstehungszeit und die Verbreitung des bürgerlichen Trauerspiels im 18. Jahrhundert, die eng mit der gesellschaftlichen Entwicklung des Bürgertums verbunden ist. Der Abschnitt beleuchtet den Einfluss englischer und französischer Dramatiker auf die Entstehung dieser Gattung in Deutschland.
3. Lessings „Emilia Galotti“
3.1. Die Handlungsorte als ständische Machtbereiche
Dieser Abschnitt analysiert die Handlungsorte in „Emilia Galotti“ und zeigt, wie sie als ständische Machtbereiche fungieren und die sozialen Konflikte im Stück widerspiegeln.
3.2. Ständedifferenzierung innerhalb der Hauptpersonen
Dieser Abschnitt untersucht die Hauptpersonen in „Emilia Galotti“ und analysiert, wie die ständische Differenzierung ihre Handlungen und Entscheidungen prägt.
4. Der innere Standeskonflikt am Beispiel von Goethes „Clavigo“
4.1. Die Figur des Clavigo
Dieser Abschnitt analysiert die Figur des Clavigo in „Clavigo“ und untersucht, wie der innere Standeskonflikt seine Entscheidungen und Handlungen beeinflusst.
4.2. Die Carlos-Figur
Dieser Abschnitt untersucht die Figur des Carlos in „Clavigo“ und beleuchtet den Einfluss des inneren Standeskonflikts auf seine Beziehung zu Clavigo.
Schlüsselwörter
Bürgerliches Trauerspiel, Ständeklausel, Bürgerlichkeit, Moralvorstellungen, Privatheit, Öffentlichkeit, „Emilia Galotti“, „Clavigo“, Lessings, Goethes, Handlungsträger, Handlungsmotive, Gattungsgeschichte, Vergleich, Dramaturgie.
Häufig gestellte Fragen
Was kennzeichnet die Gattung des bürgerlichen Trauerspiels?
Es bricht mit der Ständeklausel der klassischen Tragödie, indem es bürgerliche Protagonisten und deren moralische Konflikte in den Mittelpunkt stellt.
Wie wird der Standeskonflikt in Lessings "Emilia Galotti" dargestellt?
Der Konflikt manifestiert sich durch die Macht des Adels (der Prinz) über die bürgerliche Tugend (Emilia und Odoardo) in verschiedenen ständischen Machtbereichen.
Warum gilt Goethes "Clavigo" oft als Grenzfall der Gattung?
"Clavigo" thematisiert eher einen inneren Standeskonflikt und individuellen Ehrgeiz als den klassischen äußeren Konflikt zwischen Bürgertum und Adel.
Welche Rolle spielen Moralvorstellungen in diesen Dramen?
Bürgerliche Werte wie Keuschheit, Familienehre und Tugend stehen im direkten Widerspruch zur Willkür und Amoralität der höfischen Welt.
Wie unterscheiden sich Privatheit und Öffentlichkeit in der Theorie?
Das bürgerliche Trauerspiel verlagert das Geschehen oft in den privaten, familiären Raum, während die klassische Tragödie staatspolitische, öffentliche Belange behandelt.
- Quote paper
- Carsten Mogk (Author), 2004, Das BürgerlicheTrauerspiel am Vergleich zwischen Lessings "Emilia Galotti" und Goethes "Clavigo", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42009