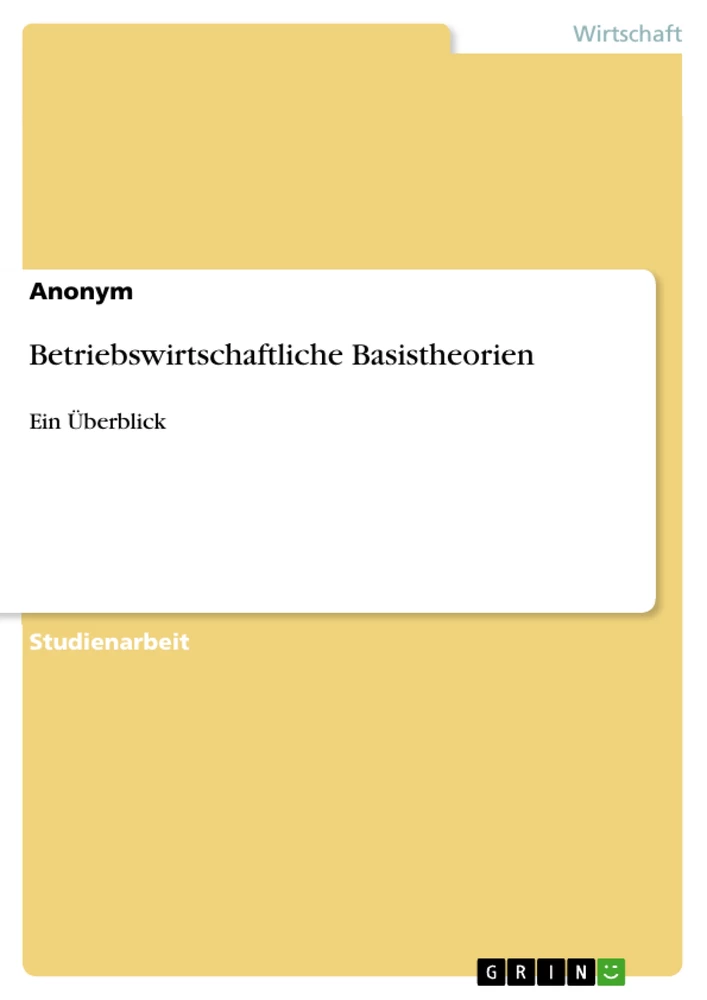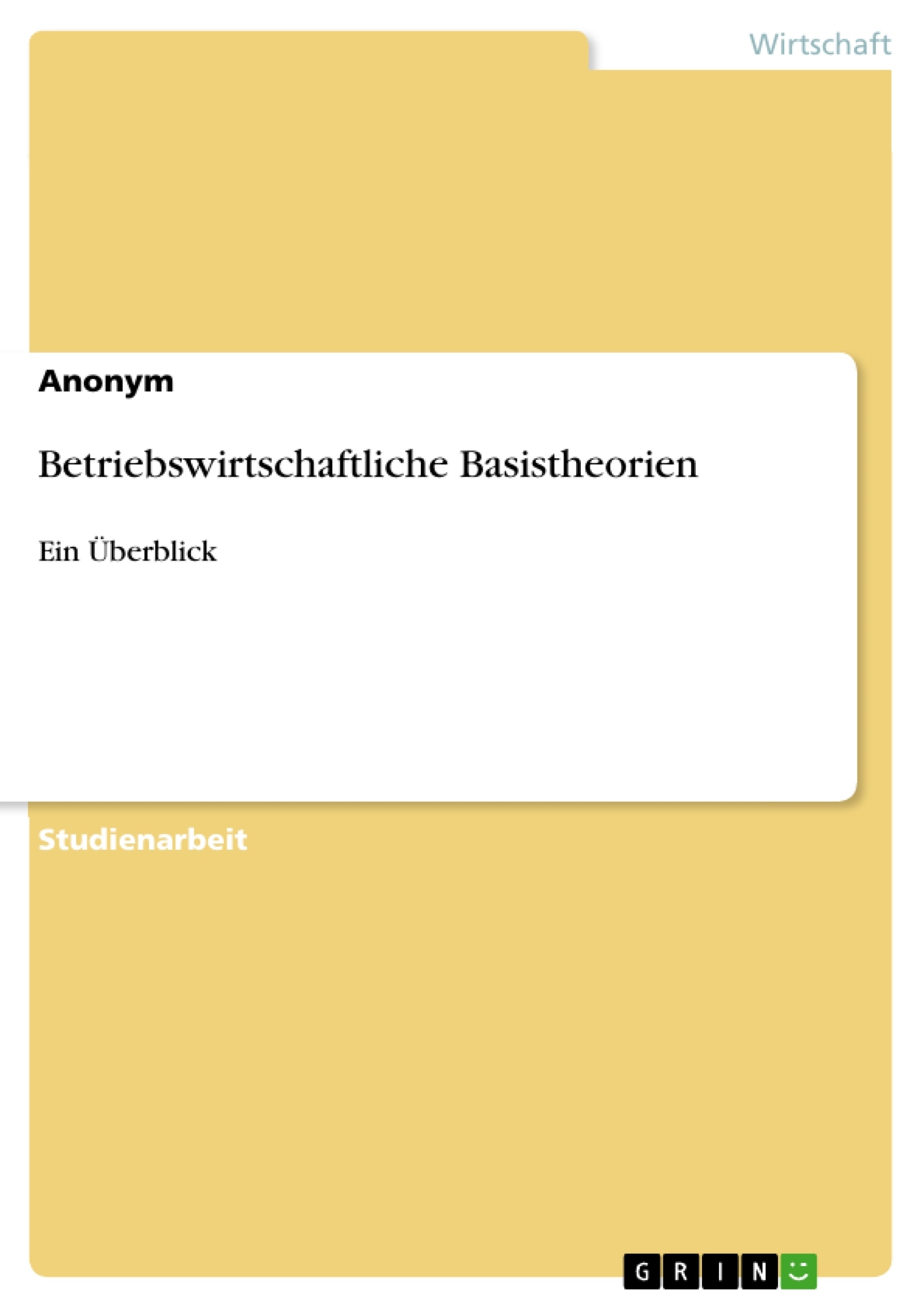Die Welt und das wirtschaftliche Leben wird immer umfangreicher und viele Menschen in der Wirtschaft wünschen sich mehr Transparenz und Orientierung. Diese könnte man evtl. dadurch gewinnen, in dem man sich die Wursteln und Kernprinzipien vergegenwärtigt, welche ein hilfreicher Baustein sein kann, um die Wirtschaft zu begreifen und daraus erfolgreiches Handeln abzuleiten.
Betriebswirtschaftliche Basistheorien sind Methoden und Perspektiven von Wissenschaftlern, wie man betriebswirtschaftliche Probleme behandelt und sollen Forschungsprozessen eine Richtung geben. Die wirtschaftlichen Aspekte stehen hierbei im
Vordergrund.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG:
- 1.1 EBENE 1 - SOZIAL WISSENSCHAFTLICHES BASISKONZEPT & ÖKONOMISCHES BASISKONZEPT
- 1.2 EBENE 2 - SPEZIFISCHE WISSENSCHAFTSPROGRAMME
- 1.3 VERLAUF DER ARBEIT
- 2. GESCHICHTE ÖP & SP:
- 3. GRUNDKONZEPTE DES SOZIALWISSENSCHAFTLICHES BASISKONZEPT & ÖKONOMISCHES BASISKONZEPT
- 3.1 MAXIMAL UND MINIMUM PRINZIP
- 3.2 HOMO OECONOMIUS
- 3.2.1 HOMO OECONOMIUS BEZOGEN AUF MENSCHEN
- 3.2.2. HOMO OECONOMIUS BEZOGEN AUF FIRMEN
- 3.3 BEDÜRFNISPYRAMIDE NACH MASLOW
- 3.3.1 BEDÜRFNISPYRAMIDE MENSCH:
- 3.3.2 BEDÜRFNISPYRAMIDE MENSCH ALS MITARBEITER:
- 3.3.3 UNTERNEHMENSSTRATEGIE
- 4. KRITIK & FAZIT:
- 5. QUELLENANGABE:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit zielt darauf ab, Betriebswirtschaftliche Basistheorien, insbesondere das ökonomische und sozialwissenschaftliche Basiskonzept, zu erläutern. Sie befasst sich mit den zugrundeliegenden Prinzipien und Konzepten dieser Theorien, um ein grundlegendes Verständnis für betriebswirtschaftliche Problemstellungen zu schaffen.
- Das ökonomische Basiskonzept und das sozialwissenschaftliche Basiskonzept
- Das Maximal- und Minimalprinzip
- Der Homo Oeconomicus
- Die Bedürfnispyramide nach Maslow
- Die Entwicklung und Relevanz dieser Theorien in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Welt der Betriebswirtschaftlichen Basistheorien ein und stellt die beiden grundlegenden Konzepte - das ökonomische und sozialwissenschaftliche Basiskonzept - vor. Sie erklärt, wie diese Konzepte in der Praxis Anwendung finden und welche Bedeutung sie für das Verständnis betriebswirtschaftlicher Prozesse haben.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Geschichte der beiden Basistheorien, insbesondere die Entwicklung des entscheidungsorientierten Ansatzes und die Rolle von Hans Raffe und Edmund Heinen. Es wird dargestellt, wie die Betriebswirtschaftslehre durch zeitgenössische Probleme und Impulse geprägt wurde.
Kapitel 3 befasst sich mit den Grundkonzepten der beiden Basistheorien. Es erklärt das Maximal- und Minimalprinzip, welches den ökonomischen Ansatz in der Praxis widerspiegelt, und den Homo Oeconomicus, einen wichtigen Bestandteil des ökonomischen Basiskonzepts. Weiterhin wird die Bedürfnispyramide nach Maslow behandelt, die einen zentralen Bestandteil des sozialwissenschaftlichen Basiskonzepts bildet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Betriebswirtschaftslehre, darunter die ökonomische Basistheorie, das sozialwissenschaftliche Basiskonzept, das Maximal- und Minimalprinzip, der Homo Oeconomicus, die Bedürfnispyramide nach Maslow, der entscheidungsorientierte Ansatz und die Geschichte der Betriebswirtschaftslehre.
Häufig gestellte Fragen
Was sind betriebswirtschaftliche Basistheorien?
Es handelt sich um Methoden und Perspektiven von Wissenschaftlern, die Forschungsprozessen eine Richtung geben und helfen, wirtschaftliche Probleme systematisch zu behandeln.
Was ist der Unterschied zwischen Maximal- und Minimalprinzip?
Beim Maximalprinzip soll mit gegebenem Einsatz der größtmögliche Erfolg erzielt werden; beim Minimalprinzip soll ein festgesetztes Ziel mit geringstmöglichem Einsatz erreicht werden.
Wer oder was ist der „Homo Oeconomicus“?
Der Homo Oeconomicus ist ein theoretisches Modell eines rational handelnden Menschen, der seinen eigenen Nutzen bzw. Gewinn maximiert.
Wie wird die Maslowsche Bedürfnispyramide in der BWL genutzt?
Sie dient als sozialwissenschaftliches Basiskonzept, um die Motivation von Menschen als Mitarbeiter und Kunden sowie darauf basierende Unternehmensstrategien zu verstehen.
Welche Bedeutung hat der entscheidungsorientierte Ansatz?
Dieser Ansatz, geprägt durch Forscher wie Edmund Heinen, fokussiert auf die Vorbereitung und Durchführung rationaler Entscheidungen in Unternehmen.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2017, Betriebswirtschaftliche Basistheorien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/424265