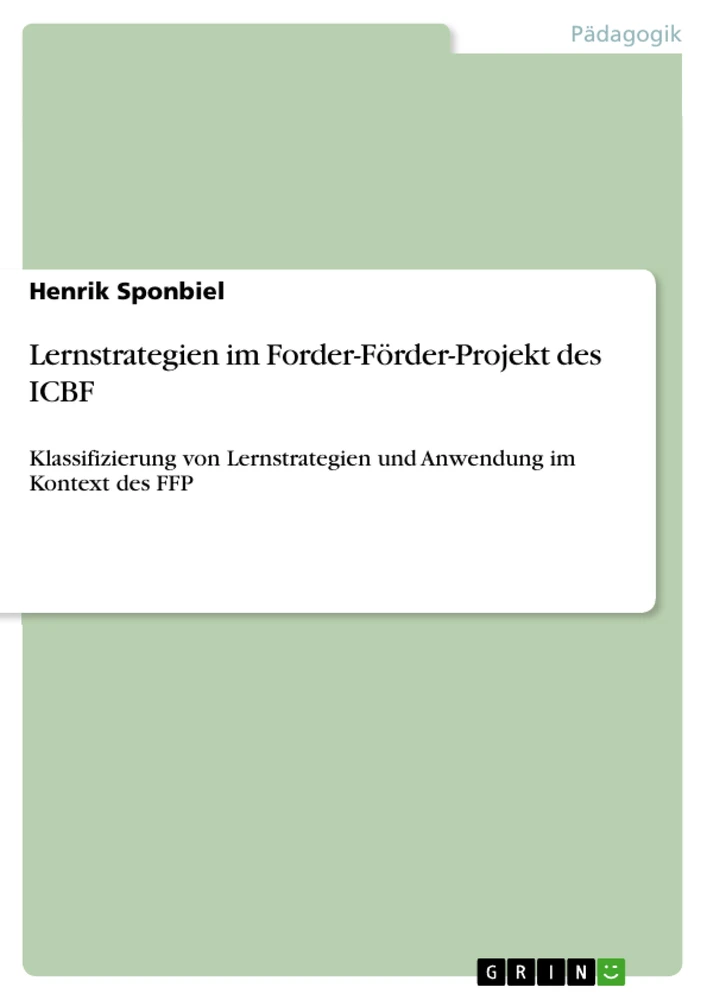Nach Gruehn entspricht Lernen der „überdauernde[n] Veränderung im Wissen, in den Fähigkeiten und Haltungen auf der Basis von (neuen) Erfahrungen- ohne oder mit Anleitung (Lehre) durch andere“. Doch wie gelangt man an eine überdauernde Veränderung im Wissen, in den Fähigkeiten und Haltungen? Ist das Individuum befähigt, sich spontan und ungerichtet Wissen anzueignen? Oder muss der Mensch erst lernen zu lernen?
Im Folgenden wird sich mit der Thematik der Lernstrategien auseinandergesetzt. Hierfür findet eine Auseinandersetzung mit den Strategien des selbstregulierenden Lernens in der schulischen Begabtenförderung nach Fischer und Fischer-Ontrup sowie mit Thesen zum erfolgreichen Lernen von Hasselhorn und Gold statt. Dabei werden zunächst die Merkmale der Lernstrategien nach Hasselhorn dargestellt sowie die Nutzungseffizienz dieser nach Miller und Seier näher beleuchtet. In einem zweiten Teil werden Möglichkeiten der Klassifizierung der Lernstrategien betrachtet und auf mögliche Taxonomien eingegangen. Inwiefern die dargestellten Lernstrategien eine Anwendung in der Praxis finden, wird in einem abschließenden Teil diskutiert. Das Forder-Förder-Projekt des ICBF wird dafür herangezogen und die Anwendungen der Lernstrategien in Bezug auf das freie Arbeiten der Schüler untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Was sind Lernstrategien?
- 2.1 Merkmale nach Hasselhorn
- 3 Möglichkeiten der Klassifizierung von Lernstrategien
- 3.1 Kognitive Strategien
- 3.2 Metakognitive Strategien
- 3.3 Ressourcenmanagement
- 4 Bezug zum Forder-Förder-Projekt
- 4.1 Kognitive Lernstrategien
- 4.2 Metakognitive Lernstrategien
- 4.3 Ressourcenmanagement
- 5 Fazit und Reflexion
- 6 Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht Lernstrategien im Kontext des Forder-Förder-Projekts. Ziel ist es, die Merkmale von Lernstrategien nach Hasselhorn zu erläutern, verschiedene Klassifizierungsmöglichkeiten zu beleuchten und deren Anwendung im schulischen Kontext, insbesondere im FFP, zu diskutieren. Dabei wird der Fokus auf die Effizienz des Strategieeinsatzes gelegt.
- Merkmale von Lernstrategien nach Hasselhorn
- Klassifizierung von Lernstrategien (kognitiv, metakognitiv, Ressourcenmanagement)
- Nutzungseffizienz von Lernstrategien
- Anwendung von Lernstrategien im Forder-Förder-Projekt
- Selbstreguliertes Lernen in der Begabtenförderung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem Zitat von Konfuzius über das Lernen durch Tun und führt in die Thematik der Lernstrategien ein. Sie beschreibt Lernen als einen Prozess der überdauernden Veränderung und stellt die zentrale Frage nach der Bedeutung von Lernstrategien für erfolgreiches Lernen. Der Text kündigt die Auseinandersetzung mit Lernstrategien nach Hasselhorn und Gold an und die Betrachtung ihrer Anwendung im Forder-Förder-Projekt (FFP).
2 Was sind Lernstrategien?: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Lernstrategie" und unterscheidet ihn von Lerntechniken. Es wird der Begriff "Strategie" aus dem Duden zitiert, um die Zielgerichtetheit und planerische Komponente von Strategien hervorzuheben. Der Unterschied zwischen Lernstrategien als übergeordneten Prozessen und Lerntechniken als deren Teilhandlungen wird deutlich gemacht. Das Kapitel legt den Grundstein für die spätere Diskussion der verschiedenen Strategietypen.
2.1 Merkmale nach Hasselhorn: Dieser Abschnitt beschreibt die Merkmale von Lernstrategien nach Hasselhorn. Lernstrategien werden als zielgerichtete, kognitive Operationen definiert, die bewusst und kontrolliert eingesetzt werden können. Allerdings werden auch die Aspekte des unbewussten und spontanen Einsatzes von Strategien angesprochen. Die Nutzungseffizienz wird anhand des Motivations-Tals nach Miller und Seier erläutert, welches die anfängliche Leistungseinbuße bei der Einführung neuer Strategien beschreibt, bevor eine Effizienzsteigerung eintritt.
3 Möglichkeiten der Klassifizierung von Lernstrategien: Kapitel 3 befasst sich mit verschiedenen Möglichkeiten, Lernstrategien zu klassifizieren. Es werden kognitive, metakognitive und Strategien des Ressourcenmanagements unterschieden, wobei auf die spezifischen Merkmale jeder Kategorie eingegangen wird. Dieses Kapitel liefert ein strukturiertes Verständnis der unterschiedlichen Arten von Lernstrategien und bildet die Grundlage für die spätere Analyse der Anwendung dieser Strategien im FFP.
4 Bezug zum Forder-Förder-Projekt: Kapitel 4 wendet die vorher diskutierten Lernstrategien auf das Forder-Förder-Projekt an. Es analysiert die Anwendung kognitiver, metakognitiver Strategien und des Ressourcenmanagements im Kontext des Projekts, untersucht das freie Arbeiten der Schüler und deren Strategienutzung. Dieser Abschnitt zeigt den praktischen Bezug der theoretischen Überlegungen zu Lernstrategien.
Schlüsselwörter
Lernstrategien, kognitive Strategien, metakognitive Strategien, Ressourcenmanagement, Hasselhorn, Forder-Förder-Projekt (FFP), selbstreguliertes Lernen, Begabtenförderung, Nutzungseffizienz, Motivationstal, Arbeitsgedächtnis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Lernstrategien im Forder-Förder-Projekt"
Was ist der Gegenstand dieser Ausarbeitung?
Diese Ausarbeitung untersucht Lernstrategien im Kontext eines Forder-Förder-Projekts (FFP). Sie erläutert die Merkmale von Lernstrategien nach Hasselhorn, beleuchtet verschiedene Klassifizierungsmöglichkeiten und diskutiert deren Anwendung im schulischen Kontext, insbesondere im FFP. Der Fokus liegt auf der Effizienz des Strategieeinsatzes.
Welche Lernstrategien werden behandelt?
Die Ausarbeitung behandelt kognitive, metakognitive Lernstrategien und Strategien des Ressourcenmanagements. Es wird detailliert auf die Merkmale jeder Kategorie eingegangen, inklusive der Definition nach Hasselhorn, die zielgerichtete, kognitive Operationen, bewusst und kontrolliert eingesetzt, beinhaltet. Allerdings werden auch unbewusste und spontane Aspekte angesprochen.
Wie werden Lernstrategien klassifiziert?
Lernstrategien werden in drei Hauptkategorien eingeteilt: kognitive Strategien (z.B. Wiederholungsstrategien), metakognitive Strategien (z.B. Planung, Überwachung des Lernprozesses) und Strategien des Ressourcenmanagements (z.B. Zeitmanagement, Organisation). Die Ausarbeitung beschreibt die spezifischen Merkmale jeder Kategorie.
Welche Rolle spielt das Motivations-Tal?
Das Motivations-Tal nach Miller und Seier beschreibt die anfängliche Leistungseinbuße bei der Einführung neuer Lernstrategien, bevor eine Effizienzsteigerung eintritt. Diese anfängliche Schwierigkeit wird in der Ausarbeitung im Zusammenhang mit der Nutzungseffizienz von Lernstrategien erläutert.
Wie werden Lernstrategien im Forder-Förder-Projekt angewendet?
Kapitel 4 analysiert die Anwendung kognitiver, metakognitiver Strategien und des Ressourcenmanagements im Kontext des FFP. Es untersucht das freie Arbeiten der Schüler und deren Strategienutzung, um den praktischen Bezug der theoretischen Überlegungen aufzuzeigen.
Was sind die Schlüsselbegriffe der Ausarbeitung?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Lernstrategien, kognitive Strategien, metakognitive Strategien, Ressourcenmanagement, Hasselhorn, Forder-Förder-Projekt (FFP), selbstreguliertes Lernen, Begabtenförderung, Nutzungseffizienz, Motivationstal und Arbeitsgedächtnis.
Wie ist die Ausarbeitung aufgebaut?
Die Ausarbeitung beinhaltet eine Einleitung, eine Definition von Lernstrategien (inkl. Merkmale nach Hasselhorn), eine Klassifizierung von Lernstrategien, die Anwendung im FFP, ein Fazit und eine Literaturliste. Jedes Kapitel wird in der Ausarbeitung zusammengefasst.
Was ist der Unterschied zwischen Lernstrategien und Lerntechniken?
Die Ausarbeitung unterscheidet zwischen Lernstrategien als übergeordneten Prozessen und Lerntechniken als deren Teilhandlungen. Lernstrategien sind zielgerichtet und planerisch, während Lerntechniken konkrete Vorgehensweisen darstellen.
Welche Bedeutung hat selbstreguliertes Lernen?
Selbstreguliertes Lernen spielt eine wichtige Rolle, insbesondere im Kontext der Begabtenförderung im FFP, da es die effiziente Anwendung von Lernstrategien fördert.
- Citar trabajo
- Henrik Sponbiel (Autor), 2017, Lernstrategien im Forder-Förder-Projekt des ICBF, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/424295