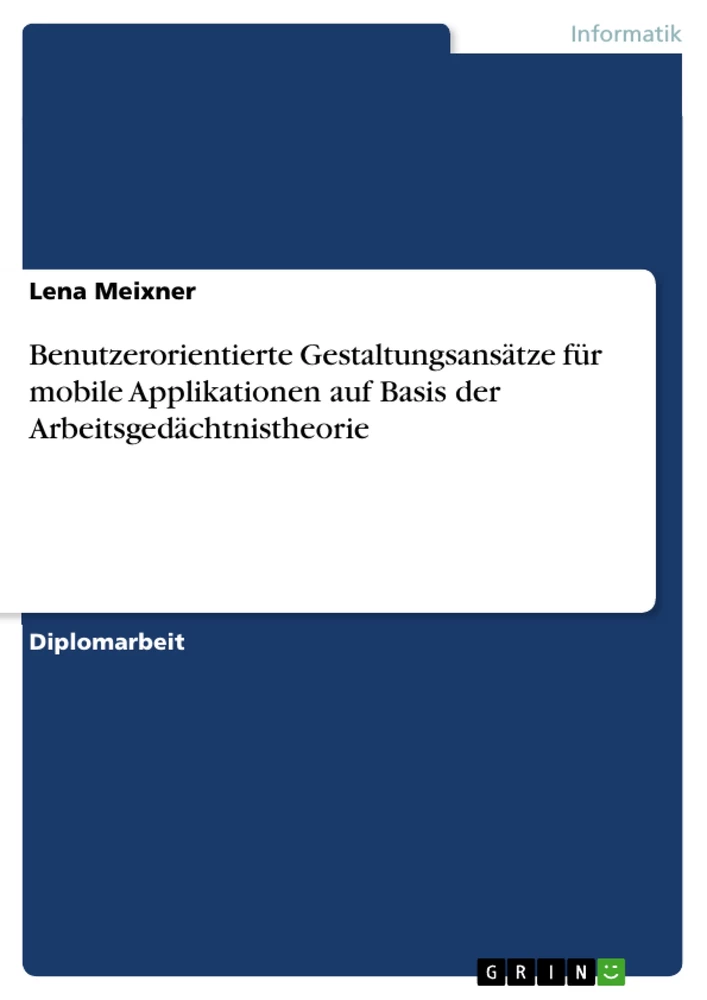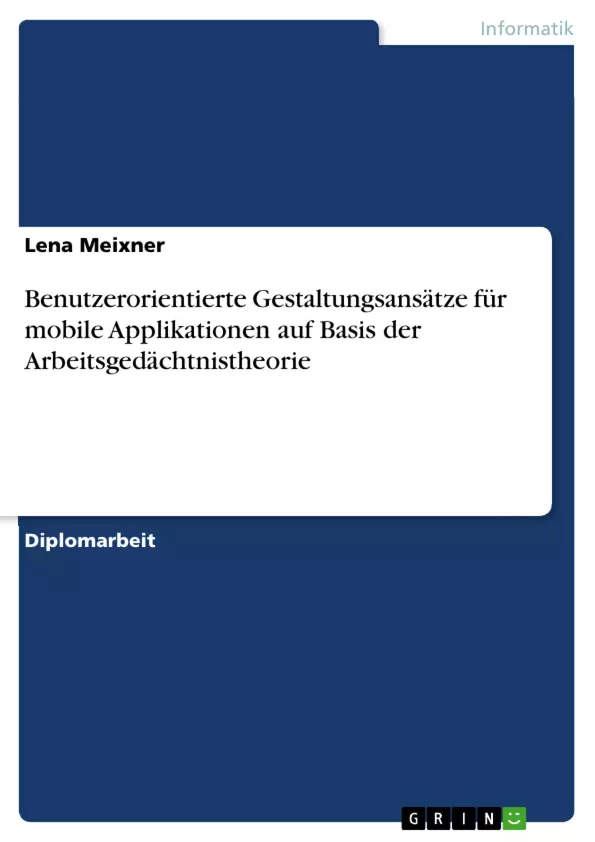In dieser Diplomarbeit werden Gestaltungsleitlinien für mobile Applikationen abgeleitet, die sich an den menschlichen Fähigkeiten, insbesondere des Arbeitsgedächtnisses und dessen Kapazität, orientieren. In diesem Zusammenhang wird weiterhin eine mobile Beispiel-Applikation entwickelt, die die zuvor hergeleiteten Gestaltungsleitlinien umsetzt.
Diesbezügliche Untersuchungen werden im Rahmen einer empirischen Erhebung stattfinden, in der Probanden einem Dual-Task-Szenario, bestehend aus einer mobilen Applikation und einer Sekundäraufgabe, ausgesetzt sind. Die Analyse der menschlichen Reaktion auf differente Szenarien gibt Rückschlüsse auf eine optimale Abstimmung der Informationsmenge und -darstellung im Sinneeiner individuellen Benutzerorientierung.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Ziel der Arbeit
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2 Grundlagen
- 2.1 Mobile Business
- 2.1.1 Begriffsabgrenzung
- 2.1.2 Potenziale des Mobile Business
- 2.1.2.1 Optimierung der Geschäftsprozesse
- 2.1.2.2 Transaktionskostensenkungspotenziale
- 2.1.3 Mobile Szenarien
- 2.1.4 Benutzerorientierte Gestaltung
- 2.2 Modelle des Arbeitsgedächtnisses
- 2.2.1 Arbeitsgedächtnismodell nach Baddeley
- 2.2.2 Arbeitsgedächtnismodell nach Oberauer
- 2.2.2.1 Funktionale Kategorien
- 2.2.2.2 Inhaltliche Kategorien
- 2.2.3 Vergleich der Modelle von Oberauer und Baddeley
- 2.3 Studie
- 2.4 Informationsdarstellung
- 2.4.1 Grundsätze der Informationsdarstellung
- 2.4.2 Umsetzung der Grundsätze der Informationsdarstellung
- 2.4.2.1 Ablauf der mobilen Anwendung
- 2.4.2.2 Darstellung der mobilen Anwendung
- 2.1 Mobile Business
- 3 Konzeption
- 3.1 Aufgabenstellungen
- 3.2 Auswahl des mobilen Endgeräts
- 3.2.1 Mobile Endgeräte
- 3.2.2 Kriterien bei der Auswahl des mobilen Endgeräts
- 3.2.3 Datenblatt des mobilen Endgeräts
- 3.3 Verwendete Programmiersprache: Java
- 3.3.1 Vor- und Nachteile von Java
- 3.3.2 Einschränkungen mobiler Endgeräte
- 3.3.3 Java Micro Edition
- 3.3.3.1 Connected Limited Device Configuration (CLDC)
- 3.3.3.2 Mobile Information Device Profile (MIDP)
- 3.3.3.3 Optionale Pakete
- 4 Die mobile Applikation
- 4.1 Verwendete Entwicklungsumgebung und Software
- 4.2 Analyse und Design
- 4.2.1 Primäraufgabe auf dem mobilen Endgerät
- 4.2.2 Sekundäraufgabe auf dem Laptop
- 4.3 Implementierung
- 4.3.1 Implementierung der Primäraufgabe
- 4.3.2 Implementierung der Sekundäraufgabe
- 5 Empirische Erhebung und Auswertung
- 5.1 Studienablauf
- 5.2 Ergebnisse der leistungsbezogenen Daten
- 5.3 Auswertung der leistungsbezogenen Daten
- 6 Fazit
- 6.1 Zusammenfassung der Erkenntnisse
- 6.2 Kritische Würdigung
- 6.3 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit konzentriert sich auf die Entwicklung von Gestaltungsleitlinien für mobile Anwendungen, die die menschlichen Fähigkeiten, insbesondere das Arbeitsgedächtnis und seine Kapazität, berücksichtigen. Dazu wird eine mobile Beispiel-Applikation entwickelt, die die erarbeiteten Gestaltungsleitlinien umsetzt.
- Entwicklung von Gestaltungsleitlinien für mobile Anwendungen
- Berücksichtigung des Arbeitsgedächtnisses und seiner Kapazität
- Entwicklung einer mobilen Beispiel-Applikation
- Empirische Untersuchung der Auswirkungen der Gestaltung auf die Benutzerfreundlichkeit
- Optimierung der Informationsmenge und -darstellung für eine individuelle Benutzerorientierung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit vor, die darin besteht, dass mobile Anwendungen häufig nicht optimal auf die kognitiven Fähigkeiten von Nutzern abgestimmt sind. Das Ziel der Arbeit ist die Ableitung von Gestaltungsleitlinien, die diese Aspekte berücksichtigen. Der Aufbau der Arbeit wird ebenfalls vorgestellt.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es werden verschiedene Modelle des Arbeitsgedächtnisses vorgestellt und die Bedeutung des Arbeitsgedächtnisses für die Gestaltung mobiler Anwendungen erläutert. Außerdem werden die Potenziale des Mobile Business und die Bedeutung einer benutzerorientierten Gestaltung diskutiert.
- Kapitel 3: Das Kapitel erläutert die Konzeption der mobilen Beispiel-Applikation. Die Auswahl des mobilen Endgeräts, die verwendete Programmiersprache und die Architektur der Anwendung werden beschrieben. Der Fokus liegt hier auf der Java-Programmiersprache und der Java Micro Edition (JavaME).
- Kapitel 4: Dieses Kapitel präsentiert die Implementierung der mobilen Applikation. Es werden die Entwicklungsumgebung und die verwendete Software vorgestellt. Die Analyse und das Design der Applikation sowie die Implementierung der Primäraufgabe und der Sekundäraufgabe werden detailliert beschrieben.
- Kapitel 5: Das Kapitel beschreibt die empirische Erhebung und Auswertung der Daten. Der Studienablauf wird erläutert und die Ergebnisse der leistungsbezogenen Daten werden präsentiert. Die Auswertung der Ergebnisse gibt Aufschluss über die Auswirkungen der Gestaltung der Applikation auf die Benutzerfreundlichkeit.
Schlüsselwörter
Mobile Anwendungen, Arbeitsgedächtnis, Gestaltungsleitlinien, Benutzerfreundlichkeit, Java Micro Edition, empirische Erhebung, Dual-Task-Szenario, Informationsdarstellung, Informationsmenge, Individualisierung, Benutzerorientierung.
- Citar trabajo
- Dipl. Wirtsch.-Inf. Lena Meixner (Autor), 2009, Benutzerorientierte Gestaltungsansätze für mobile Applikationen auf Basis der Arbeitsgedächtnistheorie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/426726