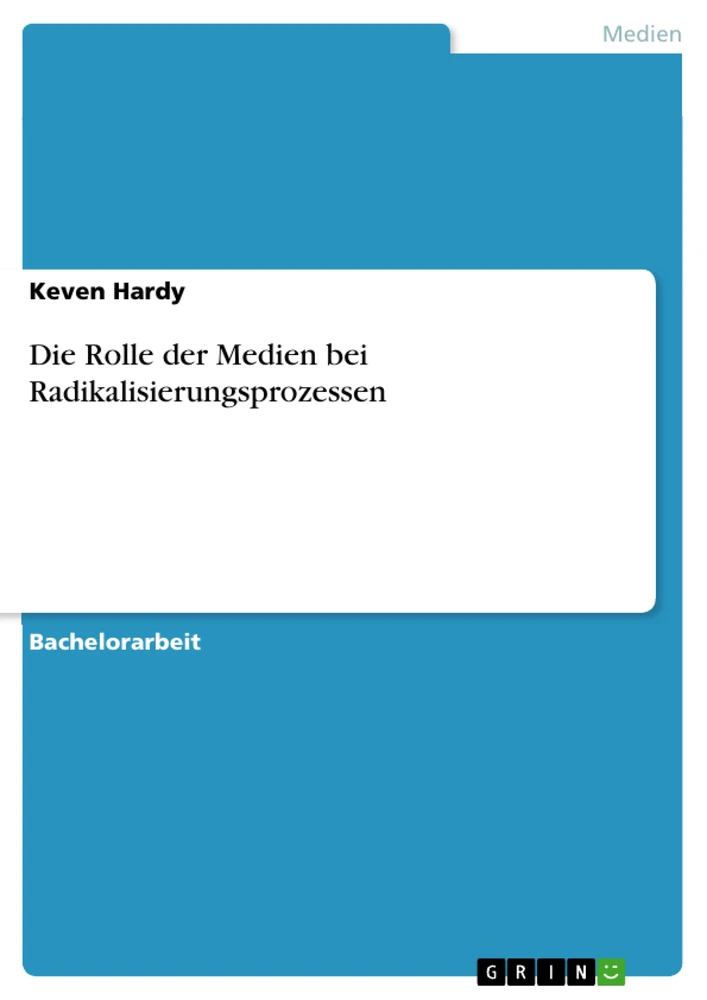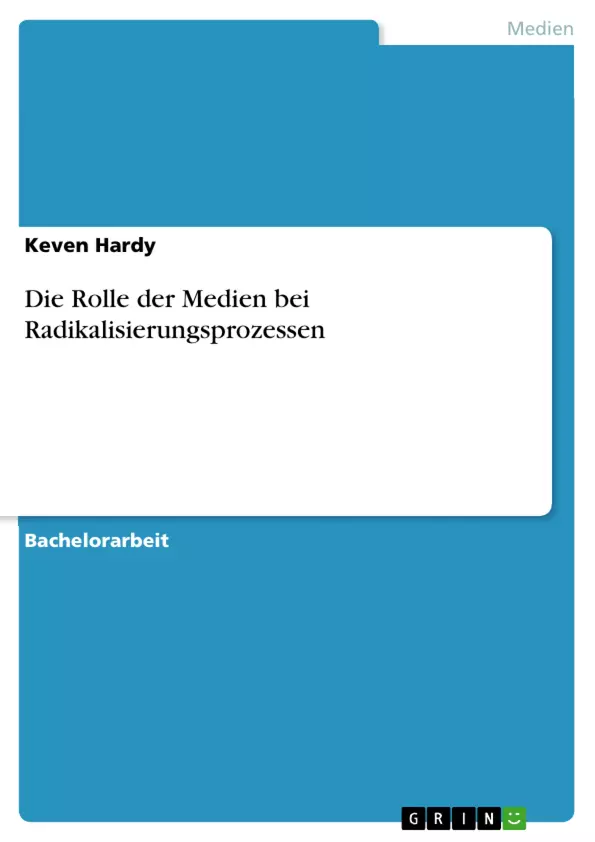Um die Wechselwirkung zwischen einer sich radikalisierenden Person und ihrem Mediennutzungsverhalten in Gänze beschreiben zu können, müsste diese während des gesamten Prozesses begleitet werden. Da ein solches Vorgehen in der Realität nicht umsetzbar ist, könnte stattdessen auch auf ein persönliches Manuskript zurückgegriffen werden, wie beispielsweise eine Biografie. Daher wurde dieser wissenschaftlichen Arbeit, für den Erhalt des akademischen Titels Bachelor of Arts, folgende Forschungsfrage zugrunde gelegt:
„Welche Schlüsse lassen sich aus drei Biografien bezüglich der Mediennutzung in den verschiedenen Phasen des Radikalisierungs- beziehungsweise des Ausstiegsprozesses ziehen?"
Die Anzahl an terroristisch motivierten Gewalttaten in Europa ist in den letzten Jahren immens gestiegen. Allein im Jahr 2017 kam es innerhalb der ersten sechs Monate zu acht terroristischen Anschlägen in europäischen Metropolen. Bei den Tätern handelte es sich dabei meist um Personen, die selbst in Europa aufgewachsen sind und ihre radikalen Ansichten vor Ort ausprägten. Diese Entwicklung ist hierbei aus zweierlei Gründen problematisch. Zum einen haben jene gewaltbereiten Extremisten ihre radikale Denk- und Handlungsweise in einer Gesellschaft ausgeprägt, die weltoffener und aufgeklärter ist, als je eine Zivilisation zuvor. Zum anderen leben sie in einem vollständig mediatisierten Zeitalter, welches einen nahezu unbegrenzten Zugang zu Informationen und Bildung ermöglicht.
Der gesellschaftliche Stand der Aufklärung, zusammen mit der endlosen Verfügbarkeit von Wissen, wirft die Frage nach dem „warum“ auf. Besteht eventuell sogar ein Zusammenhang zwischen der Radikalisierung und dem Zugang zu Informationen? Eine allgemeingültige Antwort auf diese Frage zu finden ist jedoch schwierig. Der Grund hierfür ist, dass Radikalisierungsprozesse oft sehr komplex und vor allem anonym verlaufen, wodurch sich eine empirische Überprüfbarkeit als schwierig und aufwendig erweist.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Theoretische Grundlagen
- 1.1 Radikalismus und Extremismus
- 1.1.1 Linksextremismus
- 1.1.2 Rechtsextremismus
- 1.1.3 Salafismus
- 1.2 Der Radikalisierungsprozess
- 1.2.1 The Staircase to Terrorism
- 1.2.2 Die Wurzeln des gewaltbereiten Extremismus
- 1.2.3 Theorie der Sozialen Identitäten
- 1.3 Der Medienbegriff
- 1.3.1 Medien zur öffentlichen Kommunikation
- 1.3.2 Medien zur interpersonellen Kommunikation
- 2. Die Rolle der Medien an Radikalisierungsprozessen: Eine qualitative Inhaltsanalyse
- 2.1 Methodik
- 2.1.1 Auswahl der Literatur
- 2.1.2 Betrachteter Medienbegriff
- 2.1.3 Betrachtetes Radikalisierungsmodell
- 2.1.4 Vorgehen und Analyseraster
- 2.2 Erhebung
- 2.2.1 Ergebnisse der Inhaltsanalyse „Ich war ein Salafist“
- 2.2.2 Ergebnisse der Inhaltsanalyse „Der Dschihadist“
- 2.2.3 Ergebnisse der Inhaltsanalyse „Koran im Kopf 2“
- 2.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- 3. Zusammenfassung und Ausblick
- 4. Anhang
- 4.1 Erhebungsprotokoll der qualitativen Inhaltsanalyse von „Ich war ein Salafist“
- 4.2 Erhebungsprotokoll der qualitativen Inhaltsanalyse von „Der Dschihadist“
- 4.3 Erhebungsprotokoll der qualitativen Inhaltsanalyse von Koran im Kopf 2”
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Rolle der Medien im Kontext von Radikalisierungsprozessen. Sie analysiert, wie Medien in den verschiedenen Phasen der Radikalisierung und des Ausstiegs genutzt werden und welche Einflüsse sie auf das Verhalten radikalisierter Personen haben.
- Begriffsbestimmung von Radikalismus und Extremismus
- Analyse des Radikalisierungsprozesses
- Die Rolle von Medien in der öffentlichen und interpersonellen Kommunikation
- Qualitative Inhaltsanalyse von Biografien ehemaliger Salafisten
- Zusammenhänge zwischen Mediennutzung und Radikalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas im Kontext der steigenden Anzahl terroristisch motivierter Gewalttaten in Europa beleuchtet. Anschließend werden im ersten Kapitel die Begriffe Radikalismus und Extremismus definiert und die drei extremistischen Milieus Linksextremismus, Rechtsextremismus und Salafismus vorgestellt. Der Radikalisierungsprozess wird aus verschiedenen theoretischen Perspektiven betrachtet, und die Rolle von Medien in der öffentlichen und interpersonellen Kommunikation wird analysiert.
Kapitel 2 beinhaltet die qualitative Inhaltsanalyse von drei Biografien ehemaliger Salafisten. Die Analyse konzentriert sich auf die Mediennutzung der Protagonisten in verschiedenen Phasen des Radikalisierungsprozesses und des Ausstiegs. Die Ergebnisse der Analyse werden in Bezug auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den drei Biografien diskutiert.
Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und interpretiert. Es wird ein Ausblick auf weitere Forschungsfelder gegeben, die sich mit der Rolle der Medien in Radikalisierungsprozessen befassen.
Schlüsselwörter
Radikalisierung, Extremismus, Salafismus, Mediennutzung, Inhaltsanalyse, Biografien, Qualitative Forschung, Terrorismus, soziale Identität, öffentliche Kommunikation, interpersonelle Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen Medien den Radikalisierungsprozess?
Medien dienen sowohl der öffentlichen als auch der interpersonellen Kommunikation und können in verschiedenen Phasen der Radikalisierung als Informationsquelle oder Identifikationsraum fungieren.
Welche extremistischen Milieus werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit definiert Linksextremismus, Rechtsextremismus und insbesondere den Salafismus als theoretische Grundlagen.
Was ist das Modell der "Staircase to Terrorism"?
Es ist ein theoretisches Modell, das den stufenweisen Prozess beschreibt, durch den Einzelpersonen zu gewaltbereiten Extremisten werden.
Welche Quellen wurden für die Analyse genutzt?
Die Untersuchung basiert auf einer qualitativen Inhaltsanalyse von drei Biografien ehemaliger Salafisten (z.B. "Ich war ein Salafist").
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Informationszugang und Radikalisierung?
Die Arbeit hinterfragt, warum Menschen in einer aufgeklärten Gesellschaft mit unbegrenztem Informationszugang radikale Ansichten entwickeln.
- Citation du texte
- Keven Hardy (Auteur), 2017, Die Rolle der Medien bei Radikalisierungsprozessen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/426933