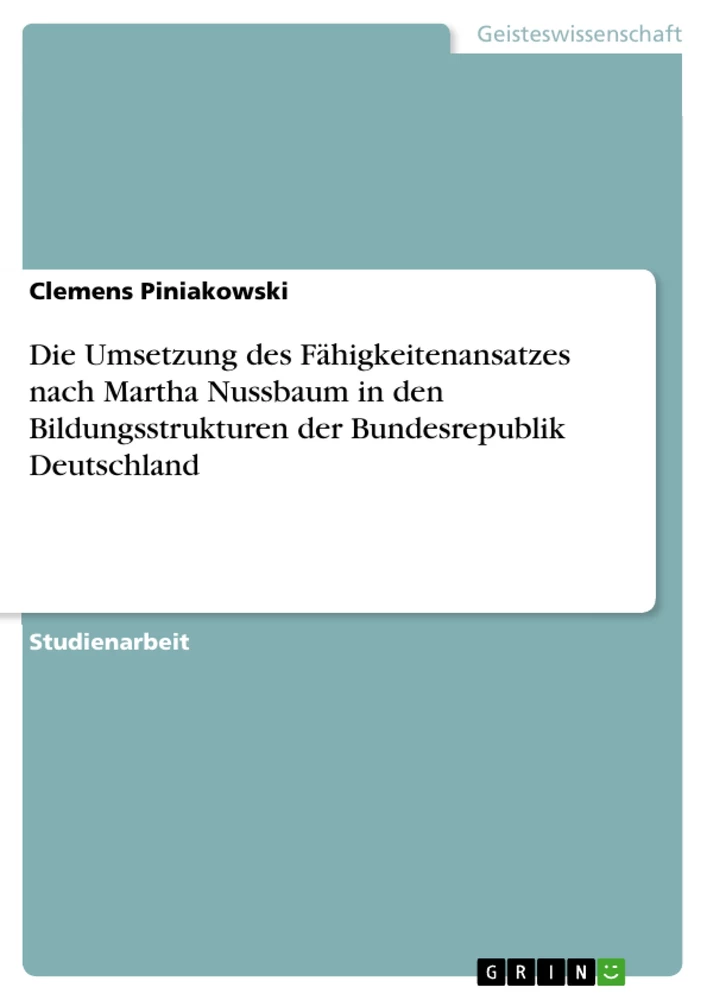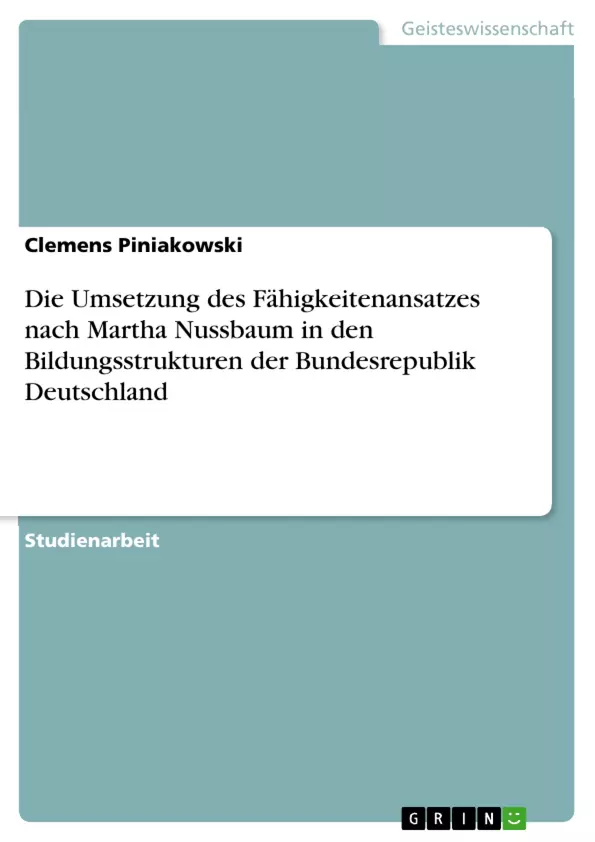Ein gerechter Umgang und eine gerechte Gesellschaft ist wohl die Wunsch- und Idealvorstellung eines jeden Menschen. Doch was ist eine Gerechte Gesellschaft? Was zeichnet sie aus? Diese Fragen versucht Martha Nussbaum in ihrem Buch „Die Grenzen der Gerechtigkeit“ zu erläutern. Dabei geht sie auch stark auf den Umgang mit Behinderten ein. Wie sollten diese Menschen gerechter Weise in einer Gesellschaft behandelt werden? Was zeichnet überhaupt einen Menschen aus?
Ich möchte vor allem die Herausforderungen der Integration von Behinderten für das deutsche Bildungssystem erläutern und untersuchen, inwiefern Nussbaums Theorie dabei hilfreich sein und Anwendung finden kann. Da dies natürlich ein sehr weites Untersuchungsfeld ist, werde ich mich innerhalb dieser Arbeit auf die Kerninhalte der Theorie beschränken und herausarbeiten, ob bzw. in wie weit diese mit den Zielsetzungen und Möglichkeiten der Institution Schule zu vereinbaren sind. Neben den Schwierigkeiten für die Umsetzung im Bildungssystem werde ich auch einige andere z.T. inhärente Probleme der Theorie erörtern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Fähigkeitenansatz nach Martha Nussbaum
- Zielsetzung und allgemeine Definitionen
- Eine Sammlung von Fähigkeiten
- Die Definition des Bürgers
- Die Förderung von Behinderten
- Integration von Behinderten im deutschen Bildungssystem
- Die Umsetzung des Ansatzes im aktuellen Bildungssystem
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie der Fähigkeitenansatz von Martha Nussbaum in den deutschen Bildungssystemen implementiert werden kann, insbesondere im Hinblick auf die Integration von Menschen mit Behinderungen. Der Text analysiert Nussbaums Theorie und untersucht, inwieweit sie mit den Zielsetzungen und Möglichkeiten des deutschen Bildungssystems vereinbar ist. Darüber hinaus werden potenzielle Herausforderungen und Probleme bei der Umsetzung des Ansatzes diskutiert.
- Die Kerninhalte des Fähigkeitenansatzes nach Martha Nussbaum
- Die Bedeutung der Förderung von Behinderten im Bildungssystem
- Die Vereinbarkeit des Fähigkeitenansatzes mit den Zielen des deutschen Bildungssystems
- Mögliche Herausforderungen bei der Umsetzung des Ansatzes
- Eine kritische Analyse der Anwendungsmöglichkeiten von Nussbaums Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach der Umsetzbarkeit des Fähigkeitenansatzes im deutschen Bildungssystem, insbesondere in Bezug auf die Integration von Menschen mit Behinderungen, vor. Die Arbeit konzentriert sich auf die Kerninhalte des Ansatzes und untersucht deren Vereinbarkeit mit den Zielen und Möglichkeiten der Institution Schule.
- Das zweite Kapitel präsentiert den Fähigkeitenansatz nach Martha Nussbaum. Hier werden die Zielsetzung und allgemeine Definitionen des Ansatzes erläutert. Des Weiteren werden die wichtigsten Fähigkeiten, die in der Theorie identifiziert werden, vorgestellt. Zudem wird die Definition des Bürgers im Kontext des Ansatzes diskutiert. Abschließend wird auf die Bedeutung der Förderung von Behinderten im Rahmen des Fähigkeitenansatzes eingegangen.
- Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Integration von Menschen mit Behinderungen im deutschen Bildungssystem. Hier werden die Herausforderungen und Möglichkeiten im Kontext des Bildungssystems analysiert.
- Das vierte Kapitel untersucht die Umsetzung des Fähigkeitenansatzes im aktuellen deutschen Bildungssystem. Es werden die Vereinbarkeit des Ansatzes mit den bestehenden Strukturen, sowie die potentiellen Herausforderungen und Probleme bei der Umsetzung diskutiert.
Schlüsselwörter
Fähigkeitenansatz, Martha Nussbaum, Gerechtigkeit, Behinderung, Bildungssystem, Integration, Deutschland, Lebensqualität, Menschenrechte, Grundrechte, Bildungsgerechtigkeit, Inklusion, Bildungspoltik, gesellschaftliche Teilhabe.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fähigkeitenansatz (Capability Approach) nach Martha Nussbaum?
Es ist ein ethisches Modell, das soziale Gerechtigkeit daran misst, ob Menschen die tatsächlichen Möglichkeiten (Fähigkeiten) haben, ein würdevolles Leben zu führen.
Wie betrachtet Martha Nussbaum den Umgang mit Behinderten?
Nussbaum fordert, dass eine gerechte Gesellschaft Behinderten die notwendige Unterstützung bieten muss, damit sie ihre grundlegenden menschlichen Fähigkeiten entfalten können.
Welche Herausforderungen gibt es bei der Integration im deutschen Bildungssystem?
Herausforderungen liegen in den starren Strukturen der Institution Schule und der Schwierigkeit, individuelle Förderung für Behinderte flächendeckend umzusetzen.
Wie definiert Nussbaum den Begriff des Bürgers?
Ein Bürger ist für Nussbaum ein Wesen mit Würde, dem der Staat garantieren muss, bestimmte zentrale Funktionen des Lebens (capabilities) ausüben zu können.
Inwiefern ist Nussbaums Theorie für Schulen hilfreich?
Sie bietet einen theoretischen Rahmen, um Bildungsziele nicht nur an Noten, sondern an der Entwicklung der Lebensqualität und Teilhabe der Schüler zu messen.
Gibt es Probleme bei der Umsetzung des Fähigkeitenansatzes?
Ja, inhärente Probleme der Theorie sowie praktische Finanzierungsfragen und Ressourcenmangel im Bildungssystem erschweren die vollständige Implementierung.
- Citation du texte
- Clemens Piniakowski (Auteur), 2017, Die Umsetzung des Fähigkeitenansatzes nach Martha Nussbaum in den Bildungsstrukturen der Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428100