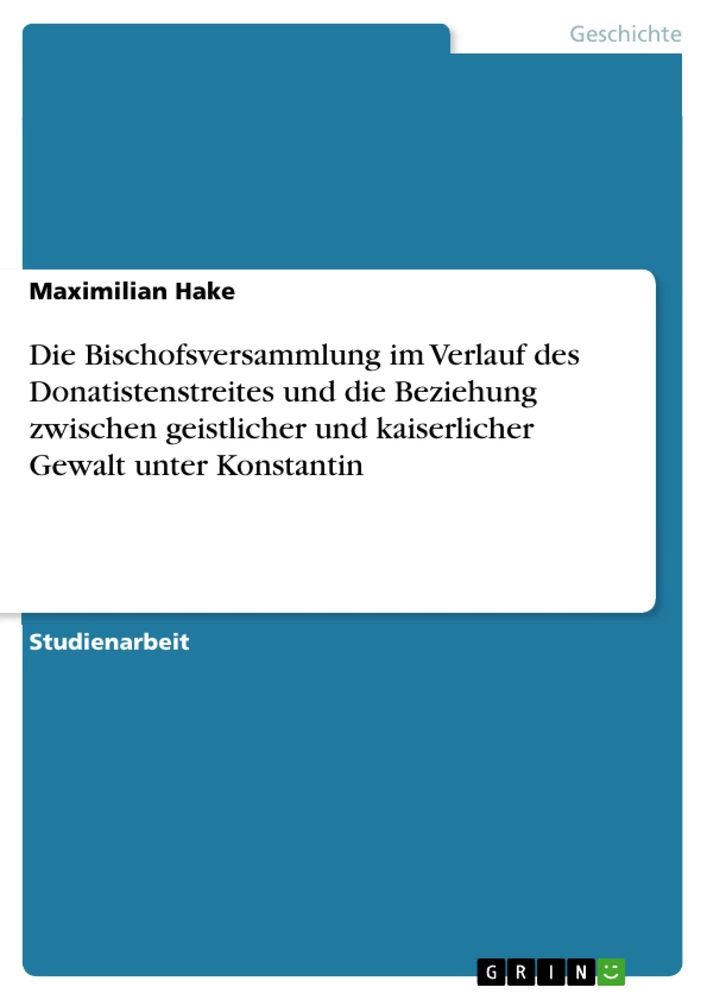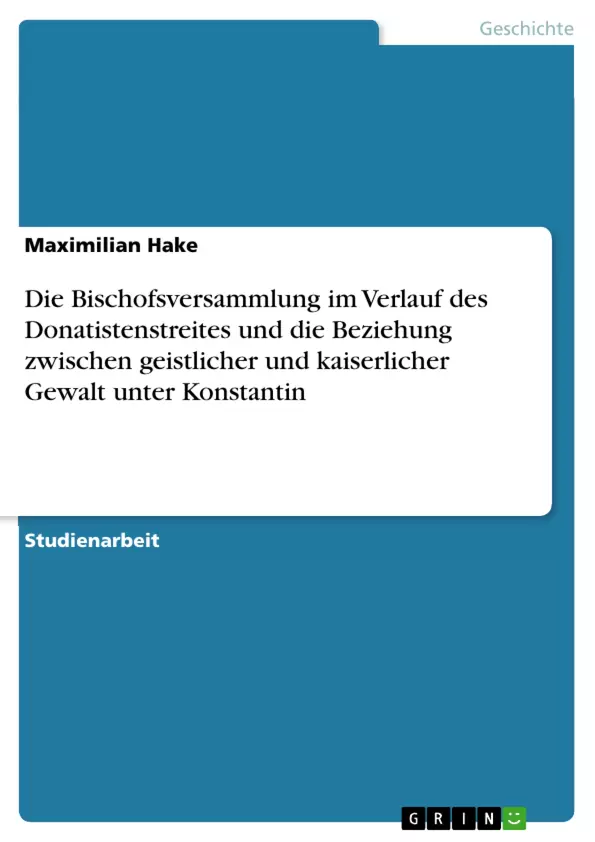Besonders in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte gab es viele Streitigkeiten in Bezug auf kirchliche Ämter. Diese erstreckten sich teilweise über mehrere Jahrzehnte. Ein Beispiel hierfür ist der sogenannte Donatistenstreit, der zwischen den Jahren 312-314 stattfand. Dieser flammte nach der Christenverfolgung von 303-311 auf. Im Kern der Auseinandersetzung ging es um die Frage, wie man mit Christen verfahren sollte, die vom Glauben abgefallen waren und Schriften und Gegenstände an den Staat ausgeliefert hatten, sogenannte Traditoren. Der Streit fand zwischen dem neu gewählten Bischof von Karthago, Caecilian, und den Anhängern von Donatus von Karthago statt, der sich während der Verfolgung angeblich nicht dem Staat gebeugt hatte. Caecilian wurde von einigen Teilen der nordafrikanischen Gemeinde nicht akzeptiert. Schließlich wurde er kurze Zeit nach seinem Amtsantritt durch eine Bischofsversammlung aus Numidien abgewählt. Dieser Schritt wurde damit begründet, dass einer seiner Ordinatoren (Bischof, der die Weihe durchführte) ein Traditor sei. Somit dürfe er nicht mehr das Amt des Bischofs innehaben und daher auch keinen Bischof weihen. Es wurde ein neuer Bischof namens Maiorinus gewählt und geweiht. Letztlich beanspruchten beide Seiten den legitimen Bischofstitel für sich.
Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzungen wurden mehrere Versammlungen einberufen, um die Streitigkeiten zu klären. Die Frage, die hierbei immer wieder im Raum steht, bezieht sich auf die Rolle Konstantins in diesem Streit. In der vorliegenden Hausarbeit soll es hierbei vor allem um die Frage nach dem Verhältnis von Kaiser und Bischofsversammlung gehen. Hierzu ist es notwendig, zunächst genauer auf den Verlauf des Donatistenstreites einzugehen sowie die kritische Quellenlage und die daraus folgenden Schwierigkeiten für eine Analyse der Rolle Konstantins zu beleuchten. Im Anschluss folgt dann eine Analyse der neu geschaffenen Form der Bischofsversammlung.
Inhaltsverzeichnis
- Erörterung der Fragestellung
- Kirche zur Zeit Konstantins
- Verhalten Konstantins gegenüber der Kirche & Einfluss auf die Kirche
- Kirchenstruktur und Selbstverständnis Konstantins
- Ablauf des Donatistenstreites
- Die Rolle Konstantins
- Historizität: Quellenkritik an Optat und kritische Hinterfragung zum Vorgehen Konstantins
- Kirchliches und ziviles - Konstantin als „oberster Richter“?
- Die Synode unter Konstantin - die Entstehung der Reichssynode
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Rolle Kaiser Konstantins im Donatistenstreit, insbesondere sein Verhältnis zu den Bischofsversammlungen. Sie analysiert den Verlauf des Streits, beleuchtet die Schwierigkeiten der Quellenlage und hinterfragt die Interpretationen verschiedener Autoren bezüglich Konstantins Handeln. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entstehung der Reichssynode als neue Form der Bischofsversammlung.
- Der Donatistenstreit und seine Ursachen
- Die Rolle Kaiser Konstantins im Donatistenstreit
- Quellenkritik und Herausforderungen der historischen Analyse
- Die Entwicklung und Bedeutung der Bischofsversammlungen
- Das Verhältnis von Kaiser und Kirche im 4. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
1. Erörterung der Fragestellung: Dieses Kapitel dient als Einleitung und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Verhältnis zwischen Kaiser Konstantin und den Bischofsversammlungen im Donatistenstreit vor. Es skizziert den Donatistenstreit, die beteiligten Parteien (Caecilian und Donatus) und die kontroverse Frage nach der Legitimität des Bischofs von Karthago. Die methodischen Herausforderungen der Quellenlage werden angesprochen, insbesondere die Einseitigkeit der überlieferten Quellen und die Schwierigkeit, Konstantins Rolle objektiv zu bewerten. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Bischofsversammlungen als zentrale Akteure in der Konfliktlösung und die Notwendigkeit einer differenzierten Analyse ihrer Entstehung und Funktion.
2. Kirche zur Zeit Konstantins: Dieses Kapitel beleuchtet die Situation der Kirche unter Konstantin vor dem Donatistenstreit. Es analysiert Konstantins Verhalten gegenüber der Kirche, insbesondere seine Rückgabe konfiszierter Kirchengüter und die Frage, ob dies als aktive Förderung des Christentums oder lediglich als Toleranzmaßnahme zu interpretieren ist. Das Kapitel untersucht auch die Kirchenstruktur und das Selbstverständnis der Kirche zu dieser Zeit, um das Umfeld des Donatistenstreits besser zu verstehen. Die Analyse konzentriert sich auf die verfügbaren Quellen und deren Interpretationen, um ein umfassendes Bild von den komplexen Beziehungen zwischen Kaiser und Kirche zu zeichnen.
3. Ablauf des Donatistenstreites: Dieses Kapitel beschreibt den zeitlichen Ablauf des Donatistenstreits. Es geht auf die zentralen Ereignisse, die Positionen der Konfliktparteien und die verschiedenen Versuche der Konfliktlösung ein. Die Zusammenfassung wird die Herausforderungen der Quellenlage betonen, da die Informationen aus unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichem Grad an Objektivität stammen. Das Kapitel wird die einzelnen Etappen des Streits und deren Bedeutung im Kontext der Entwicklung des Verhältnisses von Staat und Kirche im Römischen Reich darstellen.
4. Die Rolle Konstantins: Dieses Kapitel analysiert die Rolle Kaiser Konstantins im Donatistenstreit. Es geht auf die verschiedenen Interpretationen der historischen Quellen ein, berücksichtigt die Quellenkritik und bewertet das Handeln Konstantins. Das Kapitel untersucht die Frage, inwiefern Konstantin als „oberster Richter“ agierte und wie sich sein Eingreifen auf den Verlauf des Streits und die Entwicklung der Bischofsversammlungen auswirkte. Die Untersuchung der Bischofsversammlungen unter Konstantin bildet den Kern dieses Kapitels und beleuchtet deren Bedeutung für die Etablierung einer neuen Form der kirchlichen Entscheidungsfindung.
Schlüsselwörter
Donatistenstreit, Konstantin der Große, Bischofsversammlung, Reichssynode, Quellenkritik, Kirchenstruktur, Verhältnis von Staat und Kirche, Spätantike, Traditoren, Caecilian, Donatus.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Kaiser Konstantins Rolle im Donatistenstreit
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Rolle Kaiser Konstantins im Donatistenstreit, insbesondere sein Verhältnis zu den Bischofsversammlungen. Sie analysiert den Verlauf des Streits, die Quellenlage und hinterfragt die Interpretationen von Konstantins Handeln. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entstehung der Reichssynode.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Donatistenstreit und seine Ursachen, die Rolle Kaiser Konstantins, die Quellenkritik und die Herausforderungen der historischen Analyse, die Entwicklung und Bedeutung von Bischofsversammlungen sowie das Verhältnis von Kaiser und Kirche im 4. Jahrhundert.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: 1. Erörterung der Fragestellung; 2. Kirche zur Zeit Konstantins; 3. Ablauf des Donatistenstreites; 4. Die Rolle Konstantins; 5. Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen Aspekt der Forschungsfrage und baut aufeinander auf.
Was wird im Kapitel "Kirche zur Zeit Konstantins" behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die Situation der Kirche unter Konstantin vor dem Donatistenstreit. Es analysiert Konstantins Verhalten gegenüber der Kirche (Rückgabe konfiszierter Güter) und die Kirchenstruktur und das Selbstverständnis der Kirche zu dieser Zeit. Es untersucht, ob Konstantins Handeln als aktive Förderung des Christentums oder als Toleranzmaßnahme zu interpretieren ist.
Was wird im Kapitel "Ablauf des Donatistenstreites" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt den zeitlichen Ablauf des Donatistenstreits, die Positionen der Konfliktparteien (Caecilian und Donatus) und die Versuche der Konfliktlösung. Es betont die Herausforderungen der Quellenlage und die Darstellung der einzelnen Etappen des Streits im Kontext des Verhältnisses von Staat und Kirche.
Was wird im Kapitel "Die Rolle Konstantins" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert Konstantins Rolle im Donatistenstreit, verschiedene Interpretationen der Quellen, die Quellenkritik und bewertet Konstantins Handeln. Es untersucht, inwiefern Konstantin als „oberster Richter“ agierte und wie sein Eingreifen den Streit und die Entwicklung der Bischofsversammlungen beeinflusste. Die Untersuchung der Bischofsversammlungen unter Konstantin und die Entstehung der Reichssynode bilden den Kern dieses Kapitels.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Hausarbeit?
Donatistenstreit, Konstantin der Große, Bischofsversammlung, Reichssynode, Quellenkritik, Kirchenstruktur, Verhältnis von Staat und Kirche, Spätantike, Traditoren, Caecilian, Donatus.
Welche methodischen Herausforderungen werden in der Arbeit angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Einseitigkeit der überlieferten Quellen und die Schwierigkeit, Konstantins Rolle objektiv zu bewerten. Die Quellenkritik spielt eine zentrale Rolle bei der Analyse des Donatistenstreits und des Handelns Konstantins.
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Wie war das Verhältnis zwischen Kaiser Konstantin und den Bischofsversammlungen im Donatistenstreit?
Was ist die Bedeutung der Reichssynode?
Die Entstehung der Reichssynode als neue Form der Bischofsversammlung ist ein zentraler Schwerpunkt der Hausarbeit. Sie repräsentiert eine neue Form der kirchlichen Entscheidungsfindung im Kontext des Verhältnisses von Kaiser und Kirche.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Maximilian Hake (Author), 2017, Die Bischofsversammlung im Verlauf des Donatistenstreites und die Beziehung zwischen geistlicher und kaiserlicher Gewalt unter Konstantin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428217