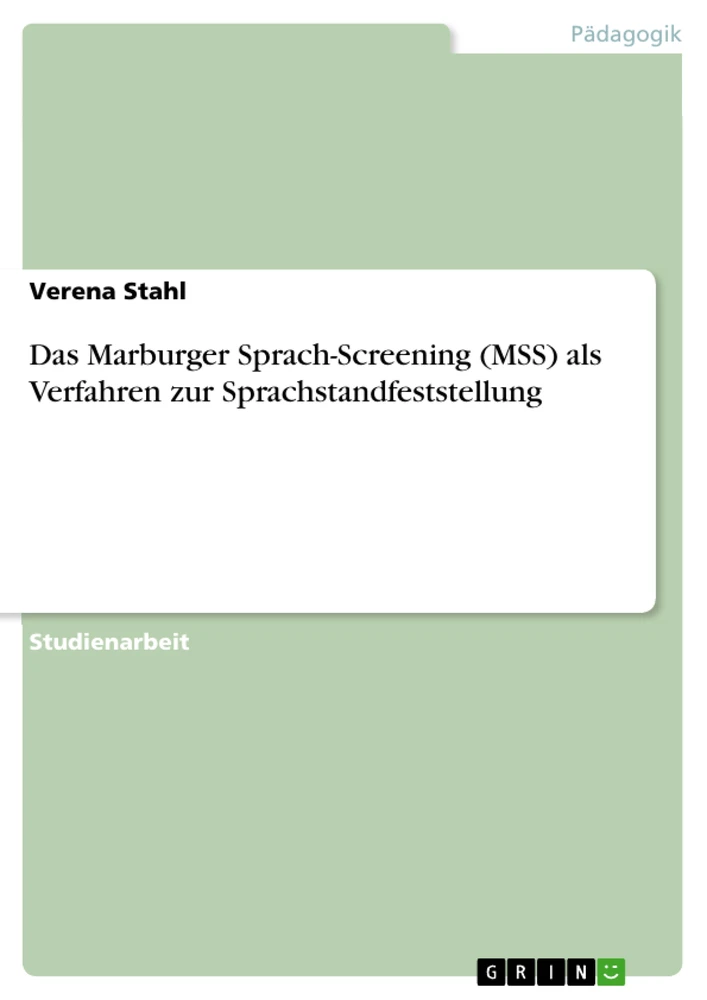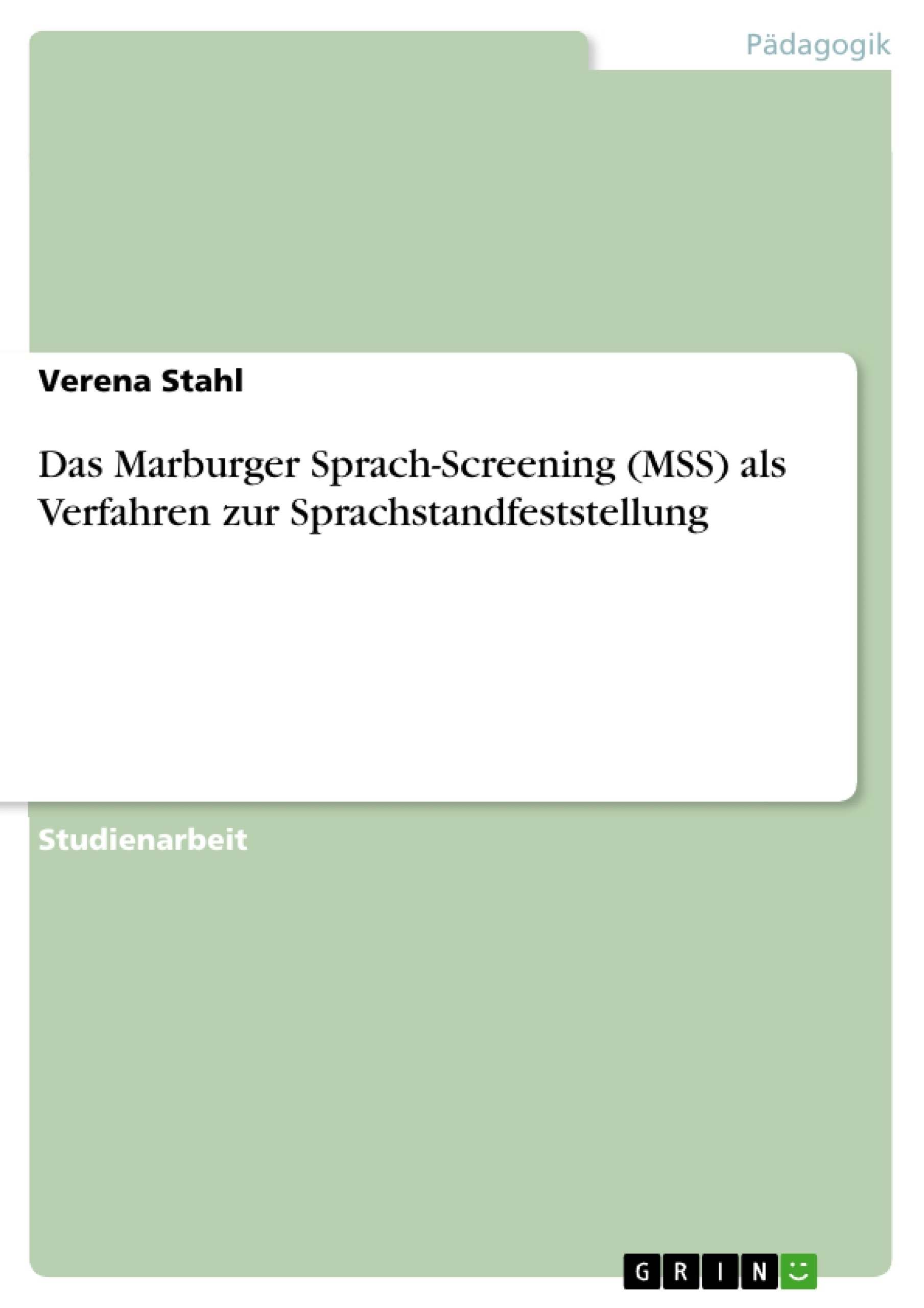Die Sprache ist im Alltag eines Menschen von großer Bedeutung. So kann es für ein Kind nur hilfreich sein, wenn dessen Fähigkeiten in diesem Bereich frühzeitig analysiert werden. Mithilfe einer Vielzahl von Verfahren zur Feststellung des Sprachstandes ist es den pädagogischen Fachkräften möglich, Stärken zu erkennen, möglichen Defiziten entgegenzuwirken, und dadurch für die Zukunft des Individuums vorzusorgen. Konkret behandelt die nachfolgende Arbeit das Marburger Sprach-Screening, bei dem das Kind durch eine pädagogische Fachkraft zu mehreren Bereichen der deutschen Sprache befragt wird und aus den Antworten mittels Auswertungsblatt sodann Schlüsse ziehen kann.
Dieses Verfahren wurde deshalb gewählt, da im Zuge der Praxis im Kindergarten bereits zu den Bögen BESK / BESK DaZ Erfahrung gesammelt, jedoch noch kein anderes Verfahren zur Sprachstandfeststellung kennengelernt wurde. Des Weiteren stellt die Reaktion des Kindes auf die Grafik „Spielplatz“ und der Verlauf der Befragung spannende Eckpunkte dar, weshalb das Interesse für das MSS geweckt wurde.
Diese Arbeit geht der Frage nach, ob sich die direkte Interaktion zwischen der pädagogischen Fachkraft und dem Kind als aussagekräftiger erweist, als eine „reine Beobachtung“. Meine damit in Verbindung stehende These sagt aus, dass es dadurch noch einfacher ist, zu objektiven und aussagekräftigen Ergebnissen zu gelangen.
Zu Beginn sollen die grundlegenden Begriffe „Muttersprache“ sowie „Mehrsprachigkeit“ definiert werden. Es soll sodann näher auf das MSS eingegangen werden. Zudem wurde dieses Verfahren in der Praxis getestet, dessen Durchführung und Ergebnisse an dieser Stelle reflektiert werden. Das MSS wird des Weiteren kritisch betrachtet. Zuletzt werden andere Verfahren zur Sprachstandfeststellung ergänzt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen
- 2.1. Muttersprache / Erstsprache
- 2.2. Bilingualismus-Mehrsprachigkeit
- 3. MSS als Sprachstandfeststellungsverfahren
- 3.1. Grundlagen
- 3.2. MSS in der Praxis
- 3.2.1. Reflexion der Durchführung
- 3.2.2. Zusammenfassung der Ergebnisse
- 3.3. Kritik
- 4. Weitere Verfahren zur Sprachstandfeststellung
- 5. Fazit
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Marburger Sprach-Screening (MSS) als Verfahren zur Sprachstandsfeststellung bei Kindern im Kindergartenalter. Die Zielsetzung besteht darin, die Anwendung des MSS in der Praxis zu reflektieren und dessen Aussagekraft im Vergleich zu rein beobachtenden Methoden zu bewerten. Die Arbeit beleuchtet die Definitionen von Muttersprache und Mehrsprachigkeit im Kontext des MSS.
- Das Marburger Sprach-Screening (MSS) und seine Anwendung.
- Die Bedeutung von Muttersprache und Mehrsprachigkeit für die Sprachentwicklung.
- Vergleich des MSS mit anderen Sprachstandsfeststellungsverfahren.
- Reflexion der praktischen Durchführung des MSS und Auswertung der Ergebnisse.
- Kritische Betrachtung des MSS.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die immense Bedeutung von Sprache für die Entwicklung eines Kindes und die Notwendigkeit frühzeitiger Analyse sprachlicher Fähigkeiten. Sie führt das Marburger Sprach-Screening (MSS) als Untersuchungsgegenstand ein und formuliert die These, dass die direkte Interaktion zwischen pädagogischer Fachkraft und Kind zu aussagekräftigeren Ergebnissen führt als reine Beobachtung. Der Bezug auf die Praxis im Kindergarten und die Neugier auf die Reaktion des Kindes auf das Bildmaterial des MSS als Motivation für die Arbeit wird hervorgehoben.
2. Definitionen: Dieses Kapitel liefert präzise Definitionen der Begriffe „Muttersprache/Erstsprache“ und „Bilingualismus/Mehrsprachigkeit“, basierend auf den Ausführungen von Ahrenholz. Es wird der Unterschied zwischen monolingualem und bilingualem Spracherwerb erläutert und die Relevanz dieser Unterscheidung für Sprachstandsfeststellungsverfahren herausgestellt. Der Fokus liegt auf der Bedeutung des familiären Kontextes beim Spracherwerb und der Vielfältigkeit sprachlicher Kompetenzen.
3. MSS als Sprachstandfeststellungsverfahren: Dieses Kapitel beschreibt das Marburger Sprach-Screening (MSS), seine Grundlagen und Anwendung. Es beleuchtet die von Holler-Zittlau, Dux und Berger entwickelten Testkomponenten zur Erfassung verschiedener sprachlicher Schlüsselkompetenzen bei Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren. Die Verwendung der Bildvorlage „Spielplatz“ und der Ablauf des Frage-Antwort-Spiels werden detailliert erklärt. Die Auswertung der Antworten nach „auffällig“ und „unauffällig“ anhand eines Punktesystems wird ebenfalls beschrieben.
Schlüsselwörter
Marburger Sprach-Screening (MSS), Sprachstandsfeststellung, Muttersprache, Mehrsprachigkeit, Bilingualismus, Sprachentwicklung, Kinder, Kindergarten, Sprachkompetenz, Kommunikation, Artikulation, Wortschatz, Begriffsbildung, Satzbildung, phonologische Diskriminationsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen zum Marburger Sprach-Screening (MSS)
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über das Marburger Sprach-Screening (MSS). Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und die wichtigsten Themen, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf der Anwendung des MSS in der Praxis, der Reflexion seiner Durchführung und der Bewertung seiner Aussagekraft im Vergleich zu anderen Methoden der Sprachstandsfeststellung.
Was ist das Marburger Sprach-Screening (MSS)?
Das Marburger Sprach-Screening (MSS) ist ein Verfahren zur Sprachstandsfeststellung bei Kindern im Kindergartenalter (4-6 Jahre). Es wurde von Holler-Zittlau, Dux und Berger entwickelt und basiert auf einem Frage-Antwort-Spiel mit einer Bildvorlage ("Spielplatz"), um verschiedene sprachliche Schlüsselkompetenzen zu erfassen. Die Ergebnisse werden anhand eines Punktesystems als "auffällig" oder "unauffällig" bewertet.
Welche sprachlichen Fähigkeiten werden mit dem MSS untersucht?
Das MSS untersucht verschiedene sprachliche Schlüsselkompetenzen, darunter Artikulation, Wortschatz, Begriffsbildung, Satzbildung und phonologische Diskriminationsfähigkeit. Es zielt darauf ab, frühzeitig mögliche sprachliche Entwicklungsstörungen zu erkennen.
Wie wird das MSS durchgeführt?
Das MSS wird durch eine direkte Interaktion zwischen pädagogischer Fachkraft und Kind durchgeführt. Die Fachkraft verwendet die Bildvorlage "Spielplatz" und stellt dem Kind Fragen, um dessen sprachliche Fähigkeiten zu testen. Die Antworten des Kindes werden anhand eines Punktesystems ausgewertet.
Welche Vorteile bietet das MSS im Vergleich zu rein beobachtenden Methoden?
Das Dokument argumentiert, dass die direkte Interaktion zwischen Erzieher und Kind im MSS zu aussagekräftigeren Ergebnissen führt als reine Beobachtung. Der aktive Austausch und die Reaktion des Kindes auf das Bildmaterial liefern detailliertere Informationen über dessen Sprachkompetenzen.
Wie werden die Ergebnisse des MSS interpretiert?
Die Ergebnisse des MSS werden anhand eines Punktesystems ausgewertet und als "auffällig" oder "unauffällig" klassifiziert. "Auffällige" Ergebnisse deuten auf einen möglichen Bedarf an weiterer sprachlicher Förderung hin.
Welche Definitionen von Muttersprache und Mehrsprachigkeit werden verwendet?
Das Dokument verwendet Definitionen von Muttersprache/Erstsprache und Bilingualismus/Mehrsprachigkeit, die auf den Ausführungen von Ahrenholz basieren. Es wird der Unterschied zwischen monolingualem und bilingualem Spracherwerb erläutert und dessen Relevanz für die Sprachstandsfeststellung hervorgehoben.
Welche anderen Verfahren zur Sprachstandsfeststellung werden erwähnt?
Das Dokument erwähnt neben dem MSS weitere Verfahren zur Sprachstandsfeststellung, jedoch ohne detaillierte Beschreibungen. Ein Vergleich mit diesen Verfahren dient der Einordnung und Bewertung des MSS.
Welche Kritikpunkte am MSS werden angesprochen?
Das Dokument erwähnt einen Abschnitt zur Kritik am MSS, dessen konkreter Inhalt jedoch nicht im Überblick dargestellt wird. Die kritische Betrachtung ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt dieser Arbeit?
Schlüsselwörter umfassen: Marburger Sprach-Screening (MSS), Sprachstandsfeststellung, Muttersprache, Mehrsprachigkeit, Bilingualismus, Sprachentwicklung, Kinder, Kindergarten, Sprachkompetenz, Kommunikation, Artikulation, Wortschatz, Begriffsbildung, Satzbildung, phonologische Diskriminationsfähigkeit.
- Citation du texte
- Verena Stahl (Auteur), 2015, Das Marburger Sprach-Screening (MSS) als Verfahren zur Sprachstandfeststellung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428249