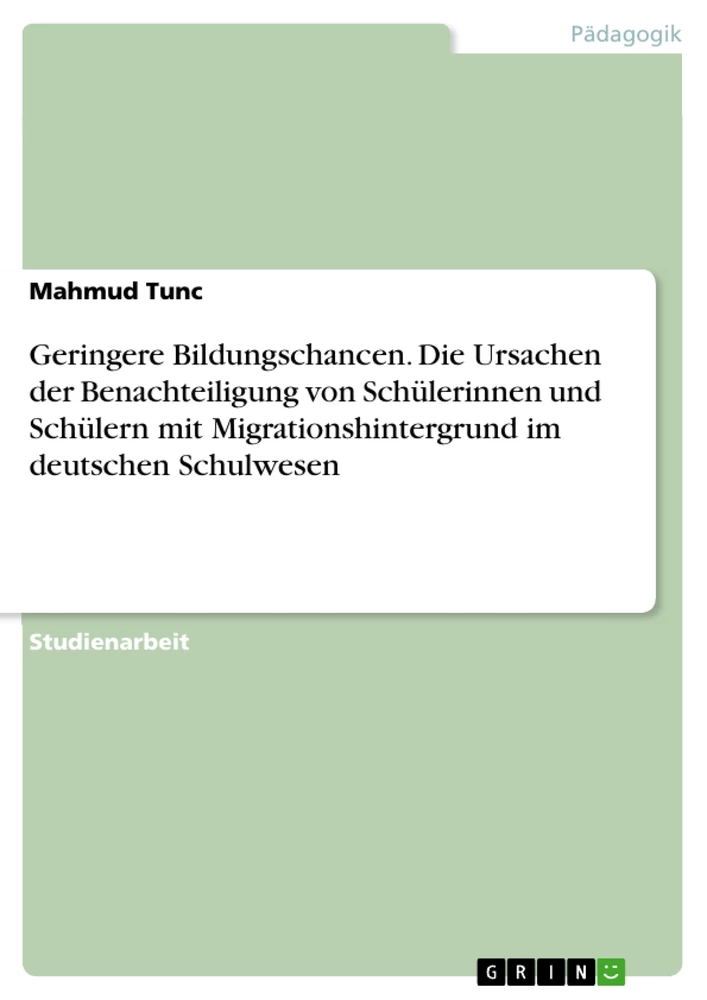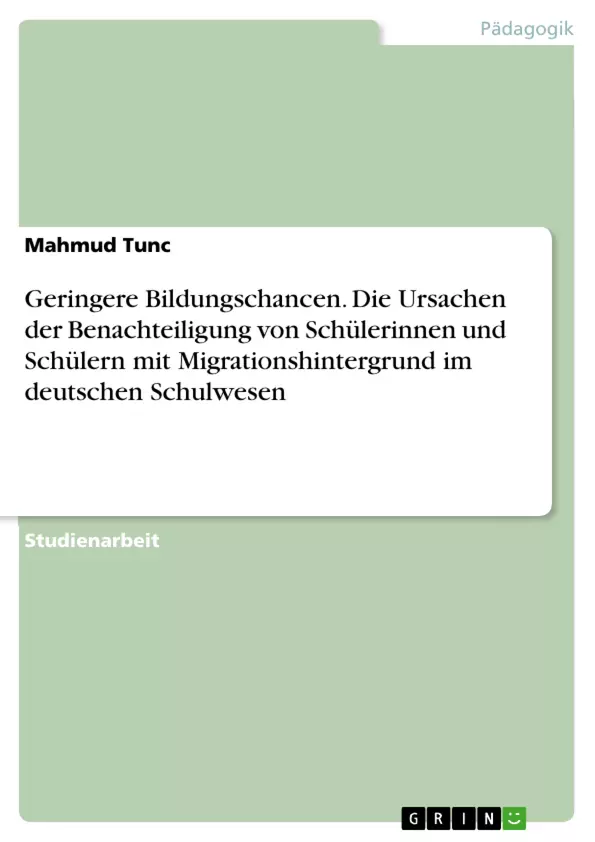Die Weitergabe von Bildung zählt mit großer Sicherheit zu den wichtigsten Aufgaben einer verantwortungsbewussten, modernen und gerechten Gesellschaft. Es ist hierbei besonders wichtig, dass die Bildung und die damit verbundenen Chancen, welche sich aus der Bildung ergeben, unabhängig von der Hautfarbe, dem Geschlecht oder sonstigen Merkmalen ermöglicht wird. Eine Chancengleichheit herzustellen und auf Dauer zu gewährleisten sollte im Fokus jedes Systems beziehungsweise jeder Gesellschaft stehen.
Bedauerlicherweise muss man immer wieder feststellen, dass es dennoch zu Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund im deutschen Schulwesen kommt. Es findet beispielsweise ein erheblicher Einfluss auf den Kompetenzerwerb und auf die Bildungsentscheidungen der Schülerinnen und Schüler statt. Aber auch familien- und kulturinterne Faktoren spielen eine Rolle. Das prägt die Lernenden in ihrer späteren privaten und beruflichen Laufbahn maßgeblich. Verschiedene Schulleistungsstudien (PISA oder IGLU) zeigen immer wieder deutlich auf, dass es erhebliche Unterschiede zwischen deutschen und ausländischen Kindern gibt.
Hinzu kommt, dass der Migrationshintergrund in Deutschland oft auch mit schlechteren sozialen Strukturen verbunden ist. In einer Studie des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration wird zum Beispiel aufgezeigt, dass „Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien [...] über ihre gesamte Bildungskarriere hinweg doppelt benachteiligt sind: durch ihren Migrationshintergrund, aber vor allem durch ihre soziale Herkunft.“ (Lokhande und Nieselt, 2016).
Aus diesen Gründen soll in dieser Hausarbeit untersucht werden, welche Ursachen zur Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund an deutschen Schulen führen. Hierfür werden zunächst einmal die Begriffe soziale Ungleichheit, Chancengleichheit und Migrationshintergrund definiert und eingeordnet. Des Weiteren wird die Situation von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, mit Hilfe von Zahlen, Daten und Fakten dargelegt. Anschließend werden mögliche Erklärungsansätze und Ursachen genannt, welche dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund benachteiligt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition und Einordnung
- 2.1 Definition und Einordnung des Begriffs der sozialen Ungleichheit
- 2.2 Definition und Einordnung des Begriffs Chancengleichheit
- 2.3 Definition und Einordnung des Begriffs Migrationshintergrund
- 3. Die Situation von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund
- 4. Erklärungen und Ursachen
- 4.1 Der kulturell-defizitäre Erklärungsansatz
- 4.2 Der humankapitaltheoretische Erklärungsansatz
- 4.3 Nachteile durch den Akteur Schule
- 4.4 Nachteile durch institutionelle Diskriminierung
- 5. Prävention - Überlegungen zur Minimierung der Benachteiligung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Ursachen der Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund im deutschen Schulwesen. Ziel ist es, die komplexen Faktoren zu beleuchten, die zu dieser Ungleichheit beitragen. Die Arbeit analysiert verschiedene Erklärungsansätze und legt den Fokus auf mögliche Präventionsmaßnahmen.
- Soziale Ungleichheit und ihre Auswirkungen auf Bildung
- Definition und Bedeutung von Chancengleichheit im Bildungssystem
- Die Situation von Schülern mit Migrationshintergrund: Daten und Fakten
- Kulturelle und sozioökonomische Einflussfaktoren auf den Bildungserfolg
- Möglichkeiten zur Minimierung der Benachteiligung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung von Chancengleichheit im Bildungssystem und stellt das Problem der Benachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund dar. Sie führt in die Thematik ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Einleitung verweist auf Studien, die die erheblichen Unterschiede im Kompetenzerwerb und in den Bildungsentscheidungen zwischen Schülern mit und ohne Migrationshintergrund belegen und stellt die Notwendigkeit der Untersuchung der Ursachen dieser Benachteiligung heraus. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit, die Ursachen der Benachteiligung zu untersuchen und mögliche Lösungsansätze zu diskutieren.
2. Definition und Einordnung: Dieses Kapitel definiert und ordnet die zentralen Begriffe „soziale Ungleichheit“, „Chancengleichheit“ und „Migrationshintergrund“ ein. Es wird erläutert, dass soziale Ungleichheit kein neues Phänomen ist und sich in allen Bereichen der Gesellschaft widerspiegelt, einschließlich der Bildung. Chancengleichheit wird als ein wichtiges Ziel der Bildungspolitik definiert, wobei die Arbeit auch auf die Herausforderungen bei der Umsetzung hinweist. Der Begriff „Migrationshintergrund“ wird umfassend erklärt, wobei sowohl die individuellen Migrationserfahrungen als auch die Abstammung von Migranten berücksichtigt werden.
3. Die Situation von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund: Dieses Kapitel präsentiert Zahlen, Daten und Fakten zur Situation von Schülern mit Migrationshintergrund im deutschen Schulsystem. Es beleuchtet die Diskrepanzen im Bildungserfolg zwischen dieser Gruppe und Schülern ohne Migrationshintergrund. Die Daten dienen als empirische Grundlage für die weitere Analyse der Ursachen der Benachteiligung. Das Kapitel liefert einen Überblick über die statistischen Realitäten und stellt damit die Basis für die folgenden Kapitel dar, welche sich mit den Ursachen und möglichen Lösungsansätzen auseinandersetzen.
4. Erklärungen und Ursachen: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Erklärungsansätze für die Benachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund. Es werden der kulturell-defizitäre Erklärungsansatz, der humankapitaltheoretische Erklärungsansatz, Nachteile durch den Akteur Schule und Nachteile durch institutionelle Diskriminierung beleuchtet. Jeder Ansatz wird kritisch analysiert und seine Stärken und Schwächen werden diskutiert. Das Kapitel verdeutlicht die Komplexität der Ursachen und betont, dass eine ganzheitliche Betrachtung notwendig ist, um das Problem angemessen zu adressieren.
5. Prävention - Überlegungen zur Minimierung der Benachteiligung: Dieses Kapitel befasst sich mit möglichen Präventionsmaßnahmen zur Minimierung der Benachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund. Es werden verschiedene Strategien und Ansätze diskutiert, die darauf abzielen, Chancengleichheit im Bildungssystem zu fördern und die Integration von Schülern mit Migrationshintergrund zu verbessern. Der Fokus liegt auf konkreten Maßnahmen und Vorschlägen, die auf den Erkenntnissen der vorhergehenden Kapitel basieren.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Chancengleichheit, Migrationshintergrund, Bildungssystem, Schulische Integration, Kompetenzerwerb, Prävention, Diskriminierung, Bildungspolitik, sozioökonomische Faktoren, kulturelle Faktoren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Benachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Ursachen der Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund im deutschen Schulsystem und analysiert mögliche Präventionsmaßnahmen zur Förderung von Chancengleichheit.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt soziale Ungleichheit, Chancengleichheit, den Begriff "Migrationshintergrund", die Situation von Schülern mit Migrationshintergrund (inklusive Daten und Fakten), kulturelle und sozioökonomische Einflussfaktoren auf den Bildungserfolg und Möglichkeiten zur Minimierung der Benachteiligung. Verschiedene Erklärungsansätze wie der kulturell-defizitäre und der humankapitaltheoretische Ansatz werden kritisch beleuchtet, ebenso wie die Rolle von Schule und institutioneller Diskriminierung.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Einleitung: Einführung in die Thematik und Darstellung des Problems. 2. Definition und Einordnung: Klärung der zentralen Begriffe. 3. Die Situation von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund: Darstellung der Situation anhand von Daten und Fakten. 4. Erklärungen und Ursachen: Analyse verschiedener Erklärungsansätze für die Benachteiligung. 5. Prävention - Überlegungen zur Minimierung der Benachteiligung: Diskussion möglicher Präventionsmaßnahmen. 6. Fazit: Zusammenfassung der Ergebnisse.
Welche Erklärungsansätze für die Benachteiligung werden untersucht?
Die Hausarbeit untersucht den kulturell-defizitären Erklärungsansatz, den humankapitaltheoretischen Erklärungsansatz, Nachteile durch den Akteur Schule (z.B. Lehrerverhalten) und Nachteile durch institutionelle Diskriminierung.
Welche Präventionsmaßnahmen werden diskutiert?
Das Kapitel zu Präventionsmaßnahmen diskutiert verschiedene Strategien und Ansätze zur Förderung von Chancengleichheit und zur Verbesserung der Integration von Schülern mit Migrationshintergrund. Konkrete Maßnahmen und Vorschläge werden auf Basis der vorherigen Kapitel präsentiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Soziale Ungleichheit, Chancengleichheit, Migrationshintergrund, Bildungssystem, Schulische Integration, Kompetenzerwerb, Prävention, Diskriminierung, Bildungspolitik, sozioökonomische Faktoren, kulturelle Faktoren.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit zielt darauf ab, die komplexen Faktoren zu beleuchten, die zur Benachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund beitragen. Sie analysiert verschiedene Erklärungsansätze und legt den Fokus auf mögliche Präventionsmaßnahmen.
- Quote paper
- Mahmud Tunc (Author), 2018, Geringere Bildungschancen. Die Ursachen der Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund im deutschen Schulwesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428336