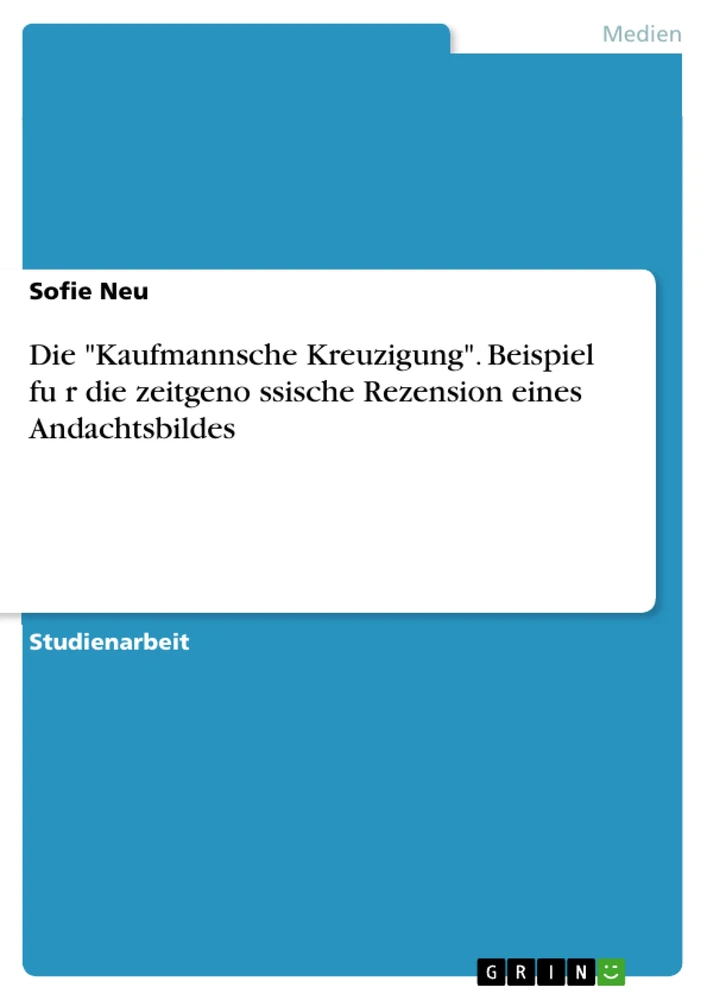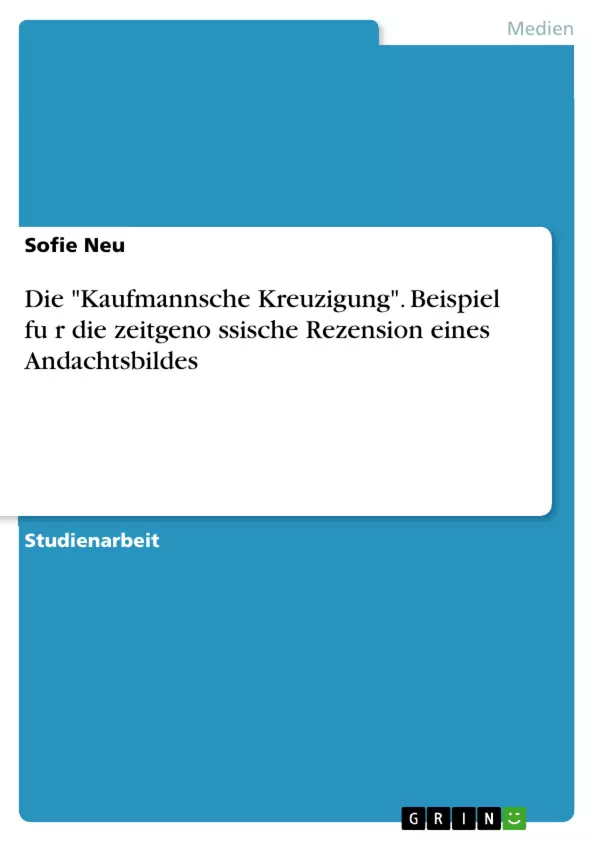Gegenstand dieser Hausarbeit ist die sogenannte Kaufmannsche Kreuzigung, ein böhmisches Gemälde eines unbekannten Meisters, das um 1340/50 entstand und von der Sammlung Richard Kaufmann 1918 in die Sammlung des Preußischen Kulturbesitzes überging. Heute hängt das 68,6 x 31,2 cm messende Bild in der Gemäldegalerie Berlin. Es zeigt als Bildtypus des volkreichen Kalvarienberges die Geschehnisse der Kreuzigung Christi auf dem Berg Golgatha. Immer wieder beschäftigte sich die Forschungsliteratur mit der Frage seiner genauen Herkunft, Datierung und möglichen Stilvorlagen , darauf kann hier aus Gründen der inhaltlichen Begrenzung nicht noch einmal eingegangen werden. Dieser Text soll eine genaue Bildbeschreibung, sowie eine detaillierte christlich-ikonographische Analyse des Bildes liefern, um sich darauffolgend mit dem Bildtypus des volkreichen Kalvarienberges im Spätmittelalter und einer möglichen Bildaufgabe der Kaufmannschen Kreuzigung auseinanderzusetzen. Die Dramatik der Darstellung und die möglichen Gründe für die Vielfigurigkeit der Darstellung spielen dabei eine besondere Rolle.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bildbeschreibung
- Ikonographische Bildanalyse
- Die Kreuzigung in den Evangelien und Apokryphen
- Die Entwicklung der Kreuzigungsdarstellung zum Volkreichen Kalvarienberg
- Die mögliche Funktion der Kaufmannschen Kreuzigung als Andachtsbild
- Bild und Betrachter im Hoch- und Spätmittelalter
- Vorteile der mehrfigurigen Darstellung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Kaufmannschen Kreuzigung, einem böhmischen Gemälde, das um 1340/50 entstand. Sie analysiert das Bild detailliert und untersucht seine ikonographischen Bezüge zur Passionsgeschichte. Darüber hinaus beleuchtet die Arbeit die Entwicklung des Bildtypus des volkreichen Kalvarienberges und die mögliche Funktion des Bildes als Andachtsbild im Spätmittelalter.
- Die ikonographische Analyse der Kaufmannschen Kreuzigung
- Die Entwicklung des Bildtypus des volkreichen Kalvarienberges
- Die Funktion des Bildes als Andachtsbild
- Die Bedeutung des Mitleidens für die Betrachtung des Bildes
- Die Beziehung zwischen Bild und Betrachter im Spätmittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt das Bild der Kaufmannschen Kreuzigung vor. Die Bildbeschreibung analysiert das Gemälde detailliert, beschreibt seine Komposition und die dargestellten Figuren. Die ikonographische Bildanalyse untersucht die Bezüge des Bildes zu den Evangelien und den Apokryphen und setzt die dargestellten Figuren in Bezug zu den biblischen Erzählungen. Das Kapitel „Die Entwicklung der Kreuzigungsdarstellung zum Volkreichen Kalvarienberg“ zeichnet die Entwicklung des Bildtypus nach und beleuchtet die Beweggründe für die mehrfigurige Darstellung der Kreuzigung.
Das Kapitel „Die mögliche Funktion der Kaufmannschen Kreuzigung als Andachtsbild“ untersucht die Funktion des Bildes als Instrument der privaten Andacht im Spätmittelalter. Dabei wird die Beziehung zwischen Bild und Betrachter im Hoch- und Spätmittelalter analysiert und die Rolle des Mitleidens und der Identifikation in der Betrachtung des Bildes beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit den Themen der christlichen Ikonographie, der Passionsgeschichte, dem Bildtypus des volkreichen Kalvarienberges, der Funktion von Andachtsbildern im Spätmittelalter, dem Mitleid und der Identifikation als Betrachtungsweisen von Bildern und der Beziehung zwischen Bild und Betrachter.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die "Kaufmannsche Kreuzigung"?
Es handelt sich um ein böhmisches Gemälde eines unbekannten Meisters aus der Zeit um 1340/50, das heute in der Gemäldegalerie Berlin zu sehen ist.
Was charakterisiert den Bildtypus des "volkreichen Kalvarienberges"?
Dieser Typus stellt die Kreuzigung Christi mit einer Vielzahl von Figuren und dramatischen Szenen auf dem Berg Golgatha dar, um die Ereignisse lebendig und emotional zu schildern.
Welche Funktion hatte das Bild im Spätmittelalter?
Es diente vermutlich als Andachtsbild für die private religiöse Versenkung, wobei das Mitleiden und die Identifikation des Betrachters mit dem Leiden Christi im Vordergrund standen.
Welche Quellen wurden für die ikonographische Analyse herangezogen?
Die Analyse stützt sich auf die biblischen Berichte der Evangelien sowie auf apokryphe Texte, um die dargestellten Symbole und Figuren zu deuten.
Warum ist die Vielfigurigkeit der Darstellung von Bedeutung?
Die mehrfigurige Darstellung erhöhte die Dramatik und bot dem mittelalterlichen Betrachter mehr Anhaltspunkte für das emotionale Mitleiden und die religiöse Reflexion.
Wie groß ist das Gemälde?
Das Bild hat eine Abmessung von 68,6 x 31,2 cm.
- Citation du texte
- Sofie Neu (Auteur), 2014, Die "Kaufmannsche Kreuzigung". Beispiel für die zeitgenössische Rezension eines Andachtsbildes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428821