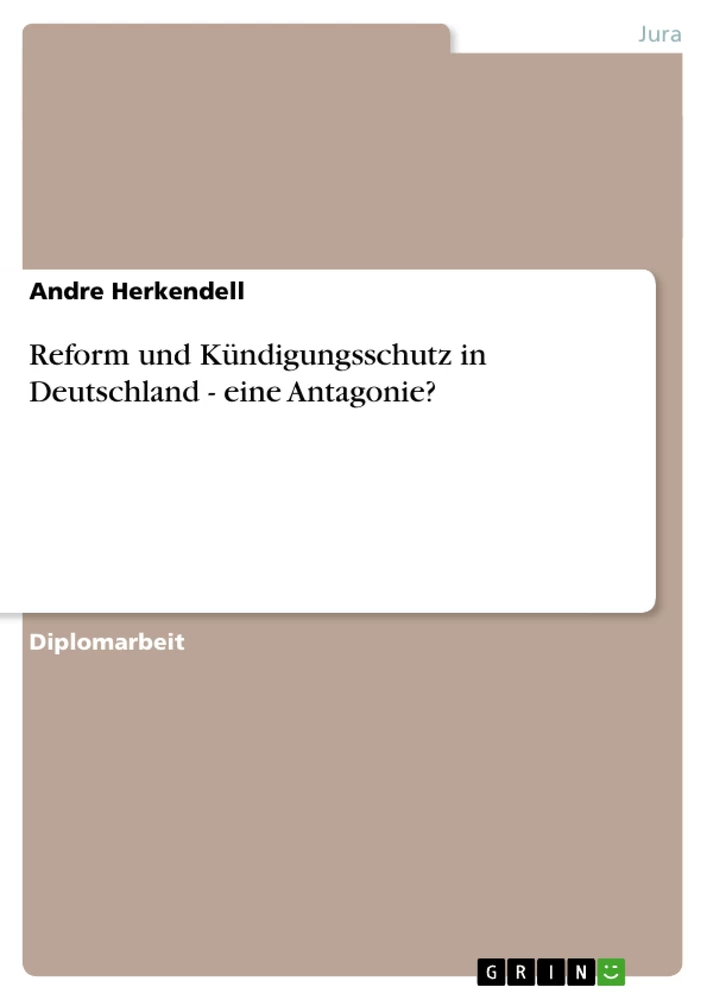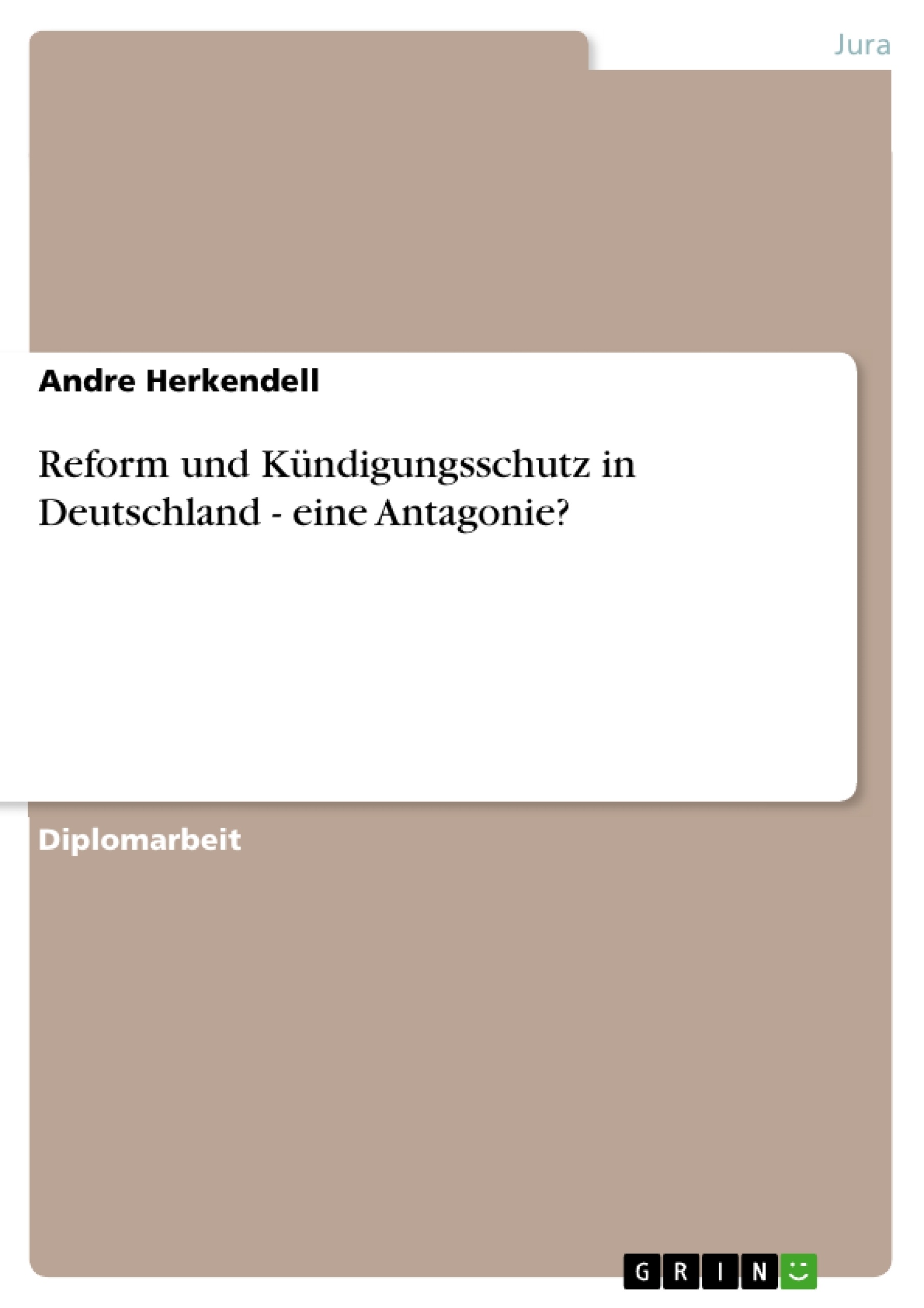Deutschlands wirtschaftliche Probleme sind groß: Das Wachstum erlahmt, die Arbeitslosenzahlen steigen ständig, die Verschuldung ist zu hoch. Ursache ist nicht nur die labile Konjunktur, sondern auch die Strukturkrise, in der sich das Land befindet. Um das zu ändern, hat Bundeskanzler Gerhard Schröder in seiner Regierungserklärung vom 14. März 2003 mit dem Titel „Mut zum Frieden und Mut zur Veränderung“ Strukturreformen vor allem in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik angekündigt. „Ohne Strukturreformen verpufft jeder Nachfrageimpuls.“ erklärte Schröder im Bundestag.
Eine der von Schröder angekündigten Maßnahmen ist die Reform des Kündigungsschutzrechts. Ein Thema, das in den letzten Wochen und Monaten von Politikern, Wirtschafts- und Arbeitsrechtswissenschaftlern gleichermaßen diskutiert wurde.
Viele Wirtschaftswissenschaftler sind der Überzeugung, dass die restriktiven Kündigungsschutzregelungen ein entscheidendes Beschäftigungshemmnis darstellen, weil die Unternehmer aus Angst vor nicht kalkulierbaren Entlassungskosten mit Neueinstellungen zögern.
Auch die Arbeitsrechtswissenschaft spart nicht an Kritik am bestehenden deut-schen Kündigungsschutzrecht: Es sei unsinnig, nicht realitätsnah und würde als „Abwehrbollwerk“ Arbeitsplatzinhaber vor den Arbeitsplatzsuchenden schützen. Kündigungsschutzprozesse hätten „Lotteriecharakter“ und würden die Beteiligten zu unwürdigem Feilschen und Taktieren, Verschleiern und Lügen zwingen.
In der Politik betrachtet man ebenfalls das Kündigungsschutzrecht als Hindernis für Einstellungen. Deshalb wird es als notwendig erachtet, Korrekturen vorzunehmen, um die wirtschaftlichen Kräfte zu mobilisieren und das unternehmerische Engagement zu steigern. Heftige Kritik kommt dagegen aus Gewerkschaftskreisen, weil befürchtet wird, dass eine Reform zu einer noch höheren Arbeitslosigkeit führt.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Aktuelle Diskussion
- II. Entwicklung des Kündigungsschutzrechts
- III. Verfassungsrechtliche Grundlagen
- B. Arbeitsmarktwirkungen des Kündigungsschutzes
- C. Kritik am Kündigungsschutzrecht
- I. Ausgangslage des geltenden Kündigungsschutzrechts
- 1. Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes
- 2. Soziale Rechtfertigung der Kündigung
- 3. Geltendmachung der Sozialwidrigkeit durch Kündigungsschutzklage
- II. Mängel und Probleme in der Praxis
- 1. Richterrecht und Rechtsunsicherheit durch § 1 KSchG
- a) Personenbedingte Kündigung
- b) Verhaltensbedingte Kündigung
- c) Betriebsbedingte Kündigung
- 2. Wartezeit in § 1 Abs. 1 KSchG
- 3. Kündigungsschutzrechtliche Privilegierung von Kleinbetrieben durch § 23 KSchG
- a) Verfassungsmäßigkeit der Kleinbetriebsklausel
- b) Diskussion um die Flexibilisierung des Schwellenwertes
- c) Tendenzen der Rechtsprechung
- 4. Anhörung des Betriebsrates
- 5. Weiterbeschäftigungsanspruch
- 6. Sonderkündigungsschutz
- a) Kündigungsschutz Schwerbehinderter
- b) Kündigungsschutz gemäß §§ 9 MuSchG, 18 BErzGG
- 7. Betriebsübergang
- 8. Prozessdauer und Verzugsrisiko
- 9. Abfindungspraxis
- a) Bedeutung des gerichtlichen Abfindungsvergleichs
- b) Abfindungspraxis an deutschen Arbeitsgerichten
- D. Kündigungsschutz in der Europäischen Union
- I. Überblick über die Rechtslage in ausgewählten EU-Staaten
- II. Rechtsvergleich mit dem deutschen Recht
- E. Reformbestrebungen in der Politik und Literatur
- I. Der Kündigungsschutz im politischen Wandel
- 1. Modifikationen im Kündigungsschutzrecht durch das Arbeitsrechtliche Beschäftigungsförderungsgesetz von 1996
- 2. Reformforderungen von Parteien und Verbänden in der heutigen Zeit
- 3. Das Reformkonzept der Bundesregierung
- II. Darstellung von Reformvorschlägen in der Literatur
- F. Eigener Reformvorschlag
- I. Änderungsvorschläge im KSchG und BetrVG
- II. Steuerrechtliche und sozialversicherungsrechtliche Optimierung
- G. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit analysiert den Kündigungsschutz in Deutschland und vergleicht ihn mit Regelungen in anderen EU-Staaten. Ziel ist es, die bestehenden Mängel und Probleme des deutschen Kündigungsschutzrechts aufzuzeigen und mögliche Reformansätze zu diskutieren.
- Analyse des deutschen Kündigungsschutzrechts
- Vergleich mit dem Kündigungsschutz in anderen EU-Staaten
- Kritikpunkte und Mängel des bestehenden Rechts
- Diskussion von Reformvorschlägen
- Entwicklung eines eigenen Reformvorschlags
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein, beleuchtet die aktuelle Diskussion um den Kündigungsschutz und skizziert den weiteren Aufbau der Arbeit. Sie stellt den Kontext der Arbeit dar und verortet die Thematik innerhalb der aktuellen arbeitsrechtlichen Debatte. Die Einleitung liefert eine kurze Übersicht über die Entwicklung des Kündigungsschutzrechts und die verfassungsrechtlichen Grundlagen. Sie dient als Wegweiser für den Leser, der die zentralen Forschungsfragen und den methodischen Ansatz der Arbeit verstehen möchte.
B. Arbeitsmarktwirkungen des Kündigungsschutzes: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen des Kündigungsschutzes auf den Arbeitsmarkt. Es analysiert, inwiefern der Kündigungsschutz die Arbeitsmarktstabilität beeinflusst und welche Folgen sich für Arbeitnehmer und Arbeitgeber ergeben. Hier werden sowohl positive als auch negative Effekte des Kündigungsschutzes beleuchtet und ökonomische Aspekte detailliert betrachtet. Der Fokus liegt auf dem Abwägen von Sicherheit für Arbeitnehmer und Flexibilität für Unternehmen.
C. Kritik am Kündigungsschutzrecht: Kapitel C widmet sich einer detaillierten Kritik des geltenden Kündigungsschutzrechts. Es analysiert die Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes, die soziale Rechtfertigung von Kündigungen und die Geltendmachung der Sozialwidrigkeit. Ein Schwerpunkt liegt auf den Mängeln und Problemen in der Praxis, wie Richterrecht, Rechtsunsicherheit, Wartezeiten, die Privilegierung von Kleinbetrieben und die Dauer von Prozessen. Die verschiedenen Kündigungstypen (personen-, verhaltens- und betriebsbedingt) werden im Detail betrachtet und ihre jeweiligen Problematiken dargelegt.
D. Kündigungsschutz in der Europäischen Union: In diesem Kapitel wird der Kündigungsschutz in verschiedenen EU-Staaten verglichen. Es bietet einen Überblick über die Rechtslage in ausgewählten Ländern und analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Vergleich zum deutschen Recht. Der Fokus liegt auf den verschiedenen Ansätzen zum Kündigungsschutz und deren Auswirkungen. Die vergleichende Analyse dient der Einordnung des deutschen Systems in den europäischen Kontext und der Identifizierung von Best-Practice-Beispielen.
E. Reformbestrebungen in der Politik und Literatur: Dieses Kapitel befasst sich mit den Reformbestrebungen im politischen und wissenschaftlichen Diskurs. Es analysiert Modifikationen des Kündigungsschutzrechts, Reformforderungen von Parteien und Verbänden sowie das Konzept der Bundesregierung. Ausserdem werden verschiedene Reformvorschläge aus der Literatur vorgestellt und kritisch diskutiert. Der Abschnitt liefert einen umfassenden Überblick über die aktuellen Debatten und unterschiedlichen Lösungsansätze.
F. Eigener Reformvorschlag: Kapitel F präsentiert einen eigenen Reformvorschlag, der auf den vorherigen Analysen und der Literaturrecherche basiert. Dieser Vorschlag beinhaltet Änderungsvorschläge im Kündigungsschutzgesetz und im Betriebsverfassungsgesetz sowie steuerrechtliche und sozialversicherungsrechtliche Optimierungen. Er zielt auf eine Verbesserung des bestehenden Systems ab, indem er versucht, die Interessen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern besser auszugleichen.
Schlüsselwörter
Kündigungsschutz, Kündigungsschutzgesetz (KSchG), Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), Arbeitsrecht, Arbeitsmarkt, EU-Recht, Rechtsvergleich, Reform, Sozialwidrigkeit, Kleinbetriebe, Abfindung, Rechtsunsicherheit, Arbeitnehmerrechte, Arbeitgeberinteressen.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Analyse des Kündigungsschutzes in Deutschland und der Europäischen Union
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit analysiert umfassend den Kündigungsschutz in Deutschland, beleuchtet dessen Mängel und Probleme und vergleicht ihn mit Regelungen in anderen EU-Staaten. Ziel ist die Diskussion möglicher Reformansätze und die Entwicklung eines eigenen Reformvorschlags.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, die die aktuelle Diskussion und die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Kündigungsschutzes beschreibt. Es folgt eine Analyse der Arbeitsmarktwirkungen des Kündigungsschutzes und eine detaillierte Kritik des bestehenden Rechts, einschließlich der Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG), der Sozialwidrigkeit von Kündigungen und der Problematik in der Praxis (z.B. Richterrecht, Rechtsunsicherheit, Wartezeiten, Kleinbetriebsklausel, Prozessdauer). Ein Rechtsvergleich mit anderen EU-Staaten wird durchgeführt. Die Arbeit beinhaltet eine Darstellung von Reformbestrebungen in Politik und Literatur und schließt mit einem eigenen Reformvorschlag, der Änderungen im KSchG und BetrVG sowie steuer- und sozialversicherungsrechtliche Optimierungen umfasst.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel A. Einleitung, B. Arbeitsmarktwirkungen des Kündigungsschutzes, C. Kritik am Kündigungsschutzrecht, D. Kündigungsschutz in der Europäischen Union, E. Reformbestrebungen in der Politik und Literatur und F. Eigener Reformvorschlag. Jedes Kapitel wird in Unterkapitel und - in einigen Fällen - Unterunterkapitel unterteilt, um die Thematik detailliert zu behandeln. Die Arbeit enthält zudem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Schlüsselwortverzeichnis.
Welche Kritikpunkte am deutschen Kündigungsschutzrecht werden angesprochen?
Die Arbeit kritisiert unter anderem die Rechtsunsicherheit durch Richterrecht, insbesondere im Bezug auf die Auslegung von § 1 KSchG (personenbedingte, verhaltensbedingte und betriebsbedingte Kündigungen), die Wartezeit in § 1 Abs. 1 KSchG, die Privilegierung von Kleinbetrieben durch § 23 KSchG, die Dauer von Prozessen und die Abfindungspraxis. Auch die Anhörung des Betriebsrates, der Weiterbeschäftigungsanspruch und der Sonderkündigungsschutz werden kritisch beleuchtet.
Wie wird der deutsche Kündigungsschutz im europäischen Kontext eingeordnet?
Die Arbeit vergleicht das deutsche Kündigungsschutzrecht mit dem anderer EU-Staaten. Sie bietet einen Überblick über die Rechtslage in ausgewählten Ländern und analysiert Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Vergleich zum deutschen Recht, um das deutsche System in den europäischen Kontext einzuordnen und Best-Practice-Beispiele zu identifizieren.
Welche Reformvorschläge werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert Reformvorschläge aus Politik und Literatur und präsentiert einen eigenen Reformvorschlag. Dieser beinhaltet Änderungsvorschläge im Kündigungsschutzgesetz und Betriebsverfassungsgesetz sowie steuerrechtliche und sozialversicherungsrechtliche Optimierungen, die auf einen besseren Interessenausgleich zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern abzielen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kündigungsschutz, Kündigungsschutzgesetz (KSchG), Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), Arbeitsrecht, Arbeitsmarkt, EU-Recht, Rechtsvergleich, Reform, Sozialwidrigkeit, Kleinbetriebe, Abfindung, Rechtsunsicherheit, Arbeitnehmerrechte, Arbeitgeberinteressen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit Arbeitsrecht, insbesondere dem Kündigungsschutz, beschäftigen, einschließlich Juristen, Arbeitsrechtler, Wirtschaftswissenschaftler, Politiker und Gewerkschaftsmitglieder. Sie bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der Diskussion und liefert wertvolle Impulse für zukünftige Reformen.
- Quote paper
- Andre Herkendell (Author), 2005, Reform und Kündigungsschutz in Deutschland - eine Antagonie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42894