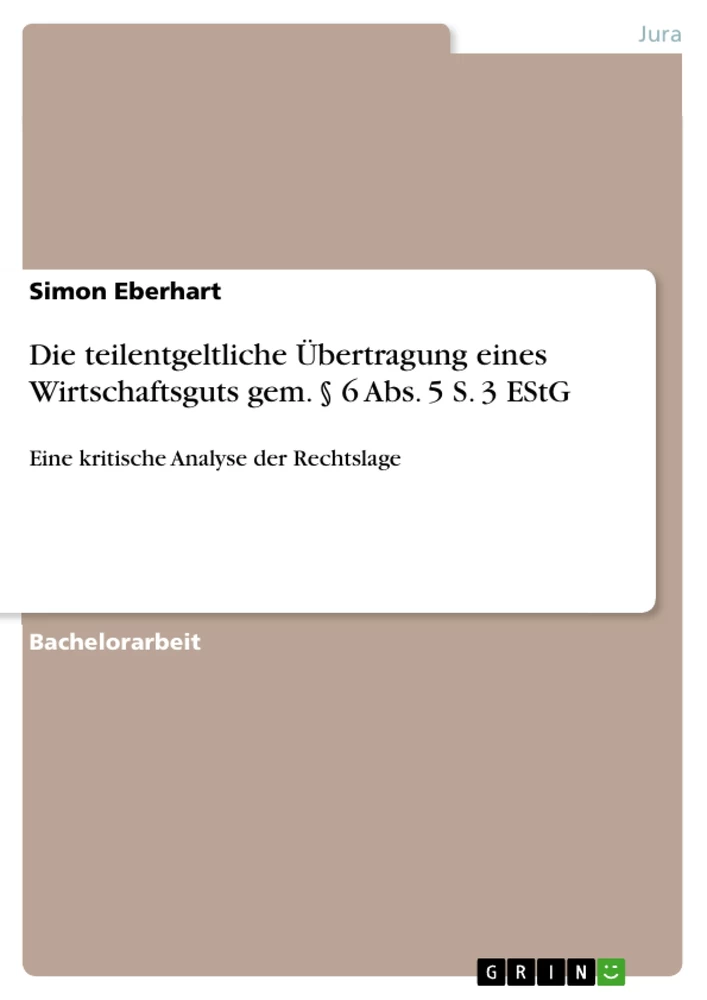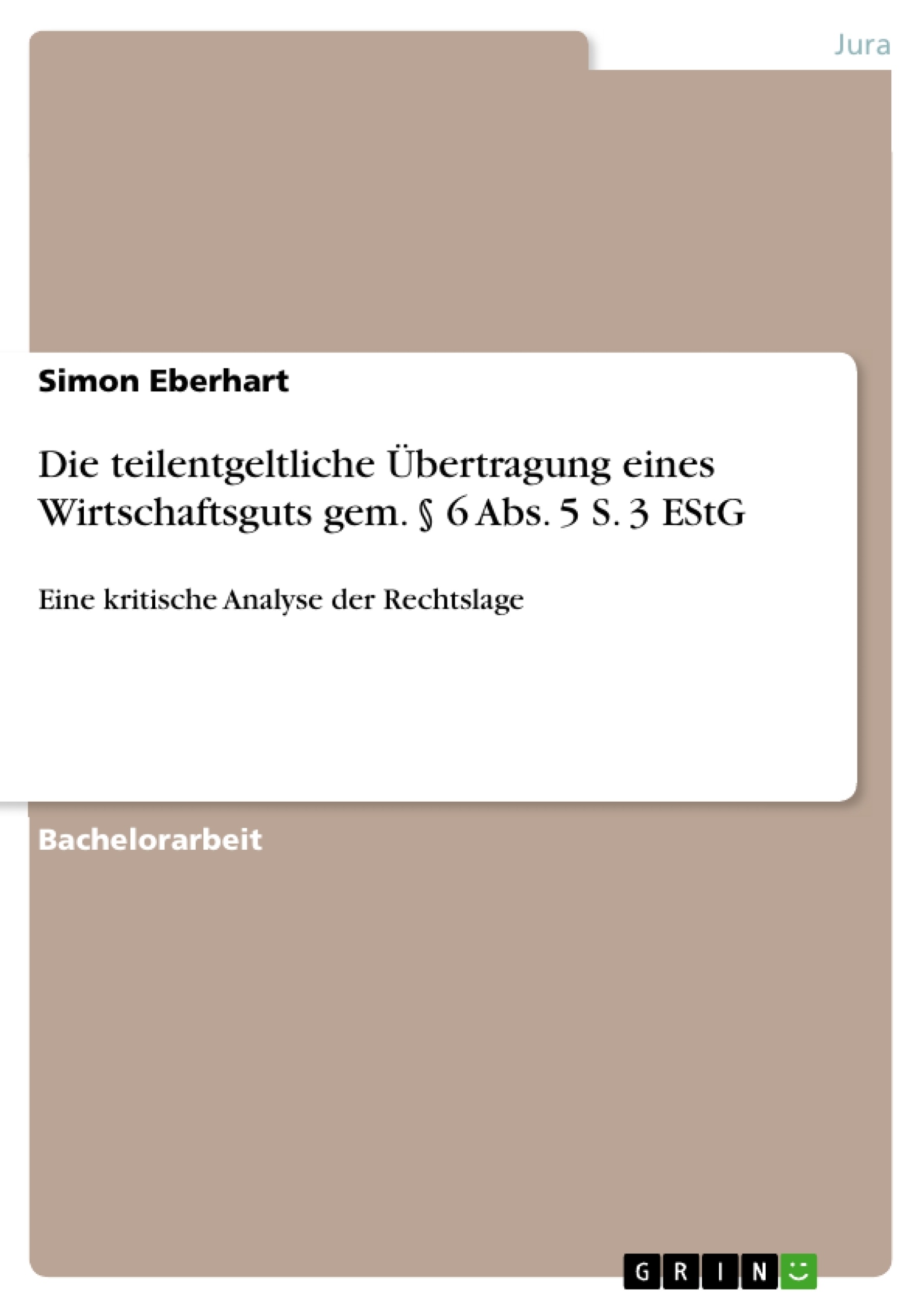Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Problematik der Bewertung teilentgeltlicher Übertragungen eines Einzelwirtschaftsguts im Rahmen des § 6 Abs. 5 S. 3 EStG.
Während die Finanzverwaltung die Auffassung vertritt, dass der BW nach dem Verhältnis des Entgelts zum Verkehrswert aufzuteilen ist, schlägt der IV. Senat des BFH in seinen Urteilen zur teilentgeltlichen Übertragung im Rahmen des § 6 Abs. 5 S. 3 EStG einen anderen Weg ein. Er ist der Ansicht, der BW sei vorrangig dem entgeltlichen Teil des Rechtsgeschäfts zuzuordnen, was den Grundsätzen der bei der Übertragung einer Sachgesamtheit angewandten Einheitstheorie entspricht. Mit seinen Urteilen weicht der IV. Senat nicht nur von der Rechtsauffassung der Finanzverwaltung, sondern auch von der Rechtsprechung des VIII. Senats ab, der bei einem vollentgeltlichen Mischentgelt die Aufteilung des BW im Sinne der Auffassung der Finanzverwaltung vorgenommen hatte.
Der erste Teil dieser Arbeit widmet sich der Darstellung der verschiedenen Lösungsansätze, die zur steuerlichen Behandlung teilentgeltlicher Übertragungen von Einzelwirtschaftsgütern im Rahmen des § 6 Abs. 5 S. 3 EStG vertreten werden. Dabei werden diese hinsichtlich den Auswirkungen beim Übertragenden anhand von Beispielen analysiert. Im zweiten Teil der Arbeit erfolgt eine Darstellung und kritische Untersuchung der genannten BFH-Rechtsprechung. Zuerst wird in Bezug auf das Urteil des VIII. Senats geprüft, ob es eine stichhaltige Rechtfertigung für die Rechtsauffassung der Finanzverwaltung darstellt. Im nächsten Schritt werden die korrespondierenden Urteile des IV. Senats betrachtet und bezüglich ihrer Reichweite sowie der vom IV. Senat angestellten Überlegungen untersucht. Ebenfalls wird erforscht, welche Theorie der IV. Senat konkret vertritt. Der dritte Teil dient der Vorstellung des Sachverhalts, der dem beim GrS des BFH anhängigen Verfahren zugrunde liegt sowie der Überprüfung, ob die Urteile des IV. Senats für dessen rechtliche Beurteilung einschlägig sind. Im Anschluss werden im vierten Teil die Argumente der Rechtsprechung und Literatur für und gegen die unterschiedlichen Theorien aufgezeigt und kritisch betrachtet. Abschließend soll unter Darstellung der eigenen Meinung eingeschätzt werden, welcher der Theorien der GrS des BFH folgen könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorstellung der Theorien
- Trennungstheorie
- Strenge Trennungstheorie
- Modifizierte Trennungstheorie
- Untersuchung der Auswirkungen beim Übertragenden
- Einheitstheorie
- Trennungstheorie
- Kritische Analyse der Rechtsprechung
- BFH-Urteil vom 11.12.2001, VIII R 58/98
- Sachverhalt und Entscheidung
- Übernahme einer Verbindlichkeit als Entgelt
- Rechtsgrundlage der strengen Trennungstheorie?
- Entwicklung der modifizierten Trennungstheorie durch den IV. Senat des BFH
- BFH-Urteil vom 21.06.2012, IV R 1/08
- Sachverhalt und Entscheidung
- Reichweite
- BFH-Urteil vom 19.09.2012, IV R 11/12
- Sachverhalt und Entscheidung
- Entnahmeproblematik
- Reichweite des Urteils
- Bestimmung der vom IV. Senat angewandten Theorie
- BFH-Urteil vom 21.06.2012, IV R 1/08
- Vorlagebeschluss an den Großen Senat des BFH vom 27.10.2015, X R 28/12
- BFH-Urteil vom 11.12.2001, VIII R 58/98
- Anwendung der Einheitstheorie
- Strenge oder modifizierte Trennungstheorie
- Ableitung aus Wortlaut und Zivilrecht/Schenkungsteuerrecht
- Argumente für die strenge Trennungstheorie
- Argumente für die modifizierte Trennungstheorie
- Behandlung beim Erwerber
- Abschließende Beurteilung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert kritisch die Rechtslage der teilentgeltlichen Übertragung eines Wirtschaftsguts gemäß § 6 Abs. 5 S. 3 EStG. Ziel ist es, die verschiedenen Theorien (Trennungstheorie und Einheitstheorie) zu untersuchen und ihre Anwendbarkeit auf konkrete Fälle zu bewerten.
- Analyse der Trennungstheorie (strenge und modifizierte Variante)
- Bewertung der Einheitstheorie
- Kritische Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH)
- Untersuchung der Auswirkungen auf Übertragenden und Erwerber
- Ableitung von Handlungsempfehlungen für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der teilentgeltlichen Übertragung von Wirtschaftsgütern gemäß § 6 Abs. 5 S. 3 EStG ein und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Sie beschreibt die Problematik der unterschiedlichen juristischen Auffassungen und die Notwendigkeit einer kritischen Analyse der Rechtslage.
Vorstellung der Theorien: Dieses Kapitel stellt die beiden zentralen Theorien zur Bewertung der teilentgeltlichen Übertragung vor: die Trennungstheorie (in ihren strengen und modifizierten Ausprägungen) und die Einheitstheorie. Es erläutert die jeweiligen Grundzüge, Argumentationslinien und praktischen Auswirkungen jeder Theorie auf die steuerliche Behandlung des Vorgangs. Die Unterschiede zwischen den Ansätzen werden herausgearbeitet, um den Leser auf die anschließende kritische Analyse vorzubereiten.
Kritische Analyse der Rechtsprechung: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Urteile des Bundesfinanzhofs (BFH), die sich mit der teilentgeltlichen Übertragung von Wirtschaftsgütern befassen. Es untersucht insbesondere die Entwicklung der Rechtsprechung vom BFH-Urteil vom 11.12.2001, VIII R 58/98, bis hin zu den späteren Entscheidungen des IV. Senats des BFH. Dabei wird der Fokus auf die unterschiedlichen Argumentationslinien und die jeweilige Anwendung der Trennungstheorie und Einheitstheorie gelegt, um die Unsicherheiten und Widersprüche in der Rechtsprechung aufzuzeigen.
Anwendung der Einheitstheorie: Dieses Kapitel befasst sich mit der praktischen Anwendung der Einheitstheorie im Kontext der teilentgeltlichen Übertragung von Wirtschaftsgütern. Es werden die Vor- und Nachteile dieser Theorie im Vergleich zur Trennungstheorie diskutiert, und es werden mögliche Fallkonstellationen beleuchtet, in denen die Einheitstheorie eine besondere Relevanz hat. Die Anwendung der Einheitstheorie wird detailliert erläutert, einschließlich der Behandlung stiller Reserven.
Strenge oder modifizierte Trennungstheorie: Dieses Kapitel vergleicht die strenge und die modifizierte Trennungstheorie und analysiert die jeweiligen Argumente für und gegen deren Anwendung im Kontext der teilentgeltlichen Übertragung von Wirtschaftsgütern. Der Fokus liegt auf der Ableitung aus Wortlaut und Zivilrecht/Schenkungsteuerrecht und auf der Behandlung beim Erwerber. Es wird eine umfassende Gegenüberstellung der beiden Theorien vorgenommen, um die jeweiligen Stärken und Schwächen zu beleuchten und die Frage nach der optimalen Anwendung zu beantworten.
Schlüsselwörter
Teilentgeltliche Übertragung, Wirtschaftsgut, § 6 Abs. 5 S. 3 EStG, Trennungstheorie, Einheitstheorie, Bundesfinanzhof (BFH), Rechtsprechung, Steuerrecht, stille Reserven, Bewertung, Zivilrecht, Schenkungsteuerrecht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Teilentgeltliche Übertragung von Wirtschaftsgütern gemäß § 6 Abs. 5 S. 3 EStG
Was ist der Gegenstand der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit analysiert die Rechtslage der teilentgeltlichen Übertragung von Wirtschaftsgütern gemäß § 6 Abs. 5 S. 3 EStG. Im Fokus stehen die Anwendung und der Vergleich der Trennungstheorie (strenge und modifizierte Variante) und der Einheitstheorie.
Welche Theorien werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Trennungstheorie (mit ihren Ausprägungen: strenge und modifizierte Trennungstheorie) und die Einheitstheorie. Die jeweiligen Grundzüge, Argumentationslinien und Auswirkungen auf die steuerliche Behandlung werden erläutert und verglichen.
Welche Rolle spielt die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH)?
Die Arbeit analysiert kritisch die Rechtsprechung des BFH zu diesem Thema. Es werden verschiedene Urteile, darunter das BFH-Urteil vom 11.12.2001, VIII R 58/98, und weitere Entscheidungen des IV. Senats, untersucht, um die Entwicklung der Rechtsprechung und die damit verbundenen Unsicherheiten aufzuzeigen.
Wie wird die Einheitstheorie angewendet?
Die Arbeit beleuchtet die praktische Anwendung der Einheitstheorie bei teilentgeltlichen Übertragungen. Vor- und Nachteile im Vergleich zur Trennungstheorie werden diskutiert, inklusive der Behandlung stiller Reserven und relevanter Fallkonstellationen.
Wie werden die strenge und die modifizierte Trennungstheorie verglichen?
Die Arbeit vergleicht die strenge und die modifizierte Trennungstheorie umfassend. Argumente für und gegen die Anwendung werden analysiert, mit Fokus auf die Ableitung aus Wortlaut und Zivil-/Schenkungsteuerrecht sowie der Behandlung beim Erwerber.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist die kritische Untersuchung der verschiedenen Theorien und deren Anwendbarkeit auf konkrete Fälle. Es sollen die Auswirkungen auf Übertragenden und Erwerber beleuchtet und Handlungsempfehlungen für die Praxis abgeleitet werden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Vorstellung der Theorien (Trennungs- und Einheitstheorie), kritischer Analyse der Rechtsprechung (mit Fokus auf BFH-Urteile), Anwendung der Einheitstheorie, Vergleich der strengen und modifizierten Trennungstheorie und abschließender Beurteilung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Teilentgeltliche Übertragung, Wirtschaftsgut, § 6 Abs. 5 S. 3 EStG, Trennungstheorie, Einheitstheorie, Bundesfinanzhof (BFH), Rechtsprechung, Steuerrecht, stille Reserven, Bewertung, Zivilrecht, Schenkungsteuerrecht.
- Arbeit zitieren
- Simon Eberhart (Autor:in), 2017, Die teilentgeltliche Übertragung eines Wirtschaftsguts gem. § 6 Abs. 5 S. 3 EStG, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429224