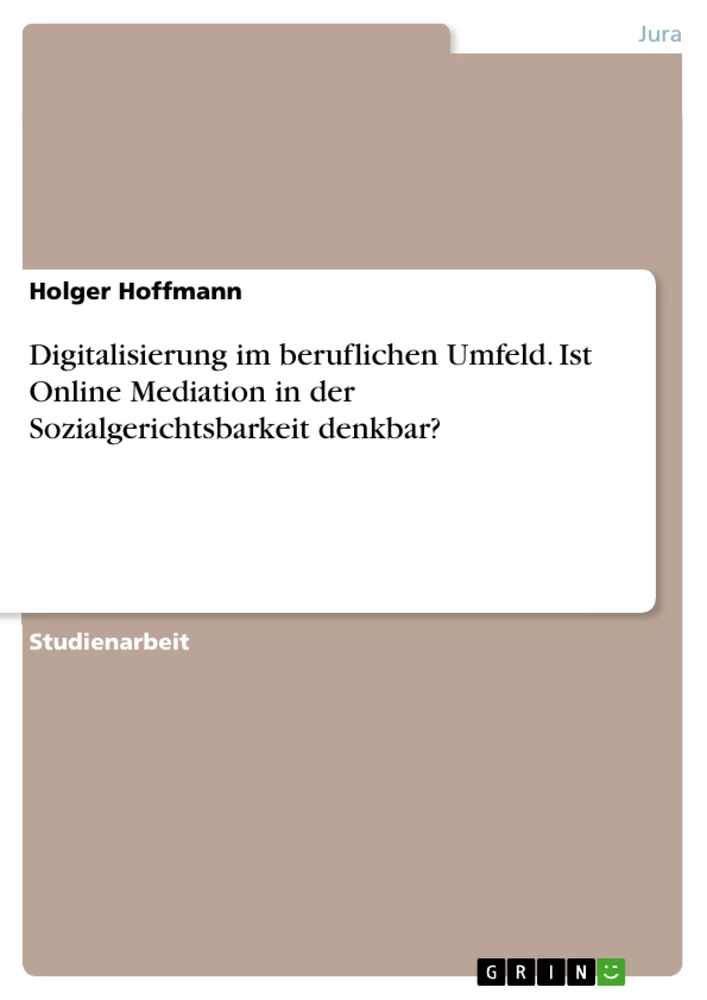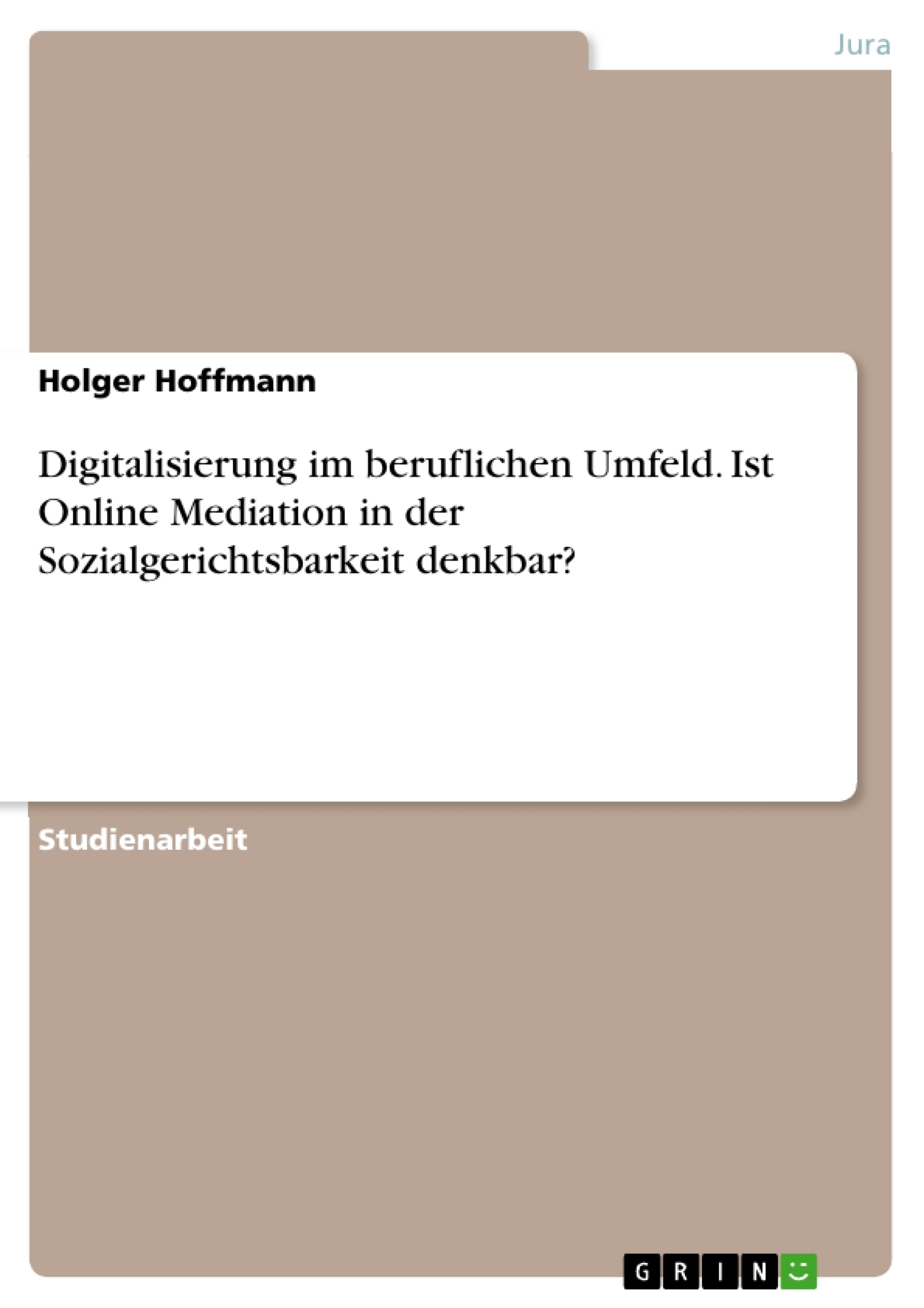Oft ist der Ausgang von Sozialgerichtsverfahren sowohl für den Kläger als auch für den Beklagten nicht zielführend. Die eigentliche Problematik kann aber im Rahmen einer Verhandlung nur selten gelöst werden. Win-win oder sogar kreative Lösungen sind hier in der Regel nicht möglich. Im Unterschied dazu erhalten die Beteiligten durch eine Mediation die Möglichkeit, ihren Konflikt selbstbestimmt, respektvoll und zielorientiert zu lösen.
Die Digitalisierung hält im privaten und beruflichen Umfeld, aber auch in der Justiz Einzug. Selbst Psychotherapien sind als Online-Therapien als wirksam anerkannt. Auch Ärzte bieten mittlerweile videobasierte Online-Sprechstunden an, und Krankenkassen offerieren Internetgeschäftsstellen. Durch die Fernkommunikation wird der Aufwand für Anreisen zu Präsenzveranstaltungen reduziert. Andererseits ändert die Kommunikation dadurch ihren Charakter. Selbst bei Videokonferenzen werden die Möglichkeiten zur Interaktion und zur Wahrnehmung des anderen sowie der persönliche Umgang verringert.
So gibt es Mediatoren, welche die Online-Mediation aufgrund der fehlenden Face-to-Face-Situation erst gar nicht als eine „echte“ Mediation anerkennen. Aus ihrer Sicht ist die direkte Kommunikation unverzichtbar und stellt die Hauptressource für die Konfliktbearbeitung dar. Das wechselseitige Verstehen der Positionen und Wünsche der Medianden könne nur im Rahmen einer Face-to-Face-Situation optimal und „unverfälscht“ erreicht werden.
In Nordamerika beispielsweise nutzen Mediatoren die neuen Medien aber schon seit Längerem als festes Gestaltungsmittel im Mediationsprozess. Sie fordern die Konfliktparteien situativ während des Mediationsprozesses dazu auf, auch in virtuellen Räumen zu interagieren und Chat- und Diskussionsforen, Dateiablagen, Umfragesoftwares oder eine Software zu nutzen, welche bei der Bewertung von Entscheidungsoptionen hilft. Und man kann sagen, dass in gewisser Weise auch schon die Verhandlungen von Alvise Contarini zum Westfälischen Frieden durch Fernkommunikation, also ohne eine Face-to-Face-Kommunikation, erfolgreich zu Ende geführt wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Teil A
- I. Einleitung
- 1. Ausgangsüberlegungen
- 2. Zielsetzung/Forschungsfragen
- 3. Methodik und Aufbau
- II. Einführung in das Sozialrecht/Sozialgerichtsverfahren
- 1. Ziele und Aufgaben des Sozialrechts
- 2. Besetzung und Aufbau der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit
- 3. Charakteristika des Sozialgerichtsverfahrens
- 4. Charakteristika des Mediationsverfahrens/Güterichterverfahrens
- III. Einführung in die Mediation
- 1. Was ist unter einer Mediation zu verstehen?
- 2. Ablauf und Phasen einer Mediation
- 3. Möglichkeiten des Verhandelns einer Behörde in der Mediation
- 4. Das Harvard-Konzept
- IV. Aktuelle Situation der außergerichtlichen, gerichtsnahen und gerichtsinternen Mediation bei Konflikten um Sozialleistungen
- 1. Außergerichtliche Mediation mit der Zielsetzung der Vermeidung einer Anrufung des Gerichts
- 2. Gerichtsnahe Mediation
- 3. Gerichtsinterne Mediation
- 4. Mögliche Hemmnisse für die Inanspruchnahme von Güterichtermediationen
- 5. ,,Richtiger“ Zeitpunkt für eine Mediation
- Teil B
- V. Online-Mediation
- 1. Definition der Online-Mediation
- 2. Historischer Rückblick
- 3. Rechtliche Grundlagen
- 4. Umfeld der Online-Mediation
- 5. Vor- und Nachteile von Online-Mediationen
- 6. Welche Anforderungen werden an einen Online-Mediator gestellt?
- VI. Theorien der computervermittelten Kommunikation
- 1. Grundlagen der Kommunikation
- 2. Kommunikation unter Einbeziehung weiterer Medien
- 3. Passung von Medium und Kommunikationsaufgabe
- 4. Auswirkungen einzelner Charakteristika der CvK
- 5. Sozialdatenschutz
- Teil C
- 1. Implementierung des Medien- und Methodeneinsatzes einer Online-Mediation in das traditionelle Phasenmodell einer Präsenzmediation
- 2. Praxisbeispiele
- Teil D
- Diskussion der Gesamtergebnisse, Gesamtfazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Online-Mediation in der Sozialgerichtsbarkeit denkbar ist. Sie analysiert die verschiedenen Facetten der Online-Mediation, beleuchtet die rechtlichen Grundlagen und untersucht die Vor- und Nachteile dieses Verfahrens.
- Einführung in die Online-Mediation und ihre Bedeutung im Kontext des Sozialrechts
- Analyse der aktuellen Forschungslandschaft und der rechtlichen Rahmenbedingungen
- Bewertung der Vor- und Nachteile der Online-Mediation im Vergleich zu traditionellen Mediationsformen
- Untersuchung der Eignung von Online-Mediation für die Konfliktlösung im Sozialgerichtsverfahren
- Implementierung von Online-Mediation in das traditionelle Phasenmodell der Präsenzmediation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert. Teil A bietet eine Einleitung in das Thema und führt in die Grundlagen des Sozialrechts, der Sozialgerichtsbarkeit und der Mediation ein. In Teil B wird die Online-Mediation definiert, ihre Historie beleuchtet und rechtliche Grundlagen sowie Vor- und Nachteile erörtert. Teil C befasst sich mit der Implementierung von Online-Mediation in das klassische Phasenmodell der Präsenzmediation und präsentiert Praxisbeispiele.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Online-Mediation, Sozialgerichtsbarkeit, Sozialrecht, Konfliktlösung, Digitalisierung, computervermittelte Kommunikation, Medienökologie und Rechtliche Rahmenbedingungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Online-Mediation?
Es ist ein Mediationsverfahren, das mithilfe digitaler Kommunikationsmittel wie Videokonferenzen, Chats oder spezieller Software durchgeführt wird.
Kann Online-Mediation in der Sozialgerichtsbarkeit funktionieren?
Die Arbeit untersucht diese Möglichkeit und zeigt auf, dass sie trotz fehlender Face-to-Face-Situation eine effiziente Alternative für bestimmte Konflikte sein kann.
Was sind die Vorteile von Online-Mediation?
Zu den Vorteilen zählen die Zeit- und Kostenersparnis durch den Wegfall von Anreisen sowie eine oft sachlichere Kommunikation in virtuellen Räumen.
Welche Nachteile gibt es bei der Online-Mediation?
Kritisiert wird oft die eingeschränkte Wahrnehmung non-verbaler Signale und die Schwierigkeit, eine vertrauensvolle Basis ohne physische Präsenz aufzubauen.
Was ist das Harvard-Konzept?
Das Harvard-Konzept ist eine Methode des sachbezogenen Verhandelns, die darauf abzielt, Win-Win-Lösungen durch die Trennung von Mensch und Problem zu finden.
- Quote paper
- Holger Hoffmann (Author), 2018, Digitalisierung im beruflichen Umfeld. Ist Online Mediation in der Sozialgerichtsbarkeit denkbar?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429386