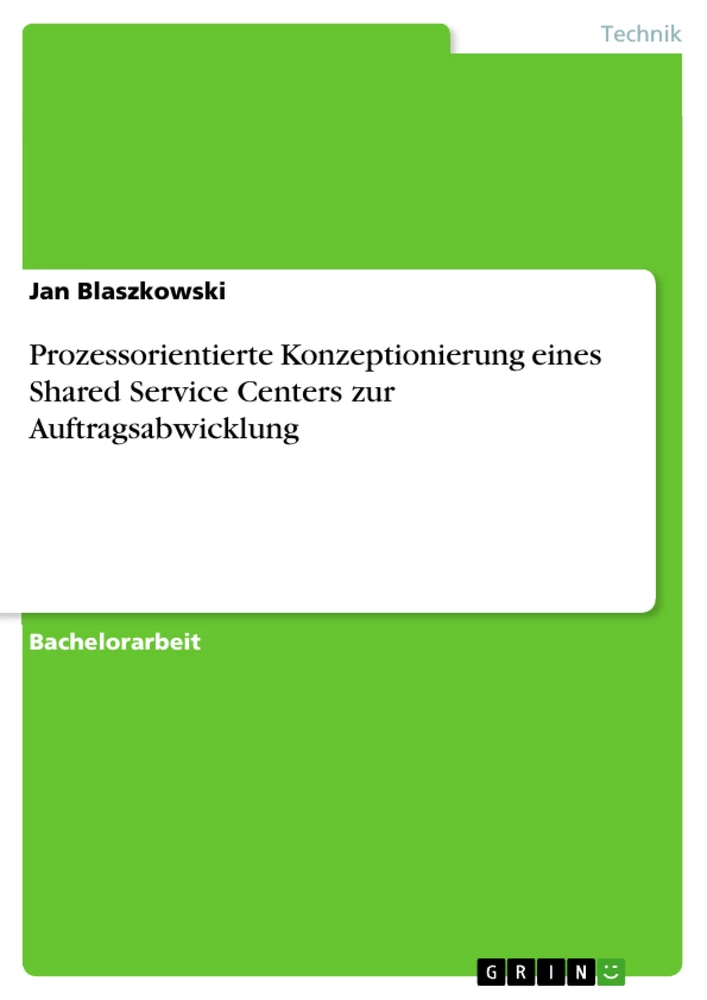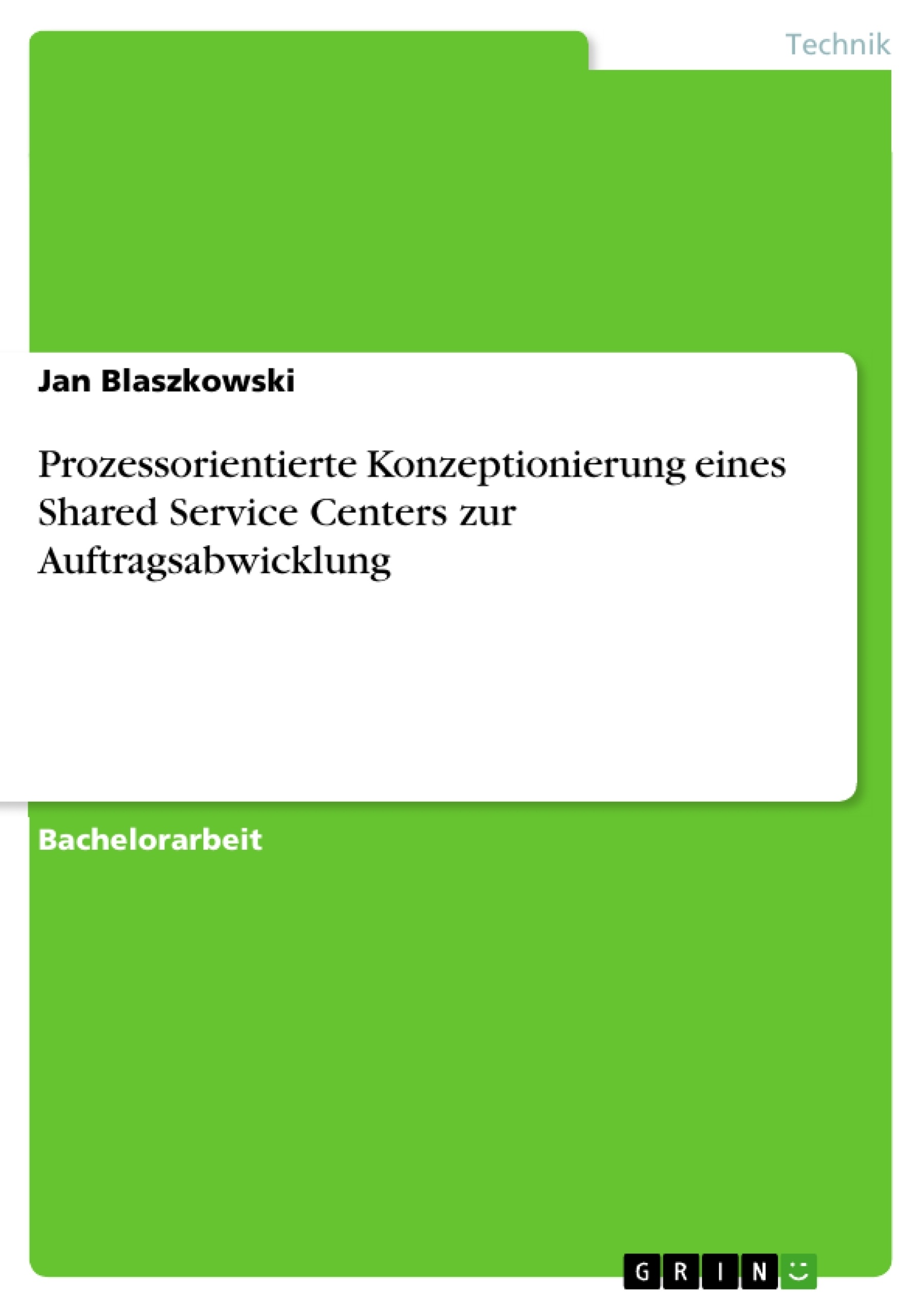Schlagworte wie Gewinnmaximierung, Kostenreduzierung und Umstrukturierung dominieren seit Jahren unseren Arbeitsalltag. Viele Unternehmen stehen unter einem enormen Wettbewerbsdruck. Ergebnis sind Rationalisierungs- und Optimierungsmaßnahmen, in denen sämtliche Prozesse, Organisationsstrukturen und Produkte auf den Prüfstand gestellt werden. Als Auslöser dieses Wettbewerbsdrucks ist die zunehmende Globalisierung der Märkte nennen, welche zunächst international und mittlerweile auch national agierende Unternehmen erreicht. Um weiterhin am Markt bestehen und dem Wettbewerbsdruck standhalten zu können, versuchen Unternehmen durch Unternehmensreorganisation und der Konzentration auf Kernkompetenzen Kosten zu senken.
Ziel ist eine Effizienz- und Effektivitätssteigerung in den Supportprozessen zu erreichen. Das Shared Service Konzept setzt an diesem Punkt an. Es werden Prozesse, die aufgrund der Organisationsstruktur des Unternehmens oder vorangegangener Dezentralisierung mehrfach ausgeführt werden, standardisiert und anschließend zentralisiert. Ein weiterer Punkt für den Unternehmenserfolg ist die Fähigkeit, sich organisatorisch neuen Marktbedingungen und -anforderungen anzupassen. Damit ein Unternehmen eine solche Flexibilität aufweisen kann, muss es seine Strukturen und Prozesse kennen. Aus diesem Grund werden Unternehmen aus der prozessorientierten Sichtweise betrachtet. Um Unternehmensabläufe zu visualisieren, werden diese in Geschäftsprozessmodellen dargestellt. Diese stellen eine abstrahierte Abbildung der realen Prozesse mit allen Strukturen und Eigenschaften dar. Die Darstellung der Prozesse kann mit Hilfe unterschiedlicher Modellierungsmethode realisiert werden. Anhand der Möglichkeiten und Grenzen der einzelnen Modellierungsmethode ist die Auswahl zu treffen, welche Methode die betreffenden Prozesse im Unternehmen am vollumfänglichsten in einem Modell darstellen kann.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Darstellung mehrerer ausgewählter Modellierungsmethode. Es werden die einzelnen Methoden strukturiert beschrieben und deren Vor- und Nachteile sowie Grenzen und Möglichkeiten herausgearbeitet. Letztendlich erfolgt die Auswahl einer geeigneten Methode zur weiteren Verwendung im praktischen Teil dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung und Zielsetzung
- Shared Service Center als alternative Organisationsform
- Abgrenzung zu anderen Konzepten
- Unterschiede zwischen Shared Service und Outsourcing
- Unterschiede zwischen Shared Service und Zentralisierung
- Ziele eines Shared Service Centers
- Methodik zur Auswahl geeigneter Prozesse
- Geschäftsprozessmodellierung
- Begrifflichkeiten zur Geschäftsprozessmodellierung
- Methoden der Modellierung
- Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK)
- Business Process Modelling and Notation 2.0 (BPMN 2.0)
- Auswahl der geeigneten Methode
- Ausarbeitung des prozessorientierten Konzepts zur Auftragsabwicklung
- Aktuelle Situation und Struktur der Fa. Tepper
- Darstellung des Ist-Prozesses in der Mikroebene
- Auftragsabwicklung im Geschäftsbereich Neubau
- Auftragsabwicklung im Geschäftsbereich Umbau
- Auswahl der geeigneten Prozesse
- Ausarbeitung des Soll-Gesamtprozesses
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der prozessorientierten Konzeptionierung eines Shared Service Centers am Beispiel der Auftragsabwicklung der Fa. Tepper Aufzüge GmbH. Ziel ist es, die Vorteile eines Shared Service Centers für die Auftragsabwicklung aufzuzeigen und ein Konzept für die Implementierung eines solchen Centers zu entwickeln.
- Analyse der aktuellen Prozesse in der Fa. Tepper Aufzüge GmbH
- Definition der Ziele und Anforderungen an ein Shared Service Center
- Auswahl geeigneter Methoden zur Prozessmodellierung
- Entwicklung eines Soll-Konzepts für ein Shared Service Center in der Auftragsabwicklung
- Bewertung der Ergebnisse und Ableitung von Handlungsempfehlungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit. Es werden die Herausforderungen der Fa. Tepper Aufzüge GmbH im Bereich der Auftragsabwicklung dargestellt und die Notwendigkeit eines Shared Service Centers begründet.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Shared Service Center als alternative Organisationsform. Es werden die Vor- und Nachteile eines Shared Service Centers im Vergleich zu anderen Organisationsformen wie Outsourcing und Zentralisierung aufgezeigt. Zudem werden die Ziele und Vorteile eines Shared Service Centers erläutert.
In Kapitel 3 wird auf die Methodik zur Auswahl geeigneter Prozesse für das Shared Service Center eingegangen. Es werden verschiedene Methoden zur Prozessmodellierung vorgestellt und die für die Arbeit geeignete Methode ausgewählt.
Kapitel 4 befasst sich mit der Ausarbeitung des prozessorientierten Konzepts zur Auftragsabwicklung. Die aktuelle Situation und Struktur der Fa. Tepper Aufzüge GmbH wird dargestellt und der Ist-Prozess der Auftragsabwicklung im Detail analysiert. Anschließend werden die für das Shared Service Center geeigneten Prozesse ausgewählt und ein Soll-Gesamtprozess für die Auftragsabwicklung entwickelt.
Schlüsselwörter
Shared Service Center, Prozessmodellierung, Auftragsabwicklung, Fa. Tepper Aufzüge GmbH, Geschäftsprozessoptimierung, BPMN 2.0, EPK, Ist-Soll-Analyse, Prozesslandkarte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Shared Service Center (SSC)?
Ein SSC ist eine Organisationseinheit, die unterstützende Prozesse (wie die Auftragsabwicklung), die zuvor dezentral in verschiedenen Abteilungen ausgeführt wurden, zentralisiert und standardisiert.
Was ist der Unterschied zwischen SSC und Outsourcing?
Beim SSC bleiben die Prozesse innerhalb des Unternehmensverbundes, während sie beim Outsourcing an einen externen Dienstleister vergeben werden.
Was bedeutet prozessorientierte Sichtweise?
Das Unternehmen wird nicht nach Abteilungen, sondern nach seinen Abläufen (Geschäftsprozessen) betrachtet, um Schnittstellen zu minimieren und die Effizienz zu steigern.
Was ist BPMN 2.0?
BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) ist ein internationaler Standard zur grafischen Darstellung von Geschäftsprozessen, der sowohl für Fachabteilungen als auch für die IT verständlich ist.
Warum ist eine Ist-Soll-Analyse wichtig?
Sie hilft dabei, Schwachstellen in den aktuellen Abläufen zu identifizieren und ein optimiertes Ziel-Konzept für das neue Shared Service Center zu entwickeln.
- Citar trabajo
- Jan Blaszkowski (Autor), 2018, Prozessorientierte Konzeptionierung eines Shared Service Centers zur Auftragsabwicklung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429494