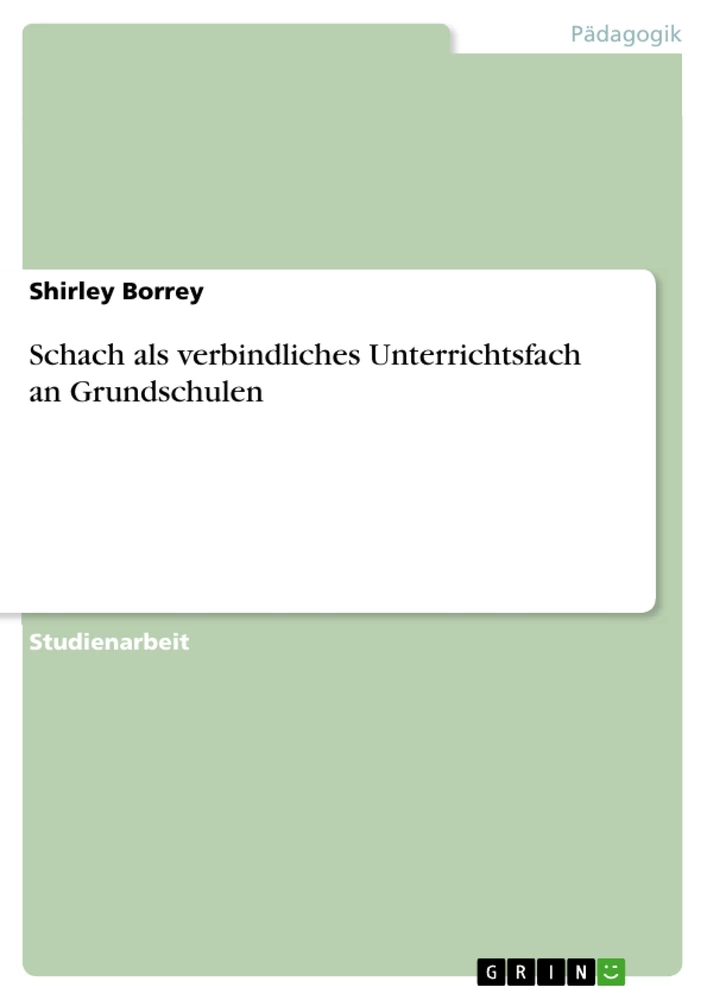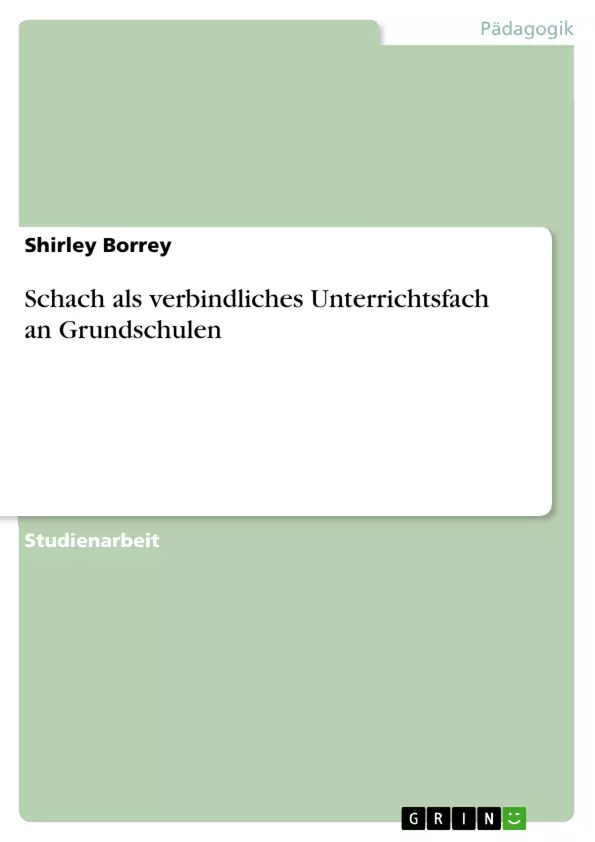Aufgabe dieser Arbeit ist es, eine Forschungsmethode der empirischen Bildungsforschung auf ein selbstgewähltes Forschungsgebiet anzuwenden und zu erläutern.
Nachdem die Hintergründe des Forschungsthemas dargelegt werden, befasst sich die Autorin mit der Methodik, also mit der Entwicklung der Forschungsfrage und der Hypo-thesen sowie der Auswahl der Methodik. Hier werden die qualitative Sozialforschung, die Grounded Theory und die Technik des Leitfadeninterviews aufgezeigt.
Die Anwendung der Grounded Theory erfolgt mit der Erhebung der Daten, die alsdann ausgewertet und dargestellt werden. Es soll gezeigt werden, wie die Autorin ihre Forschungsarbeit umzusetzen vermag. Die gewonnenen Erfahrungen werden reflektiert und mögliche Aussichten werden präsentiert.
Das hier gewählte Forschungsthema ist der verbindliche Schachunterricht an Grundschulen. Die Idee dazu entstand, als eine Grundschule in NRW 2008 den Schachunterricht innerhalb des Förderprogramms verbindlich für alle Schüler etablierte. 2007 wurde diese schachbegeisterte Schule auf eine Studie der Universität Trier aufmerksam, die sich mit den „positive Auswirkungen auf die (insbesondere kognitive) Entwicklung der Schülerinnen und Schüler der ersten vier Klassenstufen“ (Filipp & Spieles, 2007) befasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsthema
- Methodik
- Entwicklung der Forschungsfrage
- Entwicklung der Hypothesen
- Auswahl der Forschungsmethode
- Qualitative Sozialforschung
- Grounded Theory
- Leitfadeninterview
- Erhebung der Daten
- Exploration
- Interviews
- Auswertung der Daten
- Darstellung der Ergebnisse
- Fazit und Ausblick
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, eine Forschungsmethode der empirischen Bildungsforschung auf ein selbstgewähltes Forschungsgebiet anzuwenden und zu erläutern. Die Autorin untersucht die Einstellung von Eltern zum verbindlichen Schachunterricht an Grundschulen, insbesondere in Hinblick auf deren mögliche Überforderung der Kinder, die Rolle der eigenen Schachkenntnisse und die Art der Information zum Thema.
- Einfluss des Schachunterrichts auf die Einstellung der Eltern bezüglich einer möglichen Überforderung der Kinder
- Bedeutung der Schachkenntnisse der Eltern für ihre Einstellung zum Schachunterricht
- Rolle der Informationsvermittlung zum Schachunterricht für die Elternbefürwortung
- Bedeutung der VERA-Vergleichsarbeiten für die Einstellung der Eltern zum Schachunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird das Forschungsthema des verbindlichen Schachunterrichts an Grundschulen eingeführt und die Entstehungsgeschichte beleuchtet. Kapitel zwei widmet sich der Methodik, einschließlich der Entwicklung der Forschungsfrage und der Hypothesen sowie der Auswahl der qualitativen Forschungsmethode, insbesondere der Grounded Theory und der Leitfadeninterviews. Kapitel drei beschreibt die Datenerhebung, die sich auf Exploration und Leitfadeninterviews fokussiert. Kapitel vier behandelt die Auswertung der gewonnenen Daten, während Kapitel fünf die Ergebnisse der Forschungsarbeit darstellt. Kapitel sechs beinhaltet das Fazit und den Ausblick auf zukünftige Forschungsansätze.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema des verbindlichen Schachunterrichts an Grundschulen und fokussiert auf die Einstellungen der Eltern. Im Zentrum stehen dabei die empirische Bildungsforschung, qualitative Sozialforschung, Grounded Theory, Leitfadeninterviews und VERA-Vergleichsarbeiten. Der Einfluss des Schachunterrichts auf die Schülerkompetenzen, die Rolle der Eltern und die Art der Informationsvermittlung zum Thema werden als zentrale Aspekte der Forschung betrachtet.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Schach als verbindliches Unterrichtsfach an Grundschulen untersucht?
Anlass war eine Schule in NRW, die Schach verbindlich einführte, basierend auf Studien, die positive Auswirkungen auf die kognitive Entwicklung von Kindern belegen.
Wie stehen Eltern zum verpflichtenden Schachunterricht?
Die Arbeit untersucht mittels Leitfadeninterviews die Einstellungen der Eltern, insbesondere ob sie eine Überforderung ihrer Kinder befürchten oder das Fach als Bereicherung sehen.
Welche Forschungsmethode wurde in der Arbeit angewandt?
Es wurde die Qualitative Sozialforschung genutzt, speziell die Grounded Theory in Kombination mit der Technik des Leitfadeninterviews.
Spielen die eigenen Schachkenntnisse der Eltern eine Rolle für ihre Einstellung?
Ja, die Arbeit analysiert, inwieweit das Vorwissen der Eltern ihre Befürwortung oder Skepsis gegenüber dem Schachunterricht beeinflusst.
Was haben VERA-Vergleichsarbeiten mit dem Schachunterricht zu tun?
Die Untersuchung prüft, ob Eltern einen Zusammenhang zwischen dem Schachunterricht und den Leistungen ihrer Kinder in standardisierten Vergleichsarbeiten wie VERA wahrnehmen.
- Quote paper
- Shirley Borrey (Author), 2010, Schach als verbindliches Unterrichtsfach an Grundschulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/430722