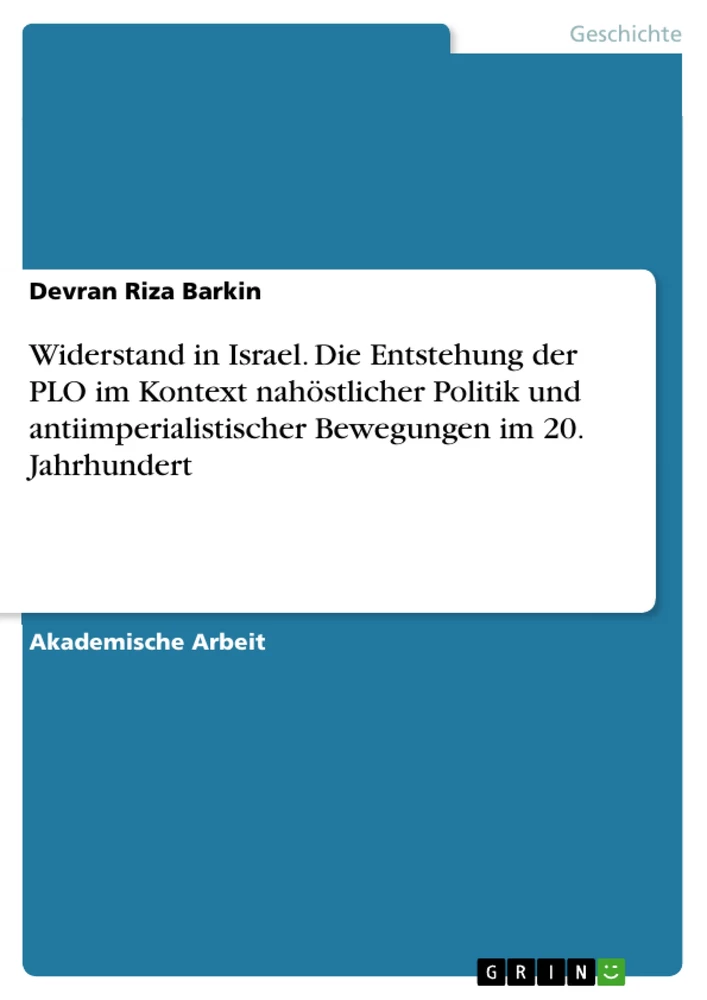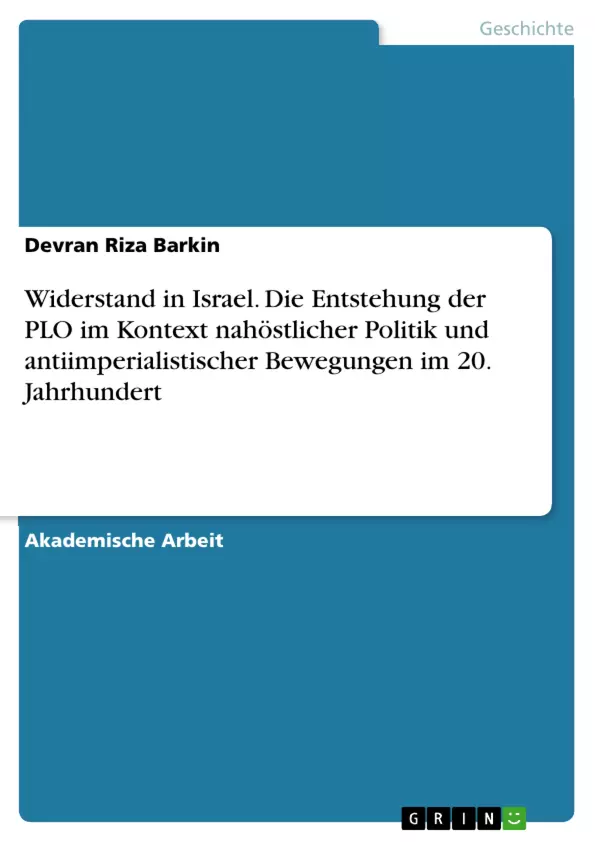Der palästinensisch-israelische Konflikt steht seit geraumer Zeit im Fokus der Weltöffentlichkeit, bestimmt außenpolitisches Verhalten führender Nationen, Wahlkämpfe in verschiedenen Staaten, gesellschaftliche Umbrüche, internationale Protestbewegungen. Der Konflikt hat eine so große Ausstrahlungskraft, dass er mitunter als Nahostkonflikt beschrieben wird, obwohl dieser nur einen kleinen Teil des nahöstlichen Raumes betrifft und andere Konflikte, zumindest medial, in den Hintergrund stellt. Eine einschneidende Entwicklung im sogenannten Nahost-konflikt war hierbei die Formierung des palästinensischen Widerstandes gegen die israelische Obrigkeit durch die Gründung der Palestine Liberation Organisation, kurz PLO, im Jahr 1964. Die bis heute bestehende Organisierung des palästinensischen Volkes innerhalb dieser Organisation hatte in ihrer Gründungszeit Mitte der Sechziger Jahre diverse politische, ideologische, militärische und historische Entwicklungen manifestiert. Anhand ihrer Gründung lassen sich die damaligen Konflikte und Kämpfe regional, als auch global, herauslesen.
Welche Tendenzen lassen sich hierbei aus der Gründung der PLO für diese Zeit ableiten? Wie bildete sich die Entwicklung des palästinensischen Widerstandes gegen Israel innerhalb der regionalen Gegebenheiten bis zur Gründung der PLO ab? Wie kam es zum Entschluss, dem palästinensischem Volk diese Organisations-plattform zu schaffen? Welcher war der historische und politische Überbau, auf dem die Gründung der PLO fußt? Diesen Fragen will diese Arbeit nachgehen.
Hierbei werden zunächst die historischen Gegebenheiten zu Beginn des 20. Jahr-hunderts skizziert und auf die gesellschaftlichen Umbrüche in Nahost eingegangen. Anschließend folgt ein kurzer Abriss der ideologischen und politischen Überlegungen, die aus diesem gesellschaftlichen Wandel entsprungen sind und Theoretiker als auch Politiker in ihrem Handeln zu dieser Zeit beeinflussten. Abschließend werden die politischen Entwicklungen im Bezug auf die Region Nahost als auch globale Ereignisse erläutert, die schließlich zur Gründung der PLO führten.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Grundzüge des Antiimperialismus nach dem Ersten Weltkrieg
- Umbruch im Nahen Osten
- Geburt des panarabischen Nationalismus
- Die Baath-Partei
- Al-Nakba: Das arabische Trauma
- Der Nahe Osten im Kontext des Kalten Krieges
- Stunde Null der Palästinensischen Befreiungsorganisation
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Entstehung der PLO (Palestine Liberation Organisation) im Kontext der nahöstlichen Politik und antiimperialistischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts. Sie untersucht die historischen und politischen Hintergründe der Gründung der PLO und analysiert die Einflüsse, die zu ihrer Bildung führten.
- Antiimperialismus im Nahen Osten
- Panarabischer Nationalismus
- Der palästinensische Widerstand gegen die israelische Obrigkeit
- Die Rolle des Kalten Krieges
- Die historischen und politischen Bedingungen für die Gründung der PLO
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Das Kapitel beleuchtet die Relevanz des palästinensisch-israelischen Konflikts und die Bedeutung der PLO in diesem Zusammenhang.
- Grundzüge des Anti-Imperialismus nach dem Ersten Weltkrieg: Dieses Kapitel betrachtet die Entstehung des Anti-Imperialismus nach dem Ersten Weltkrieg, die Rolle von Lenin und der kommunistischen Internationale, sowie die amerikanischen Ambitionen im Zusammenhang mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker.
- Umbruch im Nahen Osten: Dieses Kapitel befasst sich mit den gesellschaftlichen Umbrüchen im Nahen Osten nach dem Ersten Weltkrieg und den Auswirkungen des Anti-Imperialismus auf die Region.
- Geburt des panarabischen Nationalismus: Dieses Kapitel analysiert die Entstehung des panarabischen Nationalismus und seine Bedeutung für die arabische Welt.
- Die Baath-Partei: Dieses Kapitel untersucht die Entstehung und Ideologie der Baath-Partei und ihre Rolle im Nahen Osten.
- Al-Nakba: Das arabische Trauma: Dieses Kapitel beschreibt die arabische Flucht und Vertreibung nach der Gründung Israels, die als „Al-Nakba“ bezeichnet wird.
- Der Nahe Osten im Kontext des Kalten Krieges: Dieses Kapitel analysiert den Einfluss des Kalten Krieges auf den Nahen Osten und die politischen Entwicklungen in der Region.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Antiimperialismus, panarabischer Nationalismus, palästinensischer Widerstand, Kalter Krieg, PLO, Nahostkonflikt und Al-Nakba.
Häufig gestellte Fragen
Wann und warum wurde die PLO gegründet?
Die Palestine Liberation Organisation (PLO) wurde 1964 gegründet, um dem palästinensischen Volk eine politische und militärische Plattform für den Widerstand gegen die israelische Herrschaft zu geben.
Was bedeutet der Begriff „Al-Nakba“?
„Al-Nakba“ (die Katastrophe) bezeichnet die Flucht und Vertreibung von Hunderttausenden Palästinensern im Zuge der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948.
Welche Rolle spielte der panarabische Nationalismus?
Der panarabische Nationalismus war ein zentraler ideologischer Überbau, der die arabischen Staaten einigte und die Gründung der PLO als Teil eines größeren regionalen Befreiungskampfes beeinflusste.
Wie beeinflusste der Kalte Krieg den Nahostkonflikt?
Der Nahe Osten wurde zum Schauplatz globaler Interessen von USA und Sowjetunion, was die lokalen Konflikte und die Bewaffnung der verschiedenen Akteure maßgeblich prägte.
Was war die Bedeutung der Baath-Partei für die PLO-Gründung?
Die Baath-Partei förderte antiimperialistische und nationalistische Ideen in der Region, die den Boden für die Organisierung des palästinensischen Widerstands bereiteten.
- Quote paper
- Devran Riza Barkin (Author), 2018, Widerstand in Israel. Die Entstehung der PLO im Kontext nahöstlicher Politik und antiimperialistischer Bewegungen im 20. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/432572