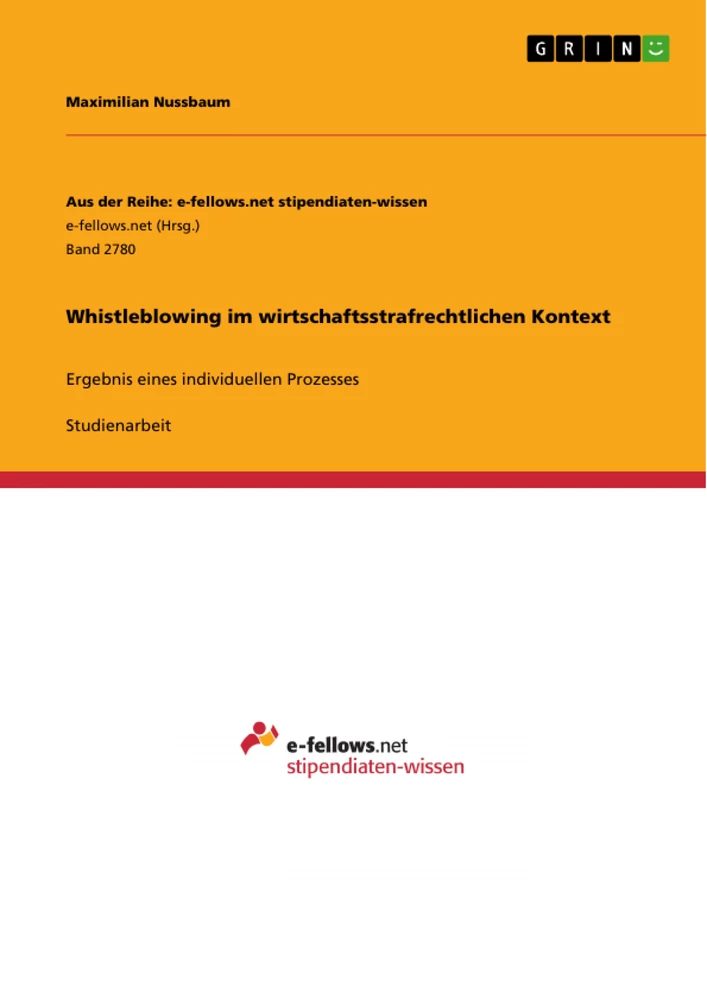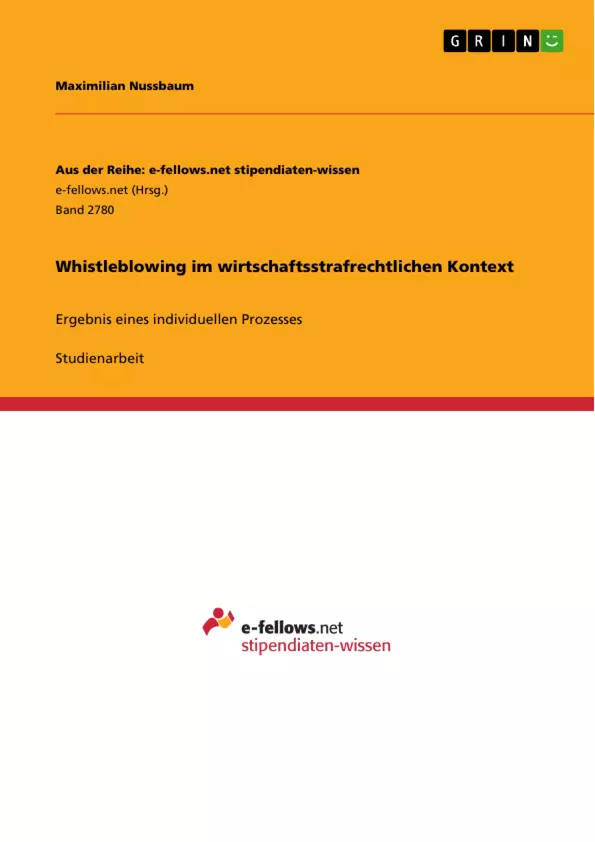Um dem Phänomen des Whistleblowings auf den Grund zu gehen und zu verstehen, wie es zur Entscheidung zum Hinweisgeben kommt, soll sich diese Arbeit in fünf Abschnitte gliedern. Zunächst sollen wesentliche Begriffsbestimmungen, Kategorisierungen und kriminalpolitische Ziele des Whistleblowings dargestellt werden (unter B.). Sodann soll ein kurzer Überblick über die rechtliche Situation (unter C.) und eine quantitative Abfrage der Verbreitung und der Wirksamkeit von Hinweisgebersystemen (unter D.) folgen. Auf dieser Grundlage soll zuletzt in qualitativer Hinsicht ein ausführliches Prozessmodell (unter E.) mit seinen Konsequenzen für die kriminalpolitische Debatte (unter F.) dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
-
- A. Einleitung
- B. Whistleblowing als rechtspolitisches Instrument
- I. Begriffsbestimmung
- II. Kategorisierung von Whistleblowing
- Internes Whistleblowing
- Externes Whistleblowing
- C. Exkurs: Ineffizienz der Doppelstrategie
- D. Rechtliche Situation
- E. Whistleblowing im Verlaufsmodell
- Objektiver Verlauf
- Subjektiver Verlauf
- F. Zusammenfassung und kriminalpolitische Konsequenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Whistleblowing im wirtschaftsstrafrechtlichen Kontext und analysiert, ob dieses Phänomen als Ergebnis eines individuellen Prozesses betrachtet werden kann.
- Die Bedeutung von Whistleblowing als rechtspolitisches Instrument
- Die verschiedenen Formen von Whistleblowing (intern und extern)
- Die rechtliche Situation und die Wirksamkeit von Whistleblowing-Systemen
- Die individuellen Prozesse, die zu Whistleblowing führen
- Kriminalpolitische Konsequenzen und Handlungsempfehlungen
Zusammenfassung der Kapitel
-
Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel führt in das Thema Whistleblowing ein und definiert den Begriff im Kontext des Wirtschaftsstrafrechts. Es werden die verschiedenen Formen von Whistleblowing, sowohl intern als auch extern, vorgestellt und die relevanten rechtspolitischen Aspekte beleuchtet.
-
Kapitel 2: Whistleblowing als rechtspolitisches Instrument
Dieses Kapitel analysiert Whistleblowing als ein Instrument der Rechtspolitik, das sowohl staatliche als auch unternehmerische Interessen schützen kann. Es werden die verschiedenen Perspektiven auf Whistleblowing aus rechtlicher und politischer Sicht beleuchtet.
-
Kapitel 3: Exkurs: Ineffizienz der Doppelstrategie
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Ineffizienz von Doppelstrategien, die sowohl interne als auch externe Whistleblowing-Kanäle umfassen. Es werden die potenziellen Nachteile dieser Vorgehensweise dargestellt.
-
Kapitel 4: Rechtliche Situation
Dieses Kapitel beleuchtet die aktuelle rechtliche Situation von Whistleblowing in Deutschland. Es werden die relevanten Gesetze und Verordnungen vorgestellt und deren Auswirkungen auf Whistleblowing analysiert.
-
Kapitel 5: Whistleblowing im Verlaufsmodell
Dieses Kapitel analysiert Whistleblowing als einen Prozess, der sowohl objektive als auch subjektive Elemente umfasst. Es werden die verschiedenen Phasen des Whistleblowing-Prozesses dargestellt und die entscheidenden Faktoren für die Entscheidung eines Whistleblowers beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen Whistleblowing, Wirtschaftsstrafrecht, Compliance, interne und externe Meldesysteme, rechtliche Situation, Verlaufsmodell, individuelle Prozesse, kriminalpolitische Konsequenzen und Handlungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Whistleblowing im wirtschaftsstrafrechtlichen Kontext?
Whistleblowing bezeichnet das Melden von Missständen oder Straftaten innerhalb eines Unternehmens, um rechtspolitische Ziele wie Korruptionsprävention zu unterstützen.
Was ist der Unterschied zwischen internem und externem Whistleblowing?
Internes Whistleblowing erfolgt innerhalb der Organisation (z. B. an eine Compliance-Stelle), während externes Whistleblowing die Information an Behörden oder die Öffentlichkeit weitergibt.
Warum wird die „Doppelstrategie“ in der Arbeit als ineffizient kritisiert?
Die Arbeit beleuchtet potenzielle Nachteile von Systemen, die gleichzeitig interne und externe Meldekanäle fördern, ohne klare Priorisierungen oder Schutzmechanismen.
Wie sieht die aktuelle rechtliche Situation in Deutschland aus?
Die Arbeit analysiert die geltenden Gesetze und Verordnungen, die Hinweisgeber schützen sollen, und bewertet deren praktische Wirksamkeit.
Welche Faktoren beeinflussen die Entscheidung eines Whistleblowers?
Ein Prozessmodell zeigt auf, dass sowohl objektive Umstände als auch subjektive Einschätzungen der Konsequenzen den Verlauf der Meldung bestimmen.
Welche kriminalpolitischen Konsequenzen werden abgeleitet?
Die Untersuchung mündet in Handlungsempfehlungen zur Verbesserung von Meldesystemen und zum besseren Schutz von Individuen, die Straftaten aufdecken.
- Quote paper
- Maximilian Nussbaum (Author), 2017, Whistleblowing im wirtschaftsstrafrechtlichen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/432696