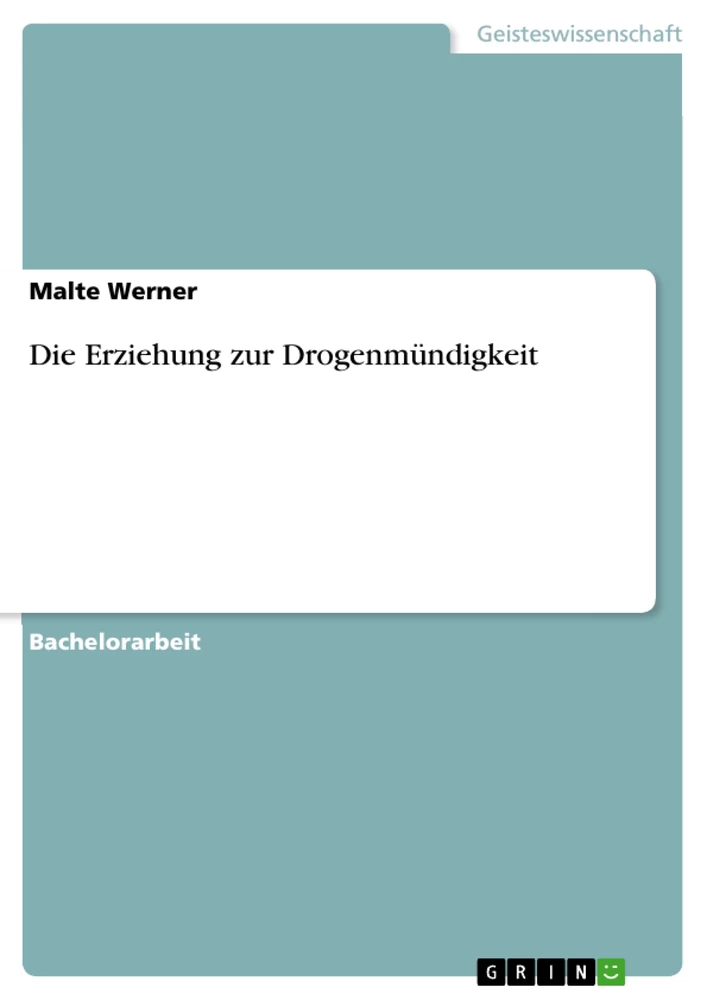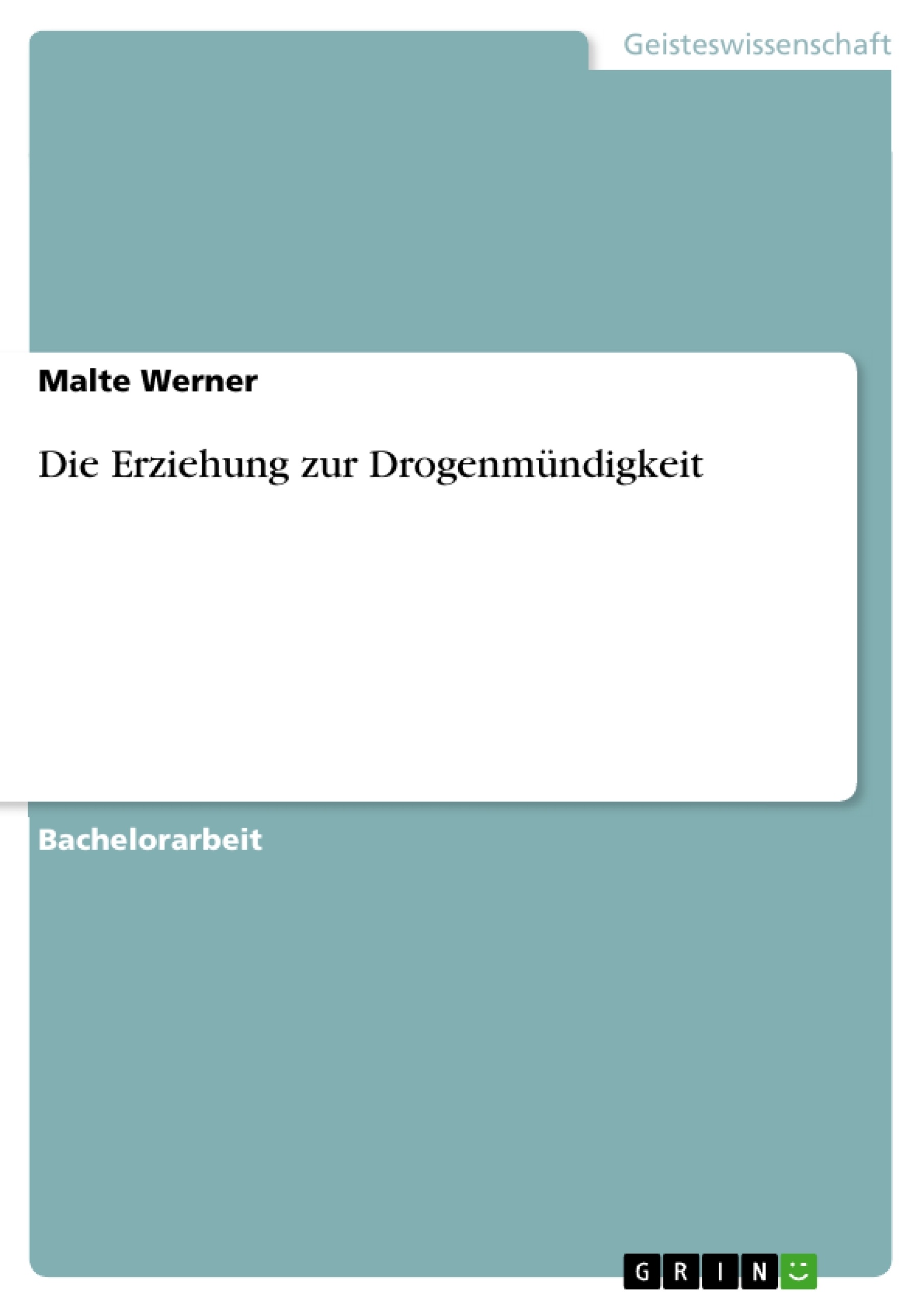Diese Arbeit verfolgt unter Anbetracht der wissenschaftlich ausgewerteten Informationen, das Ziel die Exekutive unseres sozialen Systems zum Thema Erziehung zur Drogenmündigkeit in der sozialen Arbeit zu sensibilisieren und ihre Ansichten reformieren.
Dies geschieht unter Betrachtung der drei Forschungsfragen: Welche Faktoren machen einen drogenmündigen Menschen aus? Unter welchen Umständen ist die Erziehung zur Drogenmündigkeit einem Verbot vorzuziehen? Und, Ist die Konsum akzeptierende Erziehung zur Drogenmündigkeit in der sozialen Realität präsent?
Hierfür gibt es einen Einblick in die Substanzkunde und ihrem geschichtlichen Hintergrund. Es wird auf die Folgen des verfrühten Konsums in Form eines informellen Einstiegs und eines Experteninterviews zum Thema Psychosen eingegangen. Der Begriff Drogenmündigkeit wird definiert, in seine Bestandteile aufgebrochen und ähnlichen pädagogischen Theorien gegenübergestellt. Des Weiteren wird die Faszination der Drogenkultur über den Vertrieb von Betäubungsmitteln behelligt und durch ein Experteninterview mit einem Drogendealer empirisch belegt.
Eine Umfrage zum Thema Konsum von legalen und illegalen Drogen liefert empirische Evidenz für den Umgang mit- und das Wissen der Menschen über Drogen. Alle drei Fragen werden im Zuge des Informationsflusses und zuzüglichen Zusammenspiel mit der Empirie beantwortet. Im Zuge der Arbeit erschließen sich nachfolgend beschriebene Ergebnisse. Jeder Mensch sollte zum Thema Drogen eine Mündigkeit entwickeln und unter den Faktoren, welche diese ausmachen für sich entscheiden, ob er Drogen konsumieren sollte oder nicht. Die Erziehung zur Drogenmündigkeit stellt, im Gegenzug zum Verbot, eine sinnvollere Alternative der Drogenerziehung dar. Das Zusammenspiel der Säulen nach Barsch und den Prinzipien der Drogenmündigkeit nach Quensel, welche in Kapitel zwei beschrieben werden, definieren die Faktoren, welche das soziale Individuum drogenmündig machen. Wer jedoch geistig nicht in der Lage ist die theoretische Zugrundelegung der Theorie um die Drogenmündigkeit zu verstehen und sich und seine Person bezüglich der Faktoren zu reflektieren, der kann auch keine Drogenmündigkeit erlangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Klassifizierung von Substanzen als Drogen
- 2.1 Legale Drogen
- 2.2 Illegale Drogen und das Betäubungsmittelgesetz
- 2.3 Drogenkonsum im Jugendalter als Verstärkung einer paranoiden Schizophrenie
- 2.3.1 Auswertung Experteninterview
- 3. Drogenmündigkeit ein umstrittener Begriff
- 3.1 Begriff Mündigkeit
- 3.2 Begriff Drogenmündigkeit
- 3.3 Prinzipien der Erziehung zur Drogenmündigkeit
- 3.4 Säulen der Drogenmündigkeit
- 3.4.1 Risikokompetenz
- 3.4.2 Genussfähigkeit
- 3.4.3 Kritikfähigkeit
- 3.4.4 Drogenwissen
- 4. Vertrieb von Betäubungsmitteln
- 4.1 Auswertung Experteninterview mit einem Drogendealer
- 5. Umgang mit Drogen und Drogenmündigkeit in der sozialen Realität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Erziehung zur Drogenmündigkeit in der sozialen Arbeit. Ziel ist es, die Ansichten des sozialen Systems bezüglich der Drogenprävention zu sensibilisieren und zu reformieren. Dies geschieht durch die Beantwortung dreier Forschungsfragen: Die Definition von Drogenmündigkeit, die Gegenüberstellung von Erziehung zur Drogenmündigkeit und Verboten, und die Untersuchung der Akzeptanz einer konsumorientierten Drogenmündigkeit in der sozialen Realität.
- Definition und Komponenten von Drogenmündigkeit
- Vergleich von Erziehung zur Drogenmündigkeit und Drogenverboten
- Analyse des Drogenkonsums im Jugendalter und dessen Auswirkungen
- Der illegale Drogenhandel und dessen Einfluss auf die Drogenkultur
- Der aktuelle Stand der Drogenaufklärung in der sozialen Realität
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel dient als Einführung in das Thema der Bachelorarbeit und stellt die Forschungsfragen und die Zielsetzung dar. Es bietet einen Überblick über den Aufbau der Arbeit und skizziert die methodischen Ansätze.
2. Die Klassifizierung von Substanzen als Drogen: Dieses Kapitel klassifiziert Substanzen als legale und illegale Drogen, wobei es detailliert auf verschiedene legale Substanzen wie Tabak, Alkohol und Medikamente eingeht. Im weiteren Verlauf werden illegale Drogen, geordnet nach natürlichen und synthetischen Substanzen, vorgestellt und im Kontext des Betäubungsmittelgesetzes betrachtet. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Drogenkonsum im Jugendalter und seinen potenziellen Auswirkungen, insbesondere im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie. Die Auswertung eines Experteninterviews ergänzt die theoretischen Ausführungen mit praktischen Erfahrungen.
3. Drogenmündigkeit ein umstrittener Begriff: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem komplexen Begriff der Drogenmündigkeit. Es analysiert den Begriff "Mündigkeit" an sich und entwickelt daraus eine Definition für "Drogenmündigkeit". Es werden die Prinzipien und Säulen der Erziehung zur Drogenmündigkeit erörtert und mit anderen pädagogischen Theorien verglichen. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Risikokompetenz, Genussfähigkeit, Kritikfähigkeit und Drogenwissen als Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Drogenmündigkeit. Die Kapitelteile beleuchten die verschiedenen Aspekte dieses vielschichtigen Konzepts und deren Bedeutung für die Drogenprävention.
4. Vertrieb von Betäubungsmitteln: Dieses Kapitel befasst sich mit dem illegalen Vertrieb von Betäubungsmitteln. Ein Experteninterview mit einem Drogendealer liefert empirische Daten zum Thema und beleuchtet die Dynamiken des Drogenhandels sowie dessen Einfluss auf die Drogenkultur und die gesellschaftliche Wahrnehmung von Drogen. Der Fokus liegt auf den praktischen Aspekten des illegalen Drogenmarktes und dessen Auswirkungen.
5. Umgang mit Drogen und Drogenmündigkeit in der sozialen Realität: Dieses Kapitel analysiert den Umgang mit Drogen und die Präsenz von Drogenmündigkeit in der sozialen Realität. Die Auswertung einer Umfrage zum Konsum legaler und illegaler Drogen liefert empirische Evidenz für das Wissen und den Umgang der Bevölkerung mit Drogen. Die Ergebnisse dieser Umfrage werden detailliert interpretiert und im Kontext der vorherigen Kapitel diskutiert. Das Kapitel beleuchtet den aktuellen Stand der Drogenaufklärung und identifiziert Potenziale für Verbesserungen.
Schlüsselwörter
Drogenmündigkeit, Drogenprävention, Drogenkonsum, Jugendlicher Drogenkonsum, Betäubungsmittelgesetz, legale Drogen, illegale Drogen, Risikokompetenz, Genussfähigkeit, Kritikfähigkeit, Drogenwissen, Experteninterview, soziale Arbeit, Pädagogik, Aufklärung.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Erziehung zur Drogenmündigkeit in der Sozialen Arbeit
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Erziehung zur Drogenmündigkeit in der Sozialen Arbeit. Sie befasst sich mit der Definition von Drogenmündigkeit, vergleicht Erziehung zur Drogenmündigkeit mit Drogenverboten und analysiert die Akzeptanz einer konsumorientierten Drogenmündigkeit in der sozialen Realität.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beantwortet drei zentrale Forschungsfragen: Wie lässt sich Drogenmündigkeit definieren? Wie lassen sich Erziehung zur Drogenmündigkeit und Drogenverbote gegenüberstellen? Wie hoch ist die Akzeptanz einer konsumorientierten Drogenmündigkeit in der sozialen Realität?
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung) dient als Einführung. Kapitel 2 (Klassifizierung von Substanzen als Drogen) unterscheidet zwischen legalen und illegalen Drogen und beleuchtet den Jugenddrogenkonsum im Kontext psychischer Erkrankungen (z.B. Schizophrenie). Kapitel 3 (Drogenmündigkeit – ein umstrittener Begriff) analysiert den Begriff der Drogenmündigkeit, seine Prinzipien und Säulen (Risikokompetenz, Genussfähigkeit, Kritikfähigkeit, Drogenwissen). Kapitel 4 (Vertrieb von Betäubungsmitteln) untersucht den illegalen Drogenhandel anhand eines Experteninterviews mit einem Drogendealer. Kapitel 5 (Umgang mit Drogen und Drogenmündigkeit in der sozialen Realität) analysiert den Umgang mit Drogen in der Gesellschaft anhand einer Umfrage.
Welche Methoden werden in der Arbeit eingesetzt?
Die Arbeit verwendet qualitative Methoden wie Experteninterviews (mit einem Drogendealer und Experten zum Thema Jugenddrogenkonsum und Schizophrenie) und quantitative Methoden wie Umfragen zur Erhebung von Daten zum Drogenkonsum und zur Akzeptanz von Drogenmündigkeit in der Bevölkerung. Die Ergebnisse werden interpretiert und im Kontext der vorherigen Kapitel diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Drogenmündigkeit, Drogenprävention, Drogenkonsum, Jugendlicher Drogenkonsum, Betäubungsmittelgesetz, legale Drogen, illegale Drogen, Risikokompetenz, Genussfähigkeit, Kritikfähigkeit, Drogenwissen, Experteninterview, soziale Arbeit, Pädagogik, Aufklärung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Ansichten des sozialen Systems bezüglich der Drogenprävention zu sensibilisieren und zu reformieren. Sie möchte einen Beitrag zum Verständnis von Drogenmündigkeit und ihrer Bedeutung für die Drogenprävention leisten.
Welche konkreten Themenschwerpunkte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Definition und Komponenten von Drogenmündigkeit, den Vergleich von Erziehung zur Drogenmündigkeit und Drogenverboten, die Analyse des Drogenkonsums im Jugendalter und dessen Auswirkungen, den illegalen Drogenhandel und dessen Einfluss auf die Drogenkultur sowie den aktuellen Stand der Drogenaufklärung in der sozialen Realität.
- Citation du texte
- Malte Werner (Auteur), 2018, Die Erziehung zur Drogenmündigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/434435