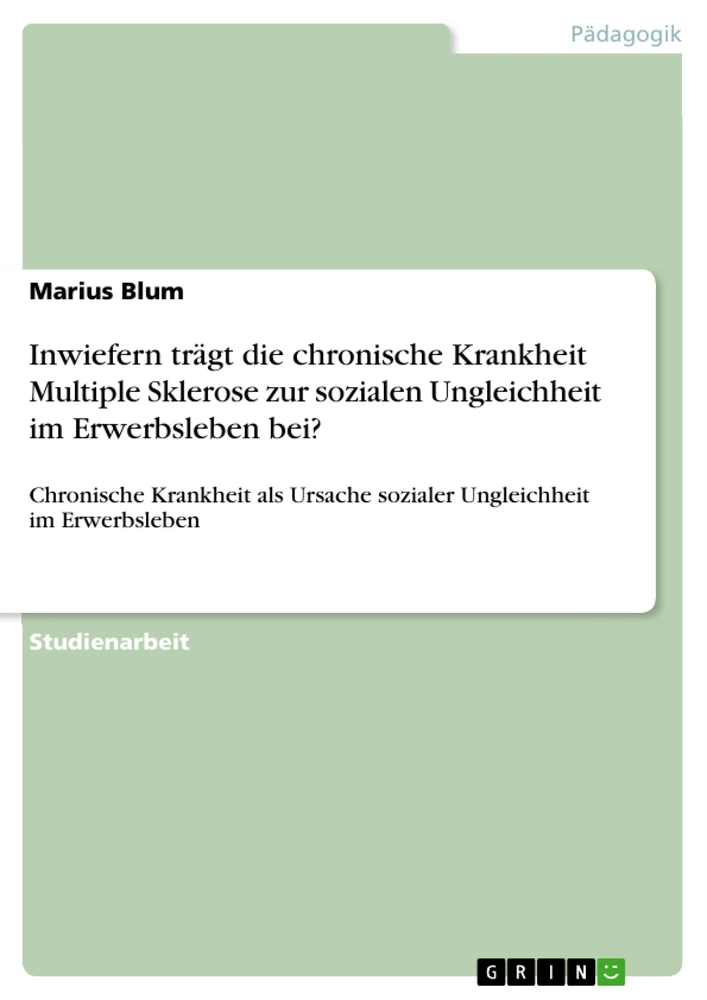Die folgende Arbeit wird im Rahmen des Seminars „Diskurs soziale Ungleichheit – Benachteiligung“ durchgeführt. Hier sollen mit Hilfe eines Interviews zum Themenkomplex „Soziale Ungleichheit im Alltag“ Benachteiligungen aufgedeckt werden. In der folgenden Hausarbeit wird sich mit der chronischen Krankheit Multiple Sklerose und möglichen Ungleichheiten im Erwerbsleben der Betroffenen auseinandergesetzt. Die Multiple Sklerose stellt mit etwa 140000 Betroffenen die häufigste neurologische Erkrankung in Deutschland dar. Sie manifestiert sich im erwerbsfähigen Alter zwischen 20 und 40 Jahren. Darum ist die Auseinandersetzung mit den Ungleichheiten im Erwerbleben der chronisch Erkrankten evident. Es stellt sich daher die Frage, inwiefern die Multiple Sklerose zur sozialen Ungleichheit im Erwerbsleben beiträgt. Dazu wird zunächst definiert, was soziale Ungleichheit nach Berger und Powell bedeutet. Hier wird der Themenkomplex „soziale Ungleichheit“ mithilfe von Beispielen zu MS veranschaulicht. Daran schließt sich die Beschreibung des Krankheitsbildes der MS an. Dieser Abschnitt wird so unterteilt, dass der Leser nachvollziehen kann, was eine chronische Krankheit ist, welche Charakteristika und Symptome die MS mit sich bringt, die wiederrum Einfluss auf das Erwerbsleben der Betroffenen haben. Nachdem die beiden großen Themenkomplexe beschrieben sind, soll der Stand der Forschung zum Thema der Hausarbeit dargestellt werden, der von empirischen Daten untermauert wird. Diese Grundlagen werden dann genutzt, um Hypothesen zu entwickeln, die der Beantwortung der Forschungsfrage dienen. Damit diese beantwortet werden können, wird ein problemzentriertes Interview mit einer MS-Patientin durchgeführt. Dieses wird dann in Anlehnung an die strukturierende Inhaltsanalyse nach Mayring analysiert, um so eine Beantwortung der Forschungsfrage zu ermöglichen. Im letzten Kapitel werden dann die Ergebnisse der Analyse zusammengefasst und diskutiert. Außerdem soll ein Ausblick gegeben werden, warum der Abbau von Benachteiligungen chronisch Kranker im Erwerbsleben wichtig ist. In der Arbeit wird auch auf eine mögliche Einschränkung der Berufs- und Studienwahl eingegangen, obwohl diese nicht direkt zum Erwerbsleben gehören. Hier wird jedoch der Grundstein für den späteren Beruf gelegt, der wiederum bestimmt wie sich die Lebensbedingungen für die Betroffenen entwickeln. Die Arbeit wird nur einen Einblick in Benachteiligungen MS-Kranker im Erwerbsleben geben und ist nicht repräsentativ.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen und der Stand der Forschung
- Soziale Ungleichheit – Was ist soziale Ungleichheit?
- Multiple Sklerose
- Multiple Sklerose als chronische Krankheit
- Beschreibung des Krankheitsbildes
- Symptomatologie
- Multiple Sklerose und Erwerbsleben
- Theorien zur Problemstellung
- Hypothesen auf Grundlage der bisherigen Forschung und Erläuterung des Untersuchungsdesigns
- Hypothesen bezüglich der Forschungsfrage
- Auswahl und Begründung der Forschungsmethode
- Das problemzentrierte Interview und der Ablauf der Forschung
- Begründung und Erläuterung der Auswertungsmethode
- Auswertung und Interpretation der Ergebnisse
- Fazit, Diskussion und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern die chronische Krankheit Multiple Sklerose (MS) zu sozialer Ungleichheit im Erwerbsleben beiträgt. Sie analysiert das Krankheitsbild der MS und seine Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit. Außerdem werden die verschiedenen Dimensionen sozialer Ungleichheit und ihre Relevanz im Kontext der MS-Erkrankung betrachtet.
- Definition von sozialer Ungleichheit und ihre Bedeutung für Menschen mit MS
- Das Krankheitsbild der MS und seine Auswirkungen auf das Erwerbsleben
- Theorien und empirische Daten zur sozialen Benachteiligung von Menschen mit chronischen Krankheiten
- Analyse eines Interviews mit einer MS-Patientin im Hinblick auf die Auswirkungen der Krankheit auf das Erwerbsleben
- Fazit und Ausblick auf zukünftige Forschungsbedarfe und Maßnahmen zur Reduzierung sozialer Ungleichheit im Kontext von chronischen Krankheiten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit führt in das Thema der sozialen Ungleichheit im Kontext von chronischen Erkrankungen ein, fokussiert auf Multiple Sklerose (MS) und ihre Auswirkungen auf das Erwerbsleben. Sie stellt die Forschungsfrage und gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit.
- Grundlagen und der Stand der Forschung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der sozialen Ungleichheit und beschreibt das Krankheitsbild der MS. Es beleuchtet die Auswirkungen der Krankheit auf das Erwerbsleben und stellt relevante Theorien und Forschungsergebnisse zum Thema vor.
- Hypothesen auf Grundlage der bisherigen Forschung und Erläuterung des Untersuchungsdesigns: Das Kapitel formuliert Hypothesen auf Grundlage der bisherigen Forschung und erläutert die Wahl der Forschungsmethode. Es beschreibt das problemzentrierte Interview als Forschungsdesign und die strukturierende Inhaltsanalyse als Auswertungsmethode.
- Auswertung und Interpretation der Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Analyse des problemzentrierten Interviews mit einer MS-Patientin. Es interpretiert die Daten und diskutiert die Erkenntnisse im Kontext der Forschungsfrage.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Multiple Sklerose, chronische Krankheit, Erwerbsleben, Benachteiligung, Inklusion, Arbeitsmarkt, Berufswahl, problemzentriertes Interview, strukturierende Inhaltsanalyse, empirische Forschung, statistische Diskriminierung
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst Multiple Sklerose die soziale Gleichheit im Beruf?
Die Krankheit kann aufgrund ihrer Symptomatik und Unvorhersehbarkeit zu Benachteiligungen bei der Jobsuche, der Karriereentwicklung und der allgemeinen Teilhabe am Erwerbsleben führen.
Was ist das typische Manifestationsalter von MS?
MS tritt meist im Alter zwischen 20 und 40 Jahren auf, also genau in der Phase des Einstiegs und der Etablierung im Erwerbsleben.
Welche Forschungsmethode wurde in dieser Arbeit verwendet?
Es wurde ein problemzentriertes Interview mit einer MS-Patientin durchgeführt und nach der strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet.
Spielt die Berufs- und Studienwahl eine Rolle bei MS-Betroffenen?
Ja, die Arbeit zeigt, dass bereits bei der Wahl des Studiums oder Berufs Einschränkungen bedacht werden müssen, die den späteren Lebensstandard beeinflussen.
Was ist das Ziel der Arbeit in Bezug auf Benachteiligungen?
Die Arbeit soll aufzeigen, warum der Abbau von Barrieren für chronisch Kranke wichtig ist und wie soziale Ungleichheit im Alltag von MS-Patienten entsteht.
- Citation du texte
- Marius Blum (Auteur), 2018, Inwiefern trägt die chronische Krankheit Multiple Sklerose zur sozialen Ungleichheit im Erwerbsleben bei?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/434977