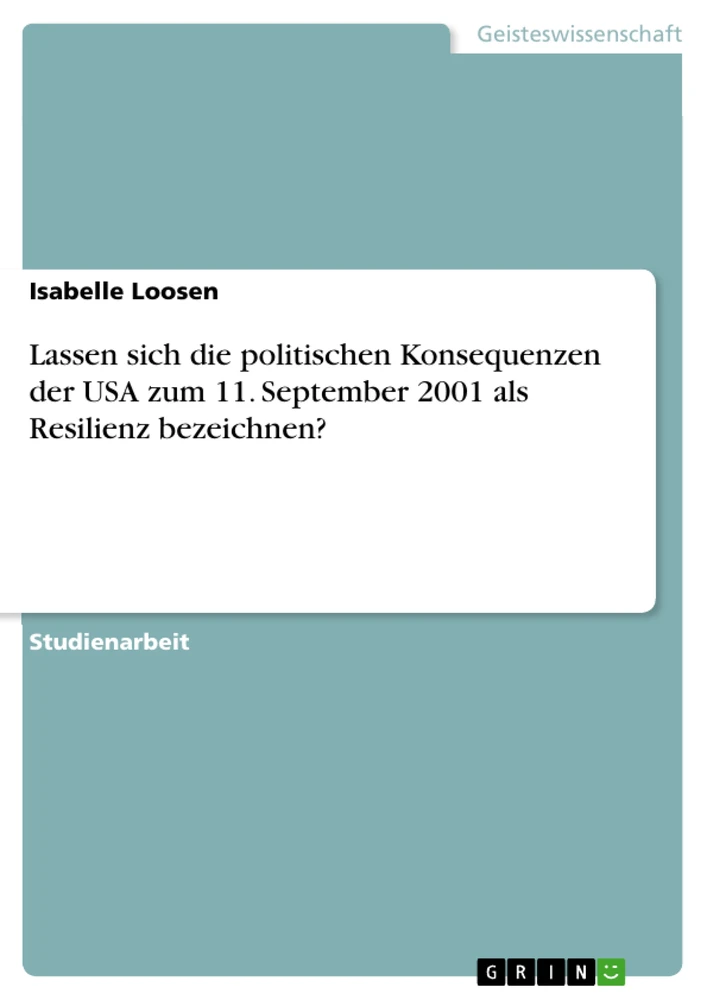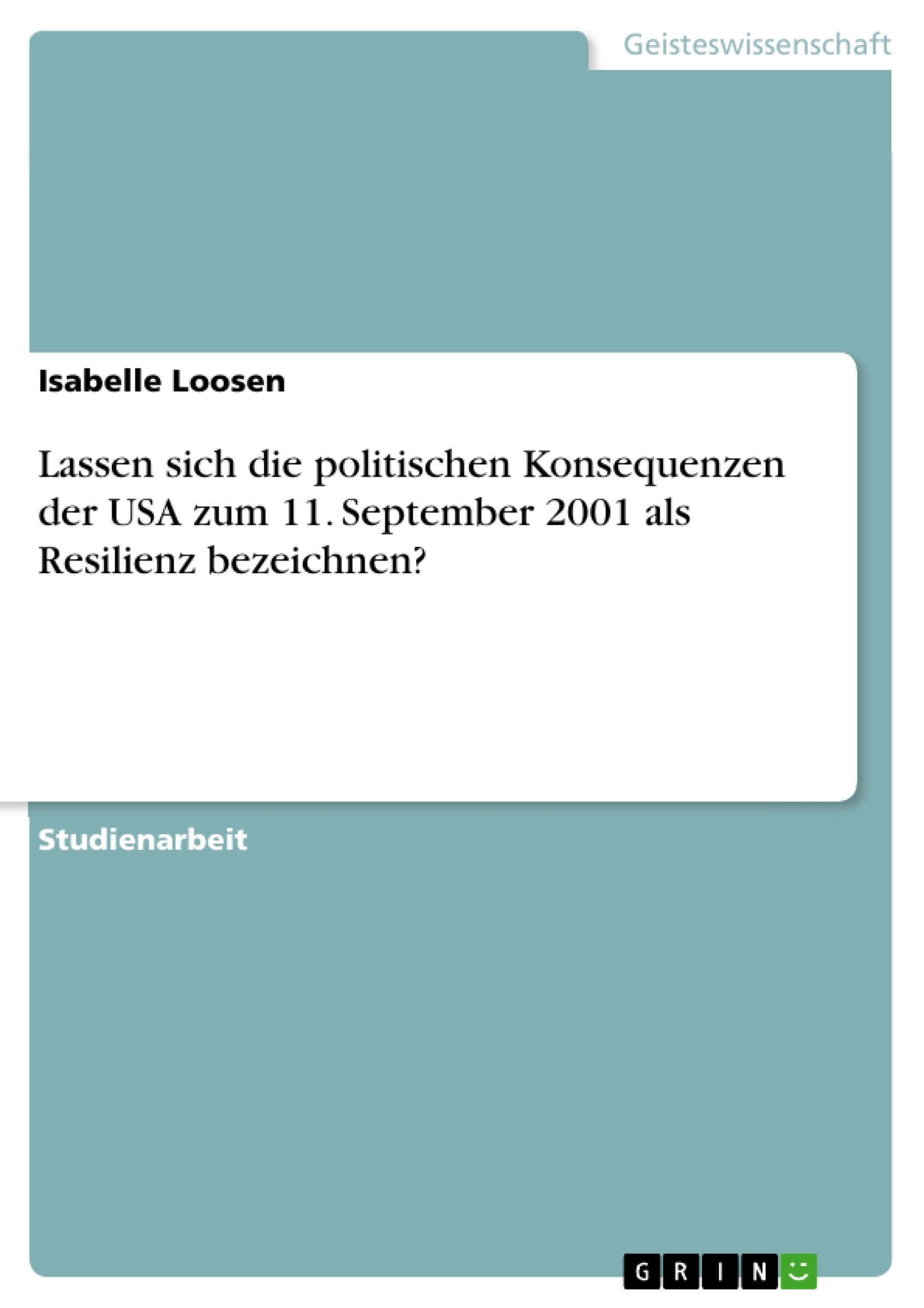Das Zitat eines Augenzeugens, der ursprünglich davon sprach, wie er den Flugzeugeinschlag im World Trade Center erlebte, lässt sich heute als sinnbildlich für den gesamten 11. September 2001 und dessen Auswirkungen sehen. „Und dann brach alles zusammen“. Auch 13 Jahre nach den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001, bei dem über 3000 Menschen gestorben sind, sind die Auswirkungen noch auf der ganzen Welt zu spüren. „Sie zeigtigen [sic!] nicht nur politische, sicherheitspolitische soziale, ökonomische, weltanschauliche und geheimdienstliche Folgen [...].“
Ausgehend von politischen Entscheidungen, Änderungen und Einschränkungen der US-amerikanischen Regierung hat ein Großteil der Weltbevölkerung die Aufgabe, mit dem Erlebten und dessen Konsequenzen umzugehen. Seien es Kriege, schärfere Flugkontrollen oder einfach die ständige Angst vor neuen Anschlägen, fast jedes Mitglied der Gesellschaft ist betroffen. Anschläge dieser Art bedeuten eine enorme Belastung für die Bevölkerung, die sie völlig aus ihrem geordneten Leben werfen kann. Aufgrund der enormen Reichweite der Terroranschläge, die nicht nur die USA getroffen haben, und dem zeitlichen Abstand, ist das Thema ideal, um an mehreren Beispielen zu demonstrieren, was Resilienz ausmacht und wo sie in der Realität zutreffen kann. Zudem gelten Terroranschläge, aufgrund der „Schocks und Traumata [...] zu jenen seltenen Ereignissen in der Geschichte, die auch ein großes Veränderungspotenzial für ansonsten relativ stabile Strukturen wie nationale Identitäten haben.“ Diese Ausarbeitung wird sich mit der Frage nach dem Aufkommen von Resilienz im Anschluss an die Anschläge des 11. Septembers 2001, im weiteren auch als 9/11 bezeichnet, befassen. Dabei geht es nicht direkt um die Resilienz einzelner Bürger, sondern um die der Politik und des Staates an sich. Dabei muss jedoch erwähnt werden, dass politische Handlungen natürlich Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, sodass die Aspekte nicht vollkommen differenziert voneinander betrachtet werden können.
Zunächst soll eine Definition der sozialwissenschaftlichen Sichtweise von Resilienz gefunden und erläutert werden. Danach sollen die politischen Auswirkungen exemplarisch anhand von drei ausgewählten Beispielen dargestellt und im Anschluss genau auf eine mögliche Resilienz hin untersuchen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Resilienz
- 2.1 Sichtweisen sozialer Resilienz
- 2.2 Das Resilienzverständnis nach Markus Keck und Patrick Sakdapolrak
- 3 Die USA und der 11. September 2001
- 3.1 Die Auswirkungen des 11. Septembers 2001
- 3.1.1 Verhaftungswellen - Guantánamo
- 3.1.2 Der Patriot Act
- 3.1.3 Die Anschläge in Afghanistan/, War on Terror'
- 4 Welche Auswirkungen lassen sich als Resilienz bezeichnen?
- 4.1 Verhaftungswellen und Resilienz
- 4.2 Patriot Act und Resilienz
- 4.3 Krieg gegen den Terror und Resilienz
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Ausarbeitung befasst sich mit der Frage, ob die politischen Konsequenzen der USA zum 11. September 2001 als Resilienz bezeichnet werden können. Dabei wird der Fokus auf die Resilienz der Politik und des Staates an sich gelegt, wobei die Auswirkungen auf die Gesellschaft mitberücksichtigt werden. Es wird eine Definition der sozialwissenschaftlichen Sichtweise von Resilienz erörtert und anschließend anhand von drei ausgewählten Beispielen untersucht, ob in diesen eine Resilienz erkennbar ist.
- Definition der sozialwissenschaftlichen Sichtweise von Resilienz
- Analyse der Auswirkungen des 11. Septembers 2001 auf die USA
- Bewertung der politischen Maßnahmen im Kontext von Resilienz
- Bedeutung der Resilienz für die politische Stabilität
- Entwicklung der Resilienz im Laufe der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und stellt die zentrale Fragestellung dar. Kapitel zwei definiert den Begriff der Resilienz, insbesondere aus sozialwissenschaftlicher Perspektive, und erläutert verschiedene Sichtweisen auf dieses Konzept. Im dritten Kapitel werden die Auswirkungen der Anschläge vom 11. September 2001 auf die USA dargestellt, insbesondere die Verhaftungswellen, den Patriot Act und den “Krieg gegen den Terror”. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Frage, welche der beschriebenen Auswirkungen als Resilienz bezeichnet werden können.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Resilienz, Terrorismus, Politik, USA, 11. September 2001, Verhaftungswellen, Patriot Act, Krieg gegen den Terror, soziale Akteure, Krisenbewältigung, Anpassungsfähigkeit. Die Arbeit untersucht, inwiefern die politischen Entscheidungen der USA nach den Anschlägen vom 11. September 2001 Merkmale von Resilienz aufweisen.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Resilienz im sozialwissenschaftlichen Kontext?
Resilienz beschreibt die Fähigkeit von sozialen Systemen oder Akteuren, Krisen und Schocks zu bewältigen und sich an veränderte Bedingungen anzupassen.
Können die US-Reaktionen auf 9/11 als Resilienz bezeichnet werden?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob politische Maßnahmen wie der Patriot Act oder der Krieg gegen den Terror als Ausdruck staatlicher Resilienz gelten können.
Welche politischen Auswirkungen von 9/11 werden analysiert?
Untersucht werden die Verhaftungswellen (Guantánamo), die Einführung des Patriot Act und die militärischen Interventionen in Afghanistan.
Unterscheidet die Arbeit zwischen individueller und politischer Resilienz?
Ja, der Fokus liegt primär auf der Resilienz der Politik und des Staates, wobei die Auswirkungen auf die Gesellschaft mitberücksichtigt werden.
Warum haben Terroranschläge ein hohes Veränderungspotenzial?
Aufgrund der traumatischen Schocks können sie selbst stabile Strukturen wie nationale Identitäten und politische Systeme tiefgreifend transformieren.
- Quote paper
- Isabelle Loosen (Author), 2014, Lassen sich die politischen Konsequenzen der USA zum 11. September 2001 als Resilienz bezeichnen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/435087