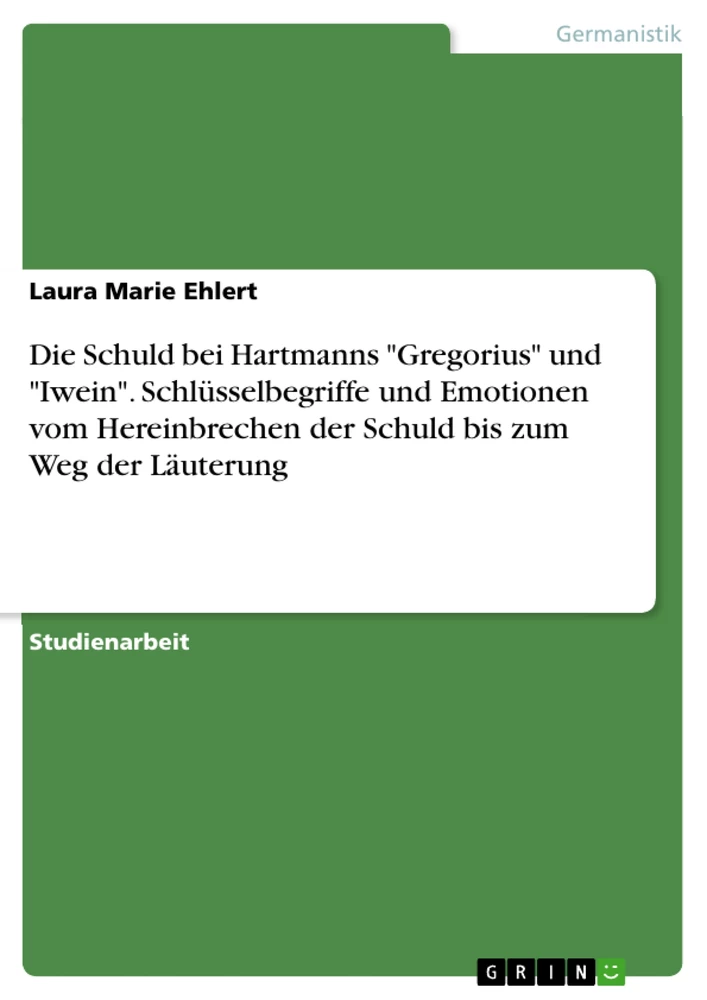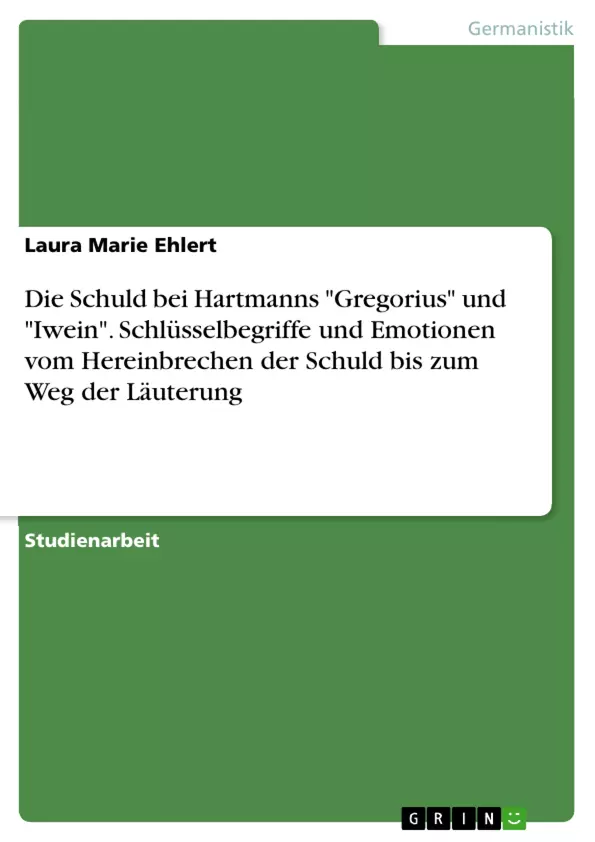Die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts ist in der deutschsprachigen Literatur vor allem durch das aufkommende Rittertum geprägt. Auch Hartmann von Aue greift in seinen Werken diese Thematik auf und bietet durch sie die Möglichkeit zur Verstrickung des Helden in Schuld. „Dem Gedanken, mit Schuld beladen zu sein, kommt […] eine besondere Bedeutung zu“ , da laut Jacques Le Goff die Ewigkeit für den mittelalterlichen Menschen ganz nah sei und Hölle oder Paradies schon morgen eintreten könnten. Die Elemente der Schuld und Läuterung werden unter anderem im „Gregorius“ und im „Iwein“ verwendet und dienen als Grundlage dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Hereinbrechen der Schuld
- Gregorius – vürgedanc und zwîvel als Gefahr des ewigen Verderbens
- Iwein – mangelnde mâze als Ursache des Schuldhereinbrechens
- Die Gewalt der Schuld – Schuldgefühle und Emotionen
- Gregorius – Sünde als zwîvaltiger tôt
- Iwein Selbsthass und Wahnsinn
- Der Weg der Läuterung
- Gregorius - die kolossale Buße als Weg zu Gott
- Iwein Aventiurefahrt als Rückkehr zu Laudine
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Thematik von Schuld und Läuterung in den Werken Hartmanns von Aue, insbesondere in den Epen „Gregorius“ und „Iwein“. Sie untersucht die Ursachen des Schuldhereinbrechens und die damit einhergehenden Schuldgefühle und Emotionen der Protagonisten, wobei die Bedeutung der Schlüsselbegriffe mâze, zwîvel und vürgedanc sowie die Todsünden desperatio und praesumptio beleuchtet werden.
- Die Bedeutung von mâze als ritterliche Grundtugend und ihre Bedeutung in der Minne
- Die Rolle des vürgedanc und zwîvel als Faktoren, die zum Schuldhereinbrechen führen
- Die Auswirkungen von Schuldgefühlen und Emotionen auf Gregorius und Iwein
- Der Weg der Läuterung durch Buße und Aventiurefahrt
- Die Verbindung zwischen Schuld, Läuterung und dem Konzept von ritterlicher Ehre
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen und literarischen Kontext von Hartmanns Werken vor und erläutert den Fokus dieser Arbeit auf die Thematik von Schuld und Läuterung. Sie führt außerdem die zentralen Begriffe und Konzepte ein, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt werden.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Schuldhereinbrechen bei Gregorius und Iwein. Es analysiert die jeweiligen Schuldquellen und Ursachen, wobei die Bedeutung von mâze, zwîvel und vürgedanc im Zusammenhang mit den Todsünden desperatio und praesumptio beleuchtet werden.
Das dritte Kapitel geht auf die Schuldgefühle und Emotionen beider Protagonisten ein und analysiert deren Auswirkungen auf ihr Handeln. Hierbei wird das Emotionsmodell nach Maria Helena Oestreicher verwendet.
Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Weg der Läuterung, den Gregorius und Iwein durchlaufen. Es untersucht die Bedeutung der Buße und Aventiurefahrt sowie deren Zusammenhang mit den Begriffen riuwe und mâze.
Schlüsselwörter
Schuld, Läuterung, mâze, vürgedanc, zwîvel, desperatio, praesumptio, Gregorius, Iwein, Hartmann von Aue, Rittertum, Minne, Aventiure, Buße, riuwe, Emotionen, Todsünden, mittelalterliche Literatur, deutschsprachige Literatur, höfische Dichtung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „mâze“ in der ritterlichen Literatur?
Mâze steht für das rechte Maß, Zurückhaltung und Ausgeglichenheit. Ein Mangel an mâze führt bei Iwein zum moralischen Fall und in den Wahnsinn.
Wie unterscheiden sich die Sünden von Gregorius und Iwein?
Gregorius lädt durch (unwissentlichen) Inzest religiöse Schuld auf sich, während Iweins Schuld eher im ritterlich-gesellschaftlichen Versäumnis gegenüber seiner Frau Laudine liegt.
Was versteht Hartmann von Aue unter „zwîvel“?
Zwîvel bezeichnet den Zweifel an Gottes Gnade oder die Verzweiflung (desperatio), was im Mittelalter als schwere Sünde galt, die zum ewigen Verderben führen konnte.
Wie erreicht Gregorius seine Läuterung?
Gregorius vollzieht eine extreme, 17-jährige Buße auf einem Felsen im Meer, um durch vollkommene Askese und Gottvertrauen Vergebung zu erlangen.
Welche Rolle spielt die Aventiurefahrt für Iweins Rückkehr?
Durch heldenhafte Taten (Aventiuren), die er in den Dienst Schwächerer stellt, beweist Iwein seine wiedergewonnene mâze und verdient sich die Versöhnung mit Laudine.
- Quote paper
- Laura Marie Ehlert (Author), 2011, Die Schuld bei Hartmanns "Gregorius" und "Iwein". Schlüsselbegriffe und Emotionen vom Hereinbrechen der Schuld bis zum Weg der Läuterung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/435286