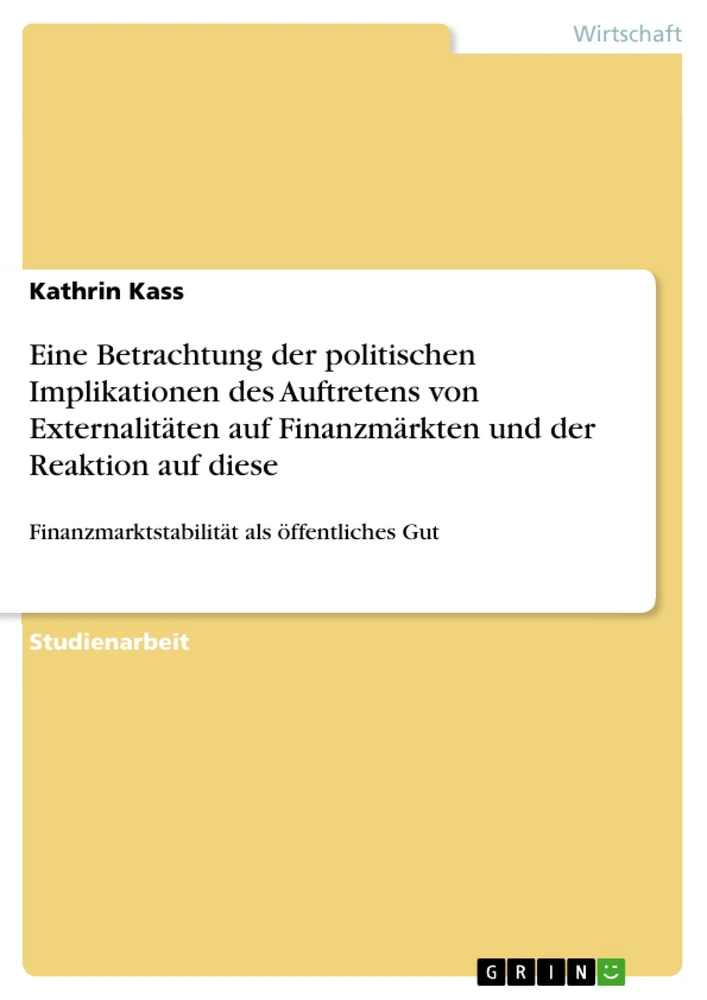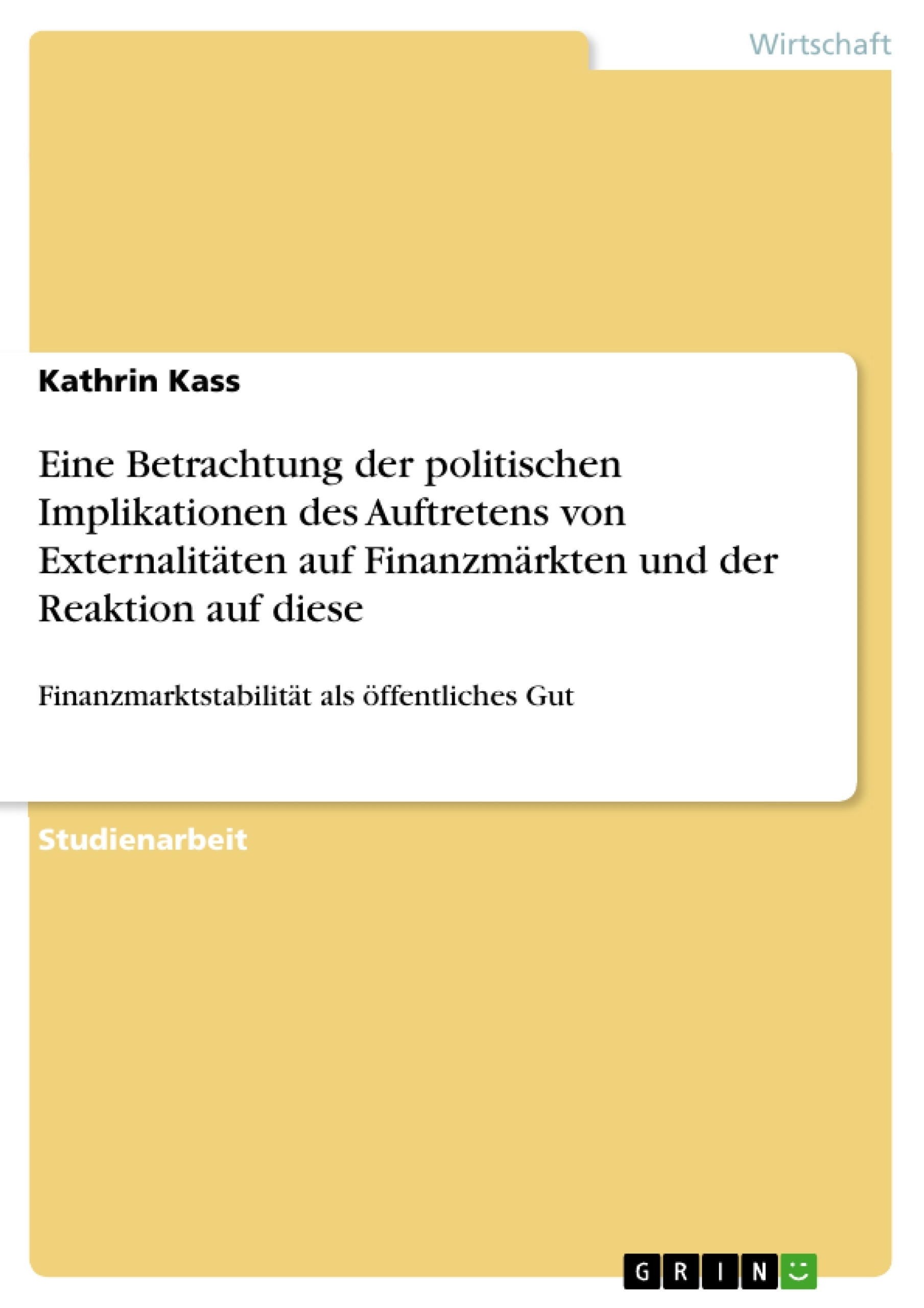Der Ausbruch der Finanzkrise, der mit dem Fall von Lehman Brothers konstatiert wird, hat deutlich gemacht, dass die Finanzmarktregulierung nur unzureichend funktioniert hat. Auch die Euro-Krise, deren Gründe zwar nicht auf den Finanzmärkten zu finden sind, diese aber deren Auslöser darstellen, zeigt, dass sich die internationale Bankenlandschaft immer weiter von ihrer originären Aufgabe entfernt hat. Diese besteht darin, dass in einer Volkswirtschaft umlaufende Geld effizient zu verteilen, also Anbieter und Nachfrager von Kapital zusammenzuführen. Stattdessen wurde der Eigenhandel, also der Handel von Banken untereinander in eigenem Namen und auf eigene Rechnung ausgeweitet. Auf diese Weise konnten Verluste aus risikoreichen Transaktionen des Eigenhandels auf den Geschäftsbankenteil übergreifen. Außerdem entstanden Banken, die so groß waren, dass sich ihre Vorstände in Sicherheit wiegen konnten, staatliche Unterstützung im Falle einer Krise zu erhalten. Gleichzeitig waren die Jahre vor der Finanzkrise durch zunehmende Deregulierung auf internationaler Ebene gekennzeichnet. Bestehende Fehlanreize, welche Moral Hazard begünstigten, schürten diese negativen Entwicklungen.
Nach den Ereignissen der Jahre 2007/08 wurde erneut deutlich, dass Märkte nicht immer in der Lage sind ein optimales Ergebnis hervorzubringen, dass sich individuell rationales Handeln von dem unterscheiden kann, was auf aggregierter Ebene als rational anzusehen wäre und, dass die Missachtung dieser Tatsachen zu erheblichen negativen Externalitäten zu Lasten der Gesellschaft führt. In diesem Zusammenhang sind die Kosten, die der Gesellschaft durch die Finanzkrise entstanden sind als Externalitäten zu bezeichnen. Nach dem Zusammenbruch der Finanzmärkte wurden erhebliche staatliche Rettungsaktionen vorgenommen. Bestehende Richtlinien erwiesen sich als zu stark auf das einzelne Finanzinstitut ausgerichtet, ließen Risiken, die aus der Größe und Verbundenheit dieser entstehen außer Acht und bedingten Fehlanreize oder waren in deren Vermeidung nicht effizient.
Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, warum es auf Finanzmärkten zu Marktversagen kommt und welche politischen Implikationen sich daraus ergeben. In einem weiteren Schritt soll analysiert werden, inwiefern die vom Basel Committee on Banking Supervision erarbeiteten Richtlinien als Antwort auf die Finanzkrise 2007/08, Effizienz in der Vermeidung von neuerlichen Finanzkrisen erwarten lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Finanzmarktstabilität als öffentliches Gut
- Marktversagen und negative externe Effekte auf Finanzmärkten
- Die Kapitalmarktregulierung nach der Finanzkrise 2007/08
- Mikroprudenzielle Regulierung
- Makroprudenzielle Regulierung
- Zahlungsunfähigkeit systemrelevanter Banken
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Bedeutung von Finanzmarktstabilität als öffentliches Gut und analysiert die politischen Implikationen der Entstehung von Externalitäten auf Finanzmärkten. Im Mittelpunkt steht die Reaktion auf diese Externalitäten im Rahmen der Basel III-Regulierung.
- Marktversagen und negative externe Effekte auf Finanzmärkten
- Die Rolle der Kapitalmarktregulierung
- Mikroprudenzielle und makroprudenzielle Regulierung
- Zahlungsunfähigkeit systemrelevanter Banken
- Die Bedeutung von Finanzmarktstabilität für die Gesamtwirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Finanzmarktstabilität ein und beleuchtet die Bedeutung der Finanzkrise 2007/08 und der Euro-Krise. Sie zeigt auf, wie die internationale Bankenlandschaft von ihrer ursprünglichen Aufgabe abgewichen ist und wie die Deregulierung in den Jahren vor der Finanzkrise zu negativen Entwicklungen geführt hat.
Finanzmarktstabilität als öffentliches Gut
Dieses Kapitel untersucht das Konzept der Finanzmarktstabilität als öffentliches Gut. Es beleuchtet die Entstehung von Marktversagen und negativen externen Effekten auf Finanzmärkten. Die Bedeutung der Kapitalmarktregulierung im Kontext der Finanzkrise wird hervorgehoben, wobei die Unterscheidung zwischen mikroprudenzieller und makroprudenzieller Regulierung im Vordergrund steht.
Zusammenfassung und Fazit
Dieses Kapitel bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Arbeit und zieht Schlussfolgerungen. Die Bedeutung der Finanzmarktstabilität für die Gesamtwirtschaft wird erneut betont.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Finanzmarktstabilität, öffentliches Gut, Marktversagen, externe Effekte, Finanzkrise, Kapitalmarktregulierung, Basel III, Mikroprudenz, Makroprudenz, Systemrelevanz, Zahlungsunfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt Finanzmarktstabilität als öffentliches Gut?
Stabile Finanzmärkte nützen der gesamten Gesellschaft, während ihr Zusammenbruch massive negative Externalitäten (Kosten für Steuerzahler, Wirtschaftskrisen) verursacht, die nicht nur die Verursacher treffen.
Was versteht man unter negativen Externalitäten auf Finanzmärkten?
Dies sind Kosten oder Risiken, die durch das Handeln einzelner Banken entstehen (z.B. durch hochriskanten Eigenhandel), aber von der Allgemeinheit getragen werden müssen.
Was ist der Unterschied zwischen mikro- und makroprudenzieller Regulierung?
Mikroprudenz fokussiert auf die Stabilität einzelner Institute. Makroprudenz betrachtet das Finanzsystem als Ganzes und die Vernetzung zwischen den Banken, um systemische Risiken zu minimieren.
Welche Rolle spielt Basel III nach der Finanzkrise?
Basel III ist eine Antwort auf die Krise 2007/08 und führt strengere Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften ein, um die Widerstandsfähigkeit von Banken zu erhöhen.
Was bedeutet „Moral Hazard“ im Bankensektor?
Es beschreibt das Risiko, dass Banken (besonders systemrelevante) zu hohe Risiken eingehen, weil sie darauf vertrauen, im Krisenfall vom Staat gerettet zu werden („Too big to fail“).
- Quote paper
- Kathrin Kass (Author), 2011, Eine Betrachtung der politischen Implikationen des Auftretens von Externalitäten auf Finanzmärkten und der Reaktion auf diese, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/435617