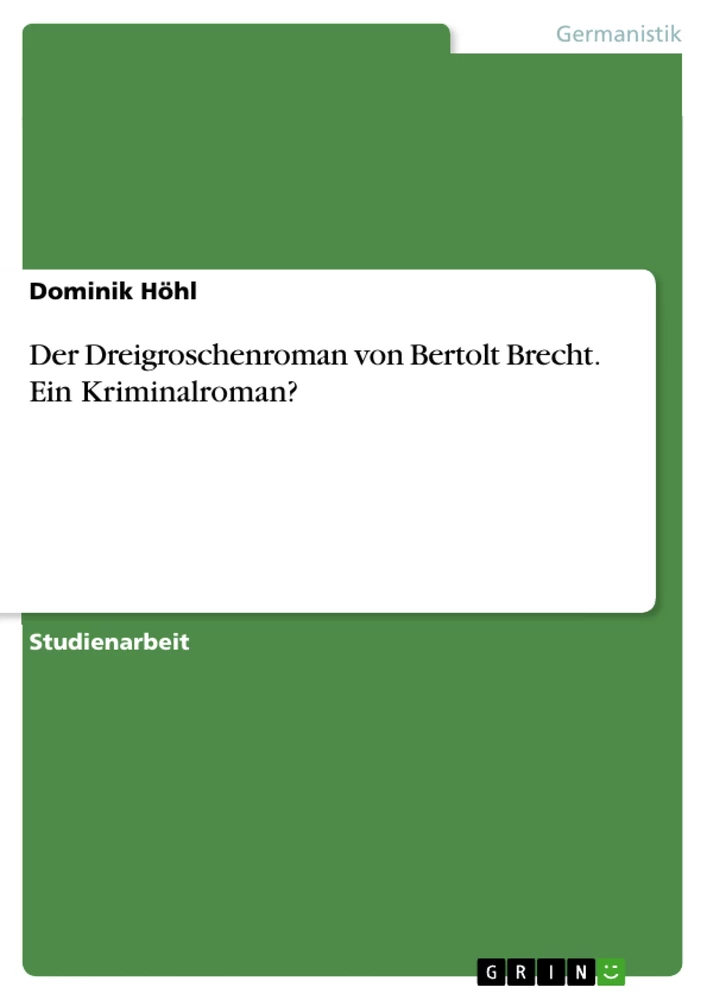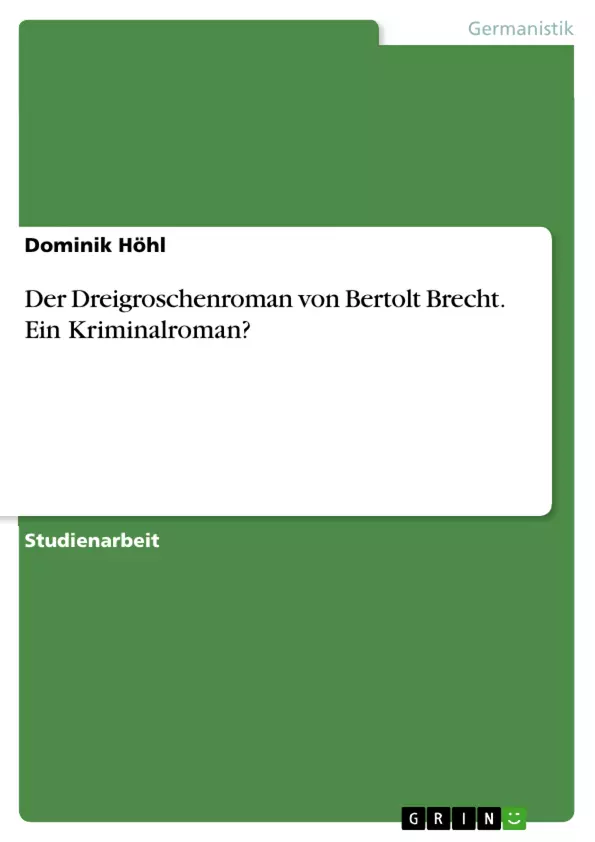Traditionell galt der Kriminalroman in Literaturkreisen als wenig geschätzte Trivialliteratur, die mehr für ein breites und eher anspruchsloses Publikum geschrieben wurde. Doch gab es innerhalb des Genres des Kriminalromans auch immer wieder solche Verarbeitungen, die als literarisch anspruchsvoll gelten. Man denke dabei etwa an Fjodor Dostojewskis Roman Schuld und Sühne. Heutzutage erfreut sich der Kriminalroman großer Beliebtheit unter der Leserschaft. So scheint auch allseits bekannt, was man unter einem klassischen Kriminalroman zu verstehen meint. Ein zentraler Aspekt ist dabei sicherlich das Verbrechen, ohne das der Kriminalroman wohl schwer auskommt. Um Verbrechen geht es auch im Dreigroschenroman von Bertolt Brecht. Der Roman erzählt den Aufstieg zweier unterschiedlicher Geschäftsmänner und deren kriminellen Machenschaften im Londoner Großstadtmilieu zur Zeit des Burenkrieges. Jeder versucht sich in der Geschäftswelt einen Vorteil zu verschaffen und geht dabei auch wortwörtlich über Leichen.
Doch erweckt der Dreigroschenroman scheinbar den Anschein, dass es sich hierbei eher um die Kategorie Wirtschaftsverbrechen handelt als um jene Verbrechen, die im klassischen Kriminalroman üblich sind. In der vorliegenden Arbeit soll daher diskutiert werden, ob man den Dreigroschenroman in das Genre des Kriminalromans einordnen kann. Dabei soll zunächst versucht werden, das Genre Kriminalroman näher zu bestimmen. Hierfür werden zwei Typologien des Kriminalromans unterschieden, die des Thrillers und des Detektivromans. Im Anschluss daran soll kurz auf das von Brecht verfasste Essay „Über die Popularität des Kriminalromans“ eingegangen werden. Mit Hilfe dieser kurzen theoretischen Verortung sollen dann in einem weiteren Schritt die einzelnen Verbrechen betrachtet und schließlich eine Gattungsbestimmung vorgenommen werden. Aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Arbeit muss auf eine inhaltliche Zusammenfassung des Romans verzichtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Kriminalroman - Eine Begriffsbestimmung
- Typologien des Kriminalromans
- Brechts Theorie des Kriminalromans
- Die einzelnen Verbrechen
- Gattungsbestimmung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht, ob Bertolt Brechts „Dreigroschenroman“ als Kriminalroman eingestuft werden kann. Hierzu wird zunächst eine allgemeine Definition des Kriminalromans vorgestellt und zwischen den Untergattungen Detektivroman und Thriller unterschieden. Anschließend wird Brechts eigene Theorie des Kriminalromans betrachtet und anhand dieser die im „Dreigroschenroman“ vorkommenden Verbrechen analysiert. Schließlich erfolgt eine Gattungsbestimmung des Romans.
- Definition des Kriminalromans
- Unterscheidung zwischen Detektivroman und Thriller
- Brechts Theorie des Kriminalromans
- Analyse der Verbrechen im „Dreigroschenroman“
- Gattungsbestimmung des „Dreigroschenromans“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Frage, ob der „Dreigroschenroman“ als Kriminalroman eingestuft werden kann. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Definition des Kriminalromans und unterscheidet zwischen Detektivroman und Thriller. Es beleuchtet auch Brechts eigene Theorie des Kriminalromans. Das dritte Kapitel analysiert die einzelnen Verbrechen im „Dreigroschenroman“ und stellt fest, ob sie den Kriterien des Kriminalromans entsprechen. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Gattungsbestimmung des „Dreigroschenromans“ und versucht die Frage zu beantworten, ob er als Kriminalroman eingestuft werden kann.
Schlüsselwörter
Kriminalroman, Detektivroman, Thriller, Bertolt Brecht, „Dreigroschenroman“, Verbrechen, Gattungsbestimmung, Typologien, Literaturwissenschaft
Häufig gestellte Fragen
Kann man Brechts „Dreigroschenroman“ als Kriminalroman bezeichnen?
Die Arbeit diskutiert diese Gattungsfrage. Obwohl Verbrechen zentral sind, weicht der Roman vom klassischen Muster ab, da er eher Wirtschaftsverbrechen und gesellschaftliche Korruption als individuelle Mordfälle thematisiert.
Was unterscheidet den Detektivroman vom Thriller?
Im Detektivroman steht die Aufklärung eines Rätsels durch Logik im Vordergrund. Im Thriller liegt der Fokus auf Spannung, Action und dem Kampf zwischen Protagonist und Antagonist.
Welche Theorie vertrat Bertolt Brecht zum Kriminalroman?
In seinem Essay „Über die Popularität des Kriminalromans“ analysierte Brecht die Gattung als Ausdruck bürgerlicher Verhältnisse. Er sah im logischen Denken des Detektivs eine Analogie zum wissenschaftlichen Denken.
Welche Arten von Verbrechen werden im „Dreigroschenroman“ dargestellt?
Der Roman schildert den Aufstieg von Geschäftsmännern durch kriminelle Machenschaften, Ausbeutung und Korruption im Londoner Großstadtmilieu, was eher als Systemkritik denn als Krimi fungiert.
Warum galt der Kriminalroman lange Zeit als Trivialliteratur?
Früher wurde das Genre oft als anspruchslose Unterhaltung für die breite Masse abgetan. Literarisch anspruchsvolle Werke wie die von Dostojewski oder eben Brecht zeigen jedoch das Potenzial für tiefgründige Gesellschaftskritik.
- Quote paper
- Dominik Höhl (Author), 2018, Der Dreigroschenroman von Bertolt Brecht. Ein Kriminalroman?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/436366