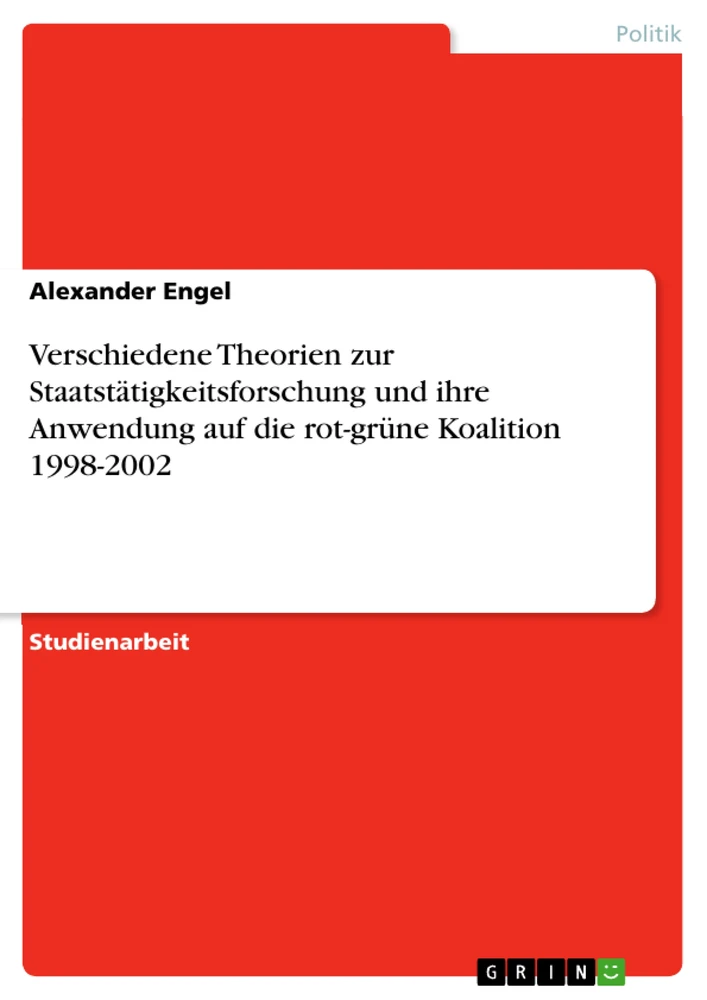In dieser Arbeit möchte ich anhand von verschiedenen Theorien über die Entstehung von Policies und den Zusammenhang dieser mit der ideologischen Ausrichtung einer Partei aufklären. Zunächst werden dabei die verschiedenen Theorien ausführlich und allgemein erklärt. Die Theorien auf die ich mich in dieser Arbeit beziehen werde lauten: Parteiendifferenzthese, Machtressourcentheorie, Theorie der sozioökonomischen Determination, die Politik-Erblast These sowie der politisch-institutionalistische Theorie. Dabei wird vor allem die Parteiendifferenzthese im Vordergrund stehen, ihr ist der längste Teil des dritten Kapitels gewidmet. Zunächst allerdings möchte ich eine kurze Einführung in Anthony Downs Theorie des rationalen politischen Menschen eingehen, da sie überhaupt erst begründet, wie es zu Parteiendifferenzen kommt und nach welchen Gesichtspunkten Politik gemacht wird. Abschließend soll die rot-grüne Regierungszeit zwischen 1998 und 2002 herangezogen werden, um zu überprüfen ob die Parteiendifferenz im Kabinett Schröder gegenüber der letzten Regierungszeit Helmut Kohls festzustellen ist. Dabei wird sich auch auf die vorangegangenen Theorien bezogen und in Einklang mit der ersten Regierungszeit Rot-Grüns gebracht. Führende Autoren für meine Werke waren unter anderem Reimut Zohlnhöfer, Tobias Ostheim, Georg Wenzelburger sowie Klaus von Beyme. Die These dieser Arbeit ist, dass das Kabinett Schröder I keinen Politikwechsel herbeiführte. Ob, und wenn ja warum nicht, dieser Politikwechsel verwehrt blieb, soll anhand der vorgelegten Theorien erläutert werden. Beginnen werde ich die Arbeit mit der sozioökonomischen Schule.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Sozioökonomische Schule
- Machtressourcentheorie
- Institutionalistische Schule
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung von Policies und deren Zusammenhang mit der ideologischen Ausrichtung von Parteien anhand verschiedener Theorien. Im Fokus steht die Frage, ob das Kabinett Schröder I einen Politikwechsel im Vergleich zur Regierungszeit Kohls herbeiführte. Die Arbeit analysiert verschiedene theoretische Ansätze und wendet diese auf die rot-grüne Regierungszeit (1998-2002) an.
- Analyse verschiedener Theorien zur Staatstätigkeitsforschung
- Anwendung der Theorien auf die rot-grüne Regierungskoalition (1998-2002)
- Bewertung des Politikwechsels unter Kanzler Schröder
- Bedeutung von Machtressourcen und Institutionen
- Einfluss sozioökonomischer Faktoren auf die Politikgestaltung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit. Es werden die zu analysierenden Theorien (Parteiendifferenzthese, Machtressourcentheorie, Theorie der sozioökonomischen Determination, Politik-Erblast-These und politisch-institutionalistische Theorie) vorgestellt und die These aufgestellt, dass das Kabinett Schröder I keinen grundlegenden Politikwechsel bewirkte. Der Fokus liegt auf der Untersuchung, ob und warum dieser ausblieb.
Die Sozioökonomische Schule: Dieses Kapitel beschreibt die sozioökonomische Schule als ältesten Theoriestrang der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung. Es werden die wichtigsten Vertreter (Marx, Wagner, Wilensky) und ihre zentralen Thesen vorgestellt. Marx' Analyse des Kapitalismus, Wagners Gesetz der steigenden Sozialausgaben und Wilenskys These über den Zusammenhang von Wirtschaftskraft und Wohlfahrtsstaatlichkeit werden erläutert. Die Stärken und Schwächen der Theorie werden diskutiert, insbesondere ihre begrenzte Aussagekraft hinsichtlich parteipolitischer Unterschiede in der Umsetzung von Wohlfahrtspolitik und die Vernachlässigung institutioneller und akteursbezogener Faktoren.
Machtressourcentheorie: Dieses Kapitel behandelt die Machtressourcentheorie, die den Einfluss verschiedener gesellschaftlicher Gruppen mit gegensätzlichen Interessen auf die Staatstätigkeit untersucht. Es wird erläutert, wie Machtressourcen (Organisationskraft, Konfliktfähigkeit, etc.) die politische Gestaltung beeinflussen, wobei Gewerkschaften und sozialdemokratische Parteien eine wichtige Rolle spielen. Im Gegensatz zur Parteiendifferenzthese wirkt die Machtressourcentheorie direkt auf den politischen Prozess. Der Zusammenhang mit der sozioökonomischen Schule wird hergestellt, indem gezeigt wird, wie die Ausprägung des Wohlfahrtsstaates von den jeweiligen Machtressourcen und der Regierungszusammensetzung abhängt.
Institutionalistische Schule: Das Kapitel widmet sich der institutionalistischen Schule und ihrem Fokus auf die Einwirkung von Institutionen auf die Gestaltung und Umsetzung von Policies. Es werden verschiedene Staatsformen (Mehrheits- und Konsensdemokratien) und ihre Auswirkungen auf die politische Dynamik verglichen. Die Rolle von Institutionen als Veto-Spieler (z.B. Bundesrat, Verfassungsgericht, Parteien) und deren Einfluss auf die Häufigkeit von Politikwechseln werden analysiert. Die Bedeutung der Anzahl und der Nähe der Policies der Veto-Spieler wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Staatstätigkeitsforschung, Policy-Analyse, rot-grüne Regierungskoalition (1998-2002), Parteiendifferenzthese, Machtressourcentheorie, sozioökonomische Schule, institutionalistische Schule, Politikwechsel, Wohlfahrtsstaat, Machtressourcen, Institutionen, Veto-Spieler.
Häufig gestellte Fragen zur Analyse des Politikwechsels unter Kanzler Schröder
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert, ob der Regierungswechsel von Kohl zu Schröder (Kabinett Schröder I, 1998-2002) einen grundlegenden Politikwechsel bedeutete. Sie untersucht dies anhand verschiedener Theorien der Staatstätigkeitsforschung und konzentriert sich auf die Frage, warum ein solcher Politikwechsel gegebenenfalls ausblieb.
Welche Theorien werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf die Parteiendifferenzthese, die Machtressourcentheorie, die Theorie der sozioökonomischen Determination, die Politik-Erblast-These und die politisch-institutionalistische Theorie. Sie werden jeweils einzeln vorgestellt und auf die rot-grüne Regierungskoalition angewendet.
Was ist die Kernaussage der sozioökonomischen Schule?
Die sozioökonomische Schule, der älteste Strang der Wohlfahrtsstaatsforschung, betrachtet sozioökonomische Faktoren als Haupttreiber der Staatstätigkeit. Vertreter wie Marx, Wagner und Wilensky werden diskutiert, wobei deren Stärken und Schwächen hinsichtlich der Erklärung parteipolitischer Unterschiede in der Wohlfahrtspolitik hervorgehoben werden.
Welche Rolle spielt die Machtressourcentheorie?
Die Machtressourcentheorie untersucht den Einfluss verschiedener gesellschaftlicher Gruppen mit gegensätzlichen Interessen auf die Staatstätigkeit. Sie betont die Rolle von Machtressourcen (z.B. Organisationskraft, Konfliktfähigkeit) und deren Auswirkung auf den politischen Prozess, insbesondere die Rolle von Gewerkschaften und sozialdemokratischen Parteien.
Welche Bedeutung hat die institutionalistische Schule?
Die institutionalistische Schule fokussiert auf den Einfluss von Institutionen auf die Gestaltung und Umsetzung von Policies. Sie vergleicht verschiedene Staatsformen (Mehrheits- und Konsensdemokratien) und analysiert die Rolle von Institutionen als Veto-Spieler (z.B. Bundesrat, Verfassungsgericht) und deren Einfluss auf Politikwechsel.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, Kapitel zur Sozioökonomischen Schule, zur Machtressourcentheorie und zur Institutionalistischen Schule. Jedes Kapitel fasst die jeweilige Theorie zusammen und wendet sie auf die rot-grüne Regierung an.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit untersucht, ob das Kabinett Schröder I einen grundlegenden Politikwechsel im Vergleich zur Regierungszeit Kohls herbeiführte. Die Einleitung formuliert die These, dass ein solcher grundlegender Politikwechsel ausblieb, und die folgenden Kapitel analysieren, ob und warum dies der Fall war.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind Staatstätigkeitsforschung, Policy-Analyse, rot-grüne Regierungskoalition (1998-2002), Parteiendifferenzthese, Machtressourcentheorie, sozioökonomische Schule, institutionalistische Schule, Politikwechsel, Wohlfahrtsstaat, Machtressourcen, Institutionen und Veto-Spieler.
- Citation du texte
- Alexander Engel (Auteur), 2017, Verschiedene Theorien zur Staatstätigkeitsforschung und ihre Anwendung auf die rot-grüne Koalition 1998-2002, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437207