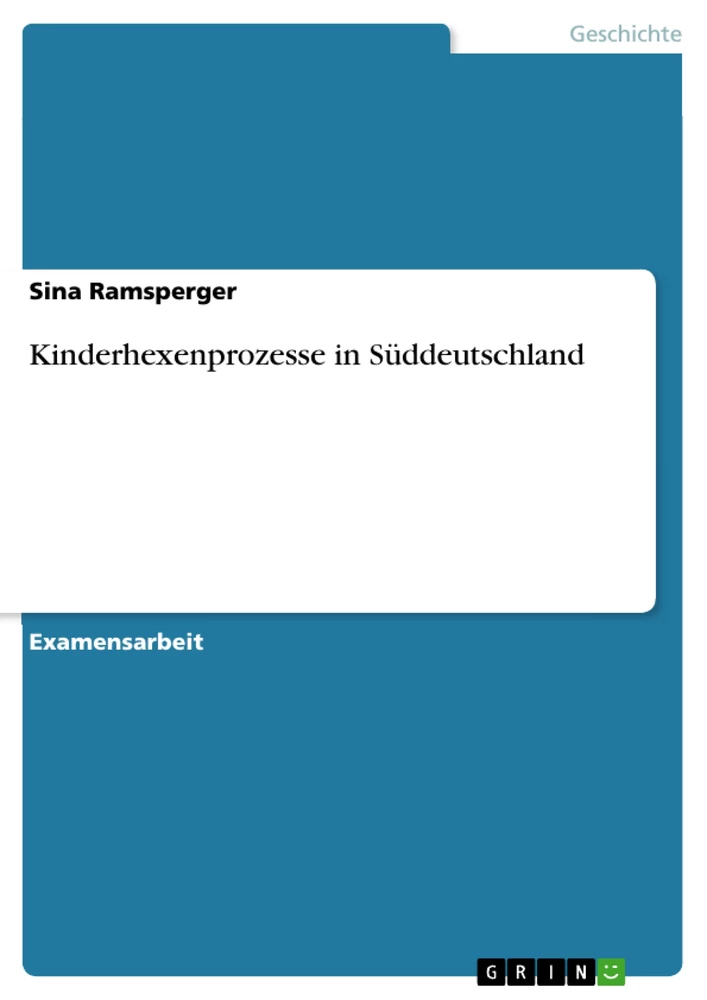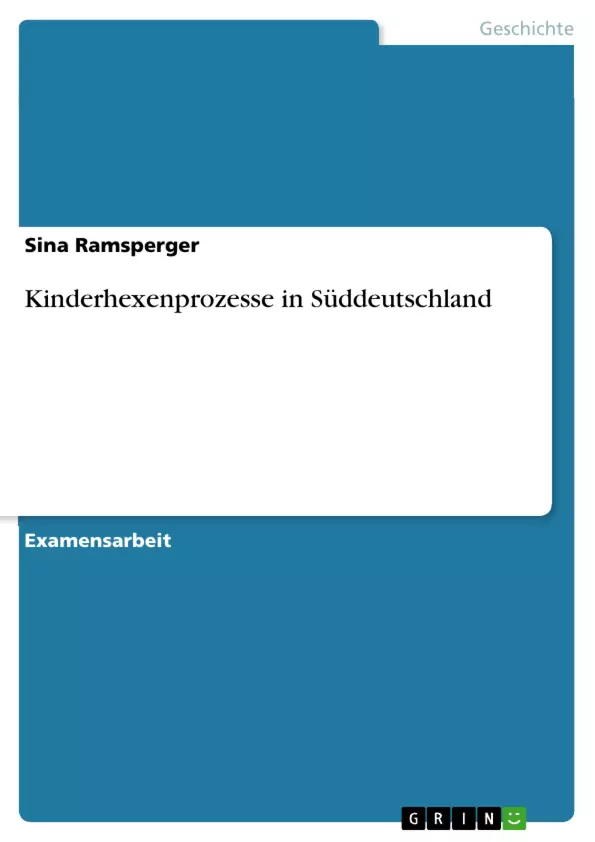Die Arbeit thematisiert das Phänomen der Kinderhexenprozesse an einschlägigen Beispielen im heutigen Süddeutschland in der Frühen Neuzeit. Heutzutage erscheinen Kinder, die unter dem Verdacht der Hexerei standen und deswegen hingerichtet wurden, unmöglich zu sein. Verbrechen gegen Heranwachsende gelten mit als die schlimmste Sorte, denkt man beispielsweise an den Amoklauf von Anders Behring Breivik in Norwegen im Jahr 2011, in dem vor allem Kinder und Jugendliche getötet wurden. Warum also wurden auch Kinder Opfer von Hexenprozessen? Über diese Frage herrscht in der Forschung keinesfalls Konsens. Das Ziel dieser Untersuchung soll es sein, durch eine Darstellung unterschiedlicher Hexenprozesse Gründe herauszuarbeiten, warum gerade auch Kinder eine nicht unerhebliche Rolle in Hexenprozessen gespielt haben. Dabei werden sowohl die Aktivitäten von Minderjährigen als Zeugen in Prozessen beleuchtet, also als Auslöser der Verfolgungen, wie auch ihr Dasein als Beklagte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen - Die Hexenverfolgung im Europa der Frühen Neuzeit
- 2.1 Definitionen
- 2.2 Ausmaße, geographische Schwerpunkte und Phasen
- 2.3 Vorwürfe
- 2.4 Ursachen der Hexenverfolgung
- 2.5 Umgang der Justiz mit vermeintlichen Hexen
- 2.6 Opfer der Hexenverfolgung
- 3. Forschungsüberblick
- 4. Kindheit in der Frühen Neuzeit
- 4.1 Problematik der Definition von „Kindheit“
- 4.2 Kindheit im Mittelalter
- 4.2.1 Kinder aus Randgruppierungen
- 4.2.2 Kinder von Handwerkern und Bauern
- 4.2.3 Kinder aus finanziell besser gestellten Familien
- 4.2.4 Adlige Kinder
- 4.2.5 Kindheit in der geistlichen Laufbahn
- 4.3 Kindheit im 16. und 17. Jahrhundert
- 4.4 Kindheit im 18. Jahrhundert
- 5. Kinder in süddeutschen Hexenprozessen
- 5.1 Das Auftreten von Kindern in Hexenprozessen im Allgemeinen
- 5.2 Rottenburgen am Neckar - Denunziation durch ein Kind
- 5.2.1 Rottenburg am Neckar zur Zeit der Beschuldigung
- 5.2.2 Der Verlauf der Denunziation durch Maria Ulmerin
- 5.2.3 Mögliche Gründe für das Auftreten Maria Ulmerins
- 5.3 Ellwangen – Selbstanzeige einer Sechszehnjährigen
- 5.3.1 Die Fürstpropstei Ellwangen zur Zeit der Beschuldigung
- 5.3.2 Der Verlauf der Selbstdenunziation durch Maria Ostertegin
- 5.3.3 Mögliche Gründe für das Auftreten Maria Ostertegins
- 5.4 Reutlingen - der Fall von Margarethe Schirm
- 5.4.1 Reutlingen zur Zeit der Beschuldigung
- 5.4.2 Der Verlauf der Selbstdenunziation Margarethe Schirms
- 5.4.3 Mögliche Gründe für das Auftreten Margarethe Schirms
- 5.5 Augsburg - ein Vierzehnjähriger schließt einen Pakt mit dem Teufel
- 5.5.1 Augsburg zur Zeit der Beschuldigung
- 5.5.2 Der Verlauf der Beschuldigung von Johann Lutzenberger
- 5.5.3 Mögliche Gründe für das Auftreten Johann Lutzenbergers
- 5.6 Roßwälden bei Esslingen – eine Vierjährige auf dem Hexentanz
- 5.6.1 Roẞwälden zur Zeit der Beschuldigung
- 5.6.2 Der Verlauf der Denunziation durch Anna Maria Hauber
- 5.6.3 Mögliche Gründe für das Auftreten Anna Maria Haubers
- 5.7 Calw eine Denunziation zieht große Kreise
- 5.7.1 Calw zur Zeit der Denunziation durch Veit Jakob Zahn
- 5.7.2 Der Verlauf der Beschuldigung von Bartholomäus Süb
- 5.7.3 Mögliche Gründe für das Auftreten von Bartholomäus Süb
- 5.8. Freising,,Mäuselmacher“ vor Gericht
- 5.8.1 Freising zur Zeit der Hexenverfolgungen
- 5.8.2 Der Verlauf der Beschuldigung von Veit Adlwart
- 5.8.3 Mögliche Gründe für das Auftreten von Veit Adlwart
- 6. Strukturen von Kinderhexenprozessen im Vergleich
- 6.1 Herkunft und Hintergrund der im Prozess beteiligten Kinder
- 6.1.1 Schwierige Familienverhältnisse
- 6.1.2 Armut
- 6.2 Beweggründe
- 6.2.1 Freiwillige Selbstdenunziation
- 6.2.2,,Melancholie“ und „Besessenheit“ als Beweggrund
- 6.2.3 Phantasie und Schwindel
- 6.2.4 Denunziation aus Angst oder als Hilferuf
- 6.2.5 Spiel und Abenteuer
- 6.2.6 Aggression oder Rache
- 6.2.7 Machtstreben und Geltungssucht
- 6.3 Abläufe von Kinderhexenprozessen
- 7. Das Ende der (Kinder-)Hexenprozesse
- 8. Fazit
- Die Rolle von Kindern als Denunzianten und Beklagte in Hexenprozessen
- Die Gründe für das Auftreten von Kindern in Hexenprozessen
- Die Strukturen von Kinderhexenprozessen im Vergleich
- Die Folgen von Kinderhexenprozessen für die Betroffenen und die Gesellschaft
- Die Bedeutung von Kinderhexenprozessen für die heutige Zeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit dem Phänomen von Kinderhexenprozessen in Süddeutschland und untersucht, warum gerade Kinder eine nicht unerhebliche Rolle in den Hexenverfolgungen der Frühen Neuzeit spielten. Dabei werden sowohl die Aktivitäten von Minderjährigen als Zeugen in Prozessen, als Auslöser der Verfolgungen, als auch ihr Dasein als Beklagte beleuchtet.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Kinderhexenprozesse vor und erläutert die Relevanz der Thematik. Die zweite Kapitel widmet sich den Grundlagen der Hexenverfolgung im Europa der Frühen Neuzeit, einschließlich Definitionen, Ausmaß, Vorwürfe, Ursachen und Umgang der Justiz mit vermeintlichen Hexen. Das dritte Kapitel bietet einen Forschungsüberblick. Die Kapitel 4 analysiert die Problematik der Definition von „Kindheit“ und beschreibt die Kindheit in der Frühen Neuzeit. Die Kapitel 5 beleuchtet das Auftreten von Kindern in süddeutschen Hexenprozessen anhand von Beispielen aus verschiedenen Städten und Regionen. Das sechste Kapitel vergleicht die Strukturen von Kinderhexenprozessen und analysiert die Beweggründe der beteiligten Kinder. Das Kapitel 7 befasst sich mit dem Ende der Hexenprozesse und die Kapitel 8 bietet ein Fazit.
Schlüsselwörter
Kinderhexenprozesse, Hexenverfolgung, Frühe Neuzeit, Süddeutschland, Denunziation, Selbstdenunziation, Beweggründe, Strukturen, Kindheit, Magie, Zauberei
- Citar trabajo
- Sina Ramsperger (Autor), 2018, Kinderhexenprozesse in Süddeutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437306