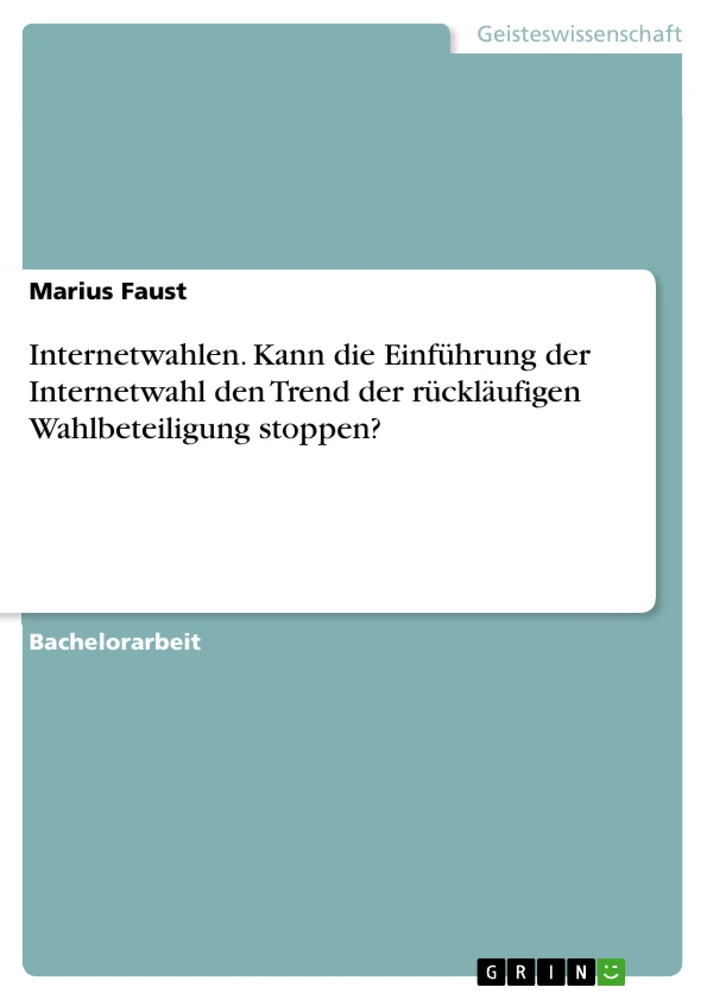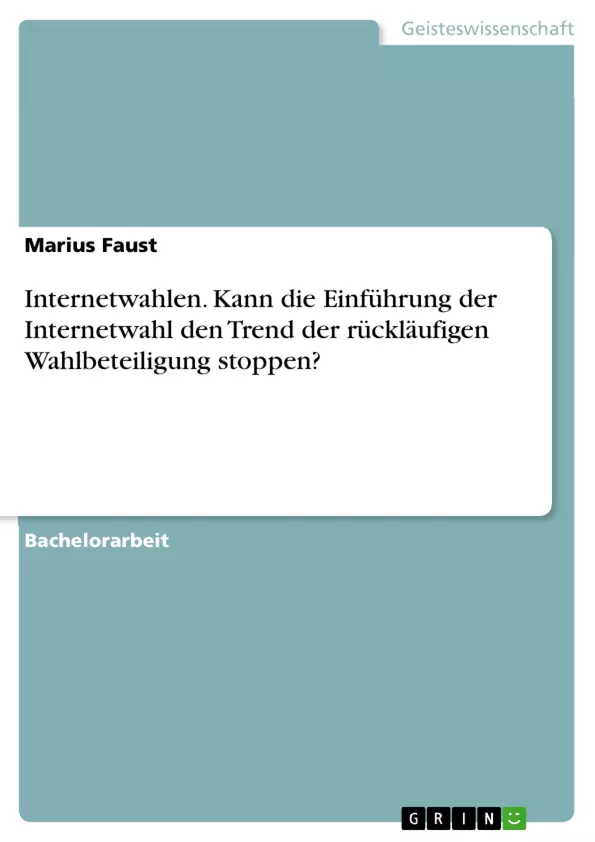Die Bundesrepublik Deutschland unterliegt seit Jahren dem Trend einer rückläufigen Wahlbeteiligung. Die Europawahl sowie die Wahlen in einigen Ländern erreichen teilweise nicht einmal mehr eine Wahlbeteiligung von 50 Prozent. Einige Wissenschaftler und hier speziell Politikwissenschaftler fordern ein Entgegensteuern der Politik, um diesen Trend zu stoppen. Aus diesen Grundüberlegungen heraus entstand die Forschungsfrage dieser Bachelorarbeit. Neben der sinkenden Wahlbeteiligung spielen die Entwicklung der Gesellschaft und das Wahlverhalten einzelner Gruppen eine zentrale Rolle. Unsere Gesellschaft entwickelt sich zunehmend hin zu einer Informations- und Wissensgesellschaft. In fast allen Bereichen der Gesellschaft sind Informations- und Kommunikationstechnologien zu finden. Fast jeder Deutsche verfügt über einen Internetzugang und nutzt diesen auch regelmäßig. Darüber hinaus entstehen ständig neue Technologien, die weitgehend unseren Alltag erleichtern, aber auch bestimmen. Dem einzelnen Individuum wird in Zeiten der Globalisierung eine immer stärkere berufliche und private Flexibilität und Mobilität abgefordert. Aus der Verknüpfung dieser Thematik ergibt sich eine Forschungsrelevanz aus den folgenden drei Faktoren: sinkende Wahlbeteiligung, Omnipräsenz des Internets und sozialer Wandel der Bevölkerung.
Hinsichtlich der Forschungsrelevanz lässt sich somit folgende Forschungsfrage formulieren: „Kann die Einführung der Internetwahl den Trend der rückläufigen Wahlbeteiligung stoppen?“
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gliederung
- 3. Wahlen und Wahlbeteiligung
- 3.1 Politische Partizipation
- 3.2 Wahlbeteiligung in der Bundesrepublik Deutschland seit 1949
- 3.2.1 Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen in der Bundesrepublik
- 3.2.2 Wahlbeteiligung bei Landtagswahlen in der Bundesrepublik
- 3.2.3 Wahlbeteiligung bei Europawahlen in der Bundesrepublik
- 3.2.4 Wahlbeteiligung der Bundesrepublik im internationalen Vergleich
- 4. Der Nichtwähler
- 4.1 Soziologischer Ansatz
- 4.2 Sozialpsychologischer Ansatz
- 4.3 Rationalistischer Ansatz
- 4.4 Nichtwählerkategorien
- 4.5 Ungültige Stimmenabgabe
- 4.6 Zwischenfazit und Ergebnis zur Nichtwählerforschung
- 5. Internetwahlen
- 5.1 ,,Elektronische Demokratie''
- 5.2 Formen von E-Voting
- 5.3 Chancen, Möglichkeiten und Vorteile einer Internetwahl
- 5.4 Sicherheit, Risiken und Nachteile einer Internetwahl
- 5.5 Rechtliche Zulässigkeit einer Internetwahl
- 5.6 Internetwahlen im Fallbeispiel: Estland
- 6. Fazit
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Trend der rückläufigen Wahlbeteiligung in der Bundesrepublik Deutschland und analysiert, ob die Einführung der Internetwahl diesem entgegenwirken könnte. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte der politischen Partizipation, insbesondere die Wahlbeteiligung in der Bundesrepublik und den Anteil der Nichtwähler.
- Entwicklung der Wahlbeteiligung in Deutschland
- Ursachen für Nichtwählerverhalten
- Konzept der Internetwahl und "elektronischen Demokratie"
- Chancen und Risiken der Internetwahl
- Rechtliche Rahmenbedingungen und internationale Beispiele
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 3 definiert und analysiert die Wahlen und die Wahlbeteiligung in der Bundesrepublik Deutschland, wobei der Wahlakt im Zusammenhang mit anderen Formen der politischen Partizipation betrachtet wird. Kapitel 4 untersucht die Ursachen für Nichtwählerverhalten unter Einbezug verschiedener wissenschaftlicher Theorien. Kapitel 5 stellt die Internetwahl im Kontext der "elektronischen Demokratie" vor, analysiert Chancen und Risiken sowie die rechtliche Situation und behandelt das Beispiel Estlands, wo Internetwahlen bereits etabliert sind.
Schlüsselwörter
Wahlbeteiligung, Nichtwähler, Internetwahl, E-Voting, Elektronische Demokratie, politische Partizipation, Wahlrecht, Wahlsystem, Estland.
Häufig gestellte Fragen
Kann die Internetwahl die Wahlbeteiligung erhöhen?
Wissenschaftler diskutieren, ob die Bequemlichkeit der Online-Wahl Nichtwähler mobilisieren kann, wobei Erfahrungen aus Ländern wie Estland gemischte Ergebnisse zeigen.
Welche Risiken gibt es bei Internetwahlen?
Zentrale Bedenken betreffen die Datensicherheit, die Gefahr von Hackerangriffen, den Schutz des Wahlgeheimnisses und die Manipulierbarkeit der Software.
Ist eine Online-Wahl in Deutschland rechtlich zulässig?
Das Bundesverfassungsgericht hat hohe Hürden gesetzt; insbesondere muss die Nachvollziehbarkeit der Wahlhandlung für jeden Bürger ohne Expertenwissen gewährleistet sein.
Was können wir vom Fallbeispiel Estland lernen?
Estland ist Vorreiter beim E-Voting. Es zeigt, dass technisches Vertrauen und eine digitale Infrastruktur essenziell sind, aber die Wahlbeteiligung nicht automatisch massiv ansteigt.
Welche Ansätze erklären das Verhalten von Nichtwählern?
Es gibt soziologische, sozialpsychologische und rationalistische Ansätze, die Faktoren wie soziale Entwurzelung, fehlendes politisches Interesse oder Kosten-Nutzen-Abwägungen untersuchen.
- Arbeit zitieren
- Marius Faust (Autor:in), 2016, Internetwahlen. Kann die Einführung der Internetwahl den Trend der rückläufigen Wahlbeteiligung stoppen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437397