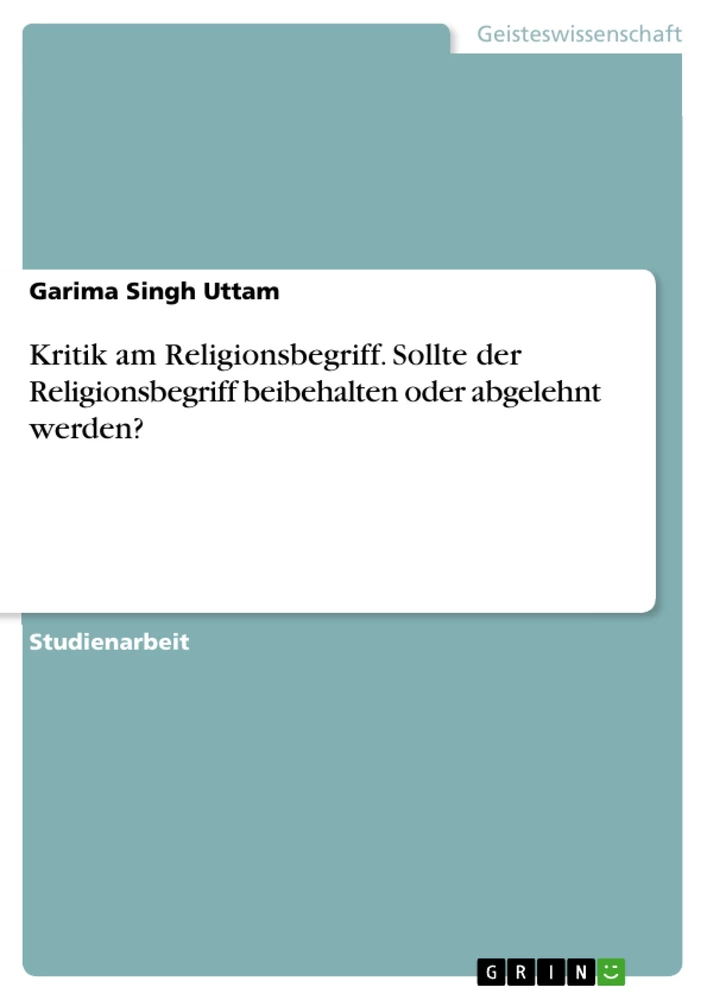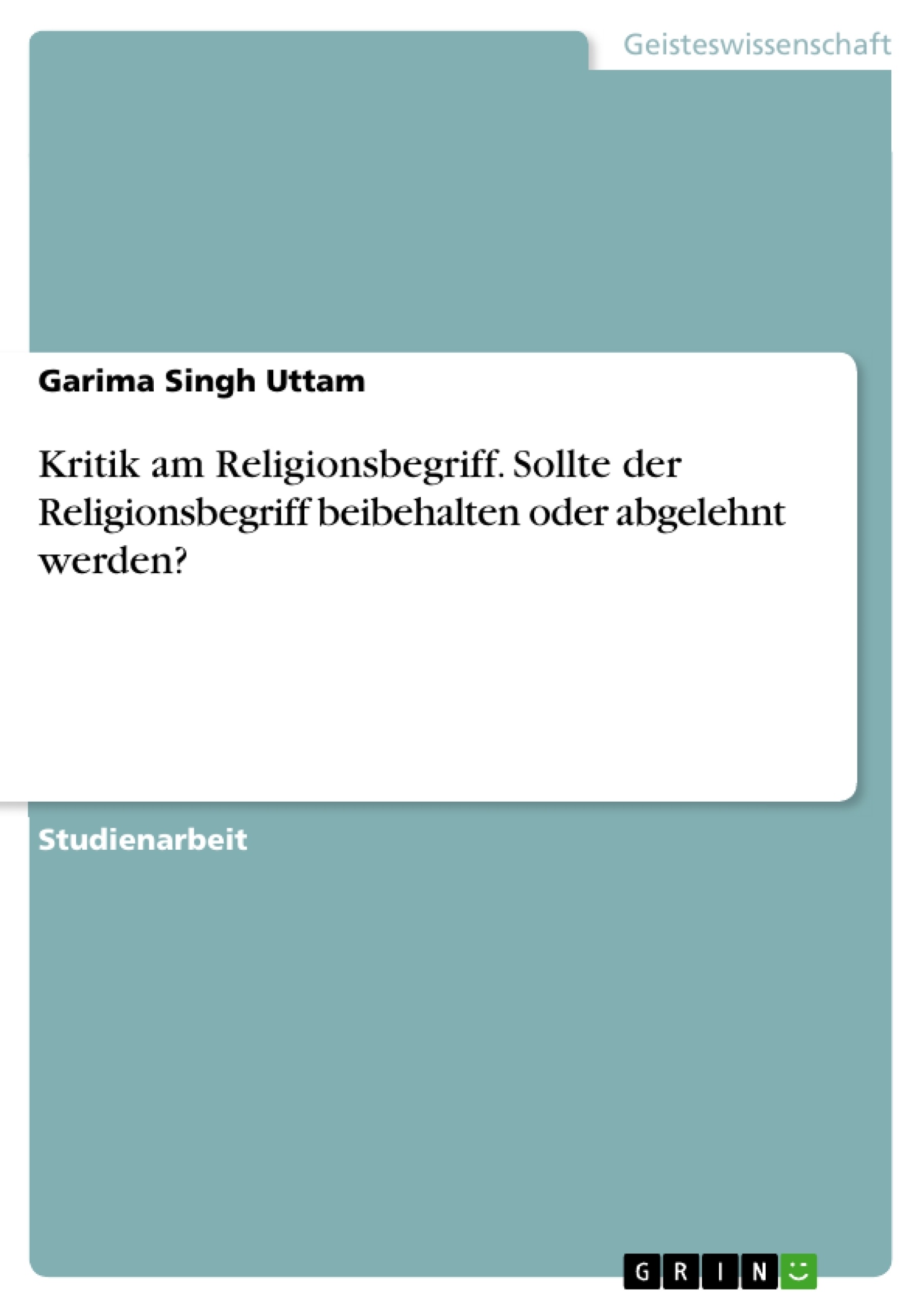Das größte Problem an der Religion ist der Begriff der Religion selbst. Die Religionssoziologie sucht nach einer allgemeingültigen Definition, mit deren Hilfe sie die Religion wissenschaftlich untersuchen kann. Auch Roland Robertson (1973) sagte aus, „dass wir (die Soziologen) nicht auf der Suche nach dem Wesen der Religion sind, (…), sondern vielmehr eine soziologische Definition anstreben, mit deren Hilfe wir klar und schlüssig analysieren können“. Es geht also nicht vorrangig um die Diskussion ob sich die Religion inhaltlich als wahr erweist, sondern um eine universelle Definition des Begriffs.
Da es zahlreiche Definitionen des Begriffs Religion gibt, fällt es nicht leicht sich auf die eine richtige Definition festzulegen, dadurch ergibt sich in den Sozialwissenschaften eine Definitionspluralität. Diese Vielzahl an Definitionen führt bei einigen Soziologen dazu, dass sie komplett auf eine Definition verzichten wollen. Doch diese Vorgehensweise, gänzlich auf eine Definition zu verzichten, würde jegliche wissenschaftliche Diskussionen ersticken und womöglich zu noch größerer Verwirrung führen. Abgesehen davon ist das Definieren des Religionsbegriffs wichtig um empirisch korrekte Untersuchungen vornehmen zu können.
In dieser Arbeit soll vordergründig die Frage untersucht werden ob der Religionsbegriff beibehalten oder abgelehnt werden sollte.
Dazu werden zunächst im folgenden Kapitel dieser Arbeit einige Definitionsversuche des Religionsbegriffs aufgeführt, um einen kleinen Einblick in die Definitionsvielfalt zu ermöglichen und eine Grundlage für die folgenden Punkte der Arbeit zu schaffen. Die Geschichte der westlichen Moderne brachte 4 verschiedene Epochen von Religionsdiskursen hervor, diese sollen im dritten Kapitel knapp erläutert werden. Anschließend gehe ich über zu dem Punkt 3.5. „Kritik am Religionsbegriff“, wobei ich besonders auf die postmoderne, koloniale und diskurstheoretische Kritik eingehe.
Abschließend wird im letzten Teil der Arbeit auf die Fragestellung eingegangen, dazu betrachte ich zunächst die Probleme die bei der Definition von Religion auftreten. Ihren Abschluss findet die Arbeit dann in einem kurzen Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionsversuche von Religion
- Nach Emile Durkheim
- Nach Max Weber
- Nach Michael Hill
- Nach Gert Pickel
- Schlussfolgerung
- Moderne Religionsdiskurse
- Aufklärungsdiskurs
- Romantischer Diskurs
- Säkularisierungsdiskurs
- Postmoderner Diskurs
- Kritik am Religionsbegriff
- Postmoderne Kritik
- Koloniale Kritik
- Diskurstheoretische Kritik
- Sollte der Religionsbegriff beibehalten oder abgelehnt werden?
- Probleme bei der Definition von Religion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob der Religionsbegriff beibehalten oder abgelehnt werden sollte. Sie analysiert verschiedene Definitionsversuche des Religionsbegriffs und beleuchtet die Herausforderungen, die sich bei einer eindeutigen Definition ergeben. Dabei werden auch unterschiedliche Kritikpunkte an der Verwendung des Religionsbegriffs im Kontext der Moderne beleuchtet.
- Die Vielfältigkeit der Definitionsversuche des Religionsbegriffs
- Die Herausforderungen bei der Suche nach einer universalen Definition
- Die kritische Auseinandersetzung mit dem Religionsbegriff in modernen Diskursen
- Die Rolle der Religion in der Gesellschaft und ihre Wechselwirkung mit sozialen Strukturen
- Die Bedeutung des Religionsbegriffs für die wissenschaftliche Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel der Arbeit wird die Problematik des Religionsbegriffs in der Religionssoziologie aufgezeigt und die Suche nach einer allgemeingültigen Definition erläutert. Das zweite Kapitel stellt verschiedene Definitionsversuche des Religionsbegriffs vor, darunter die Ansätze von Emile Durkheim, Max Weber, Michael Hill und Gert Pickel. Kapitel 3 beleuchtet vier verschiedene Epochen von Religionsdiskursen in der westlichen Moderne und geht insbesondere auf die postmoderne, koloniale und diskurstheoretische Kritik am Religionsbegriff ein.
Schlüsselwörter
Religionsbegriff, Religionsdefinition, Religionssoziologie, Moderne, Postmoderne, Koloniale Kritik, Diskurstheorie, Säkularisierung, Transzendenz, Religion und Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Definition von „Religion“ in der Soziologie so schwierig?
Es herrscht eine Definitionspluralität. Da es keine universelle Einigung gibt, was Religion genau umfasst, fällt es schwer, eine wissenschaftlich allgemeingültige Basis für empirische Untersuchungen zu finden.
Sollte man gänzlich auf den Religionsbegriff verzichten?
Einige Soziologen fordern dies, doch die Arbeit argumentiert, dass ein Verzicht jegliche wissenschaftliche Diskussion ersticken und zu größerer Verwirrung führen würde.
Welche klassischen Religionsdefinitionen werden vorgestellt?
Es werden die Ansätze von Emile Durkheim, Max Weber, Michael Hill und Gert Pickel erläutert.
Was ist die „koloniale Kritik“ am Religionsbegriff?
Diese Kritik besagt, dass der westliche Religionsbegriff oft anderen Kulturen aufgezwungen wurde und dabei lokale spirituelle Praktiken verzerrt oder abgewertet hat.
Welche vier Epochen der Religionsdiskurse gibt es?
Die Arbeit unterscheidet zwischen dem Aufklärungsdiskurs, dem romantischen Diskurs, dem Säkularisierungsdiskurs und dem postmodernen Diskurs.
- Quote paper
- Garima Singh Uttam (Author), 2017, Kritik am Religionsbegriff. Sollte der Religionsbegriff beibehalten oder abgelehnt werden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437514