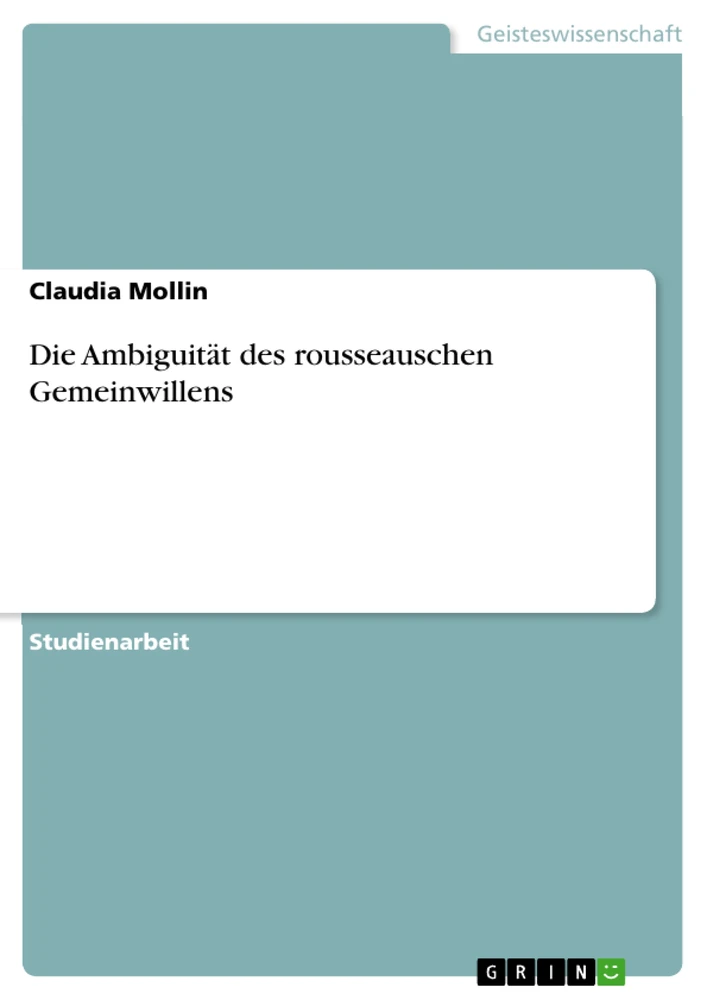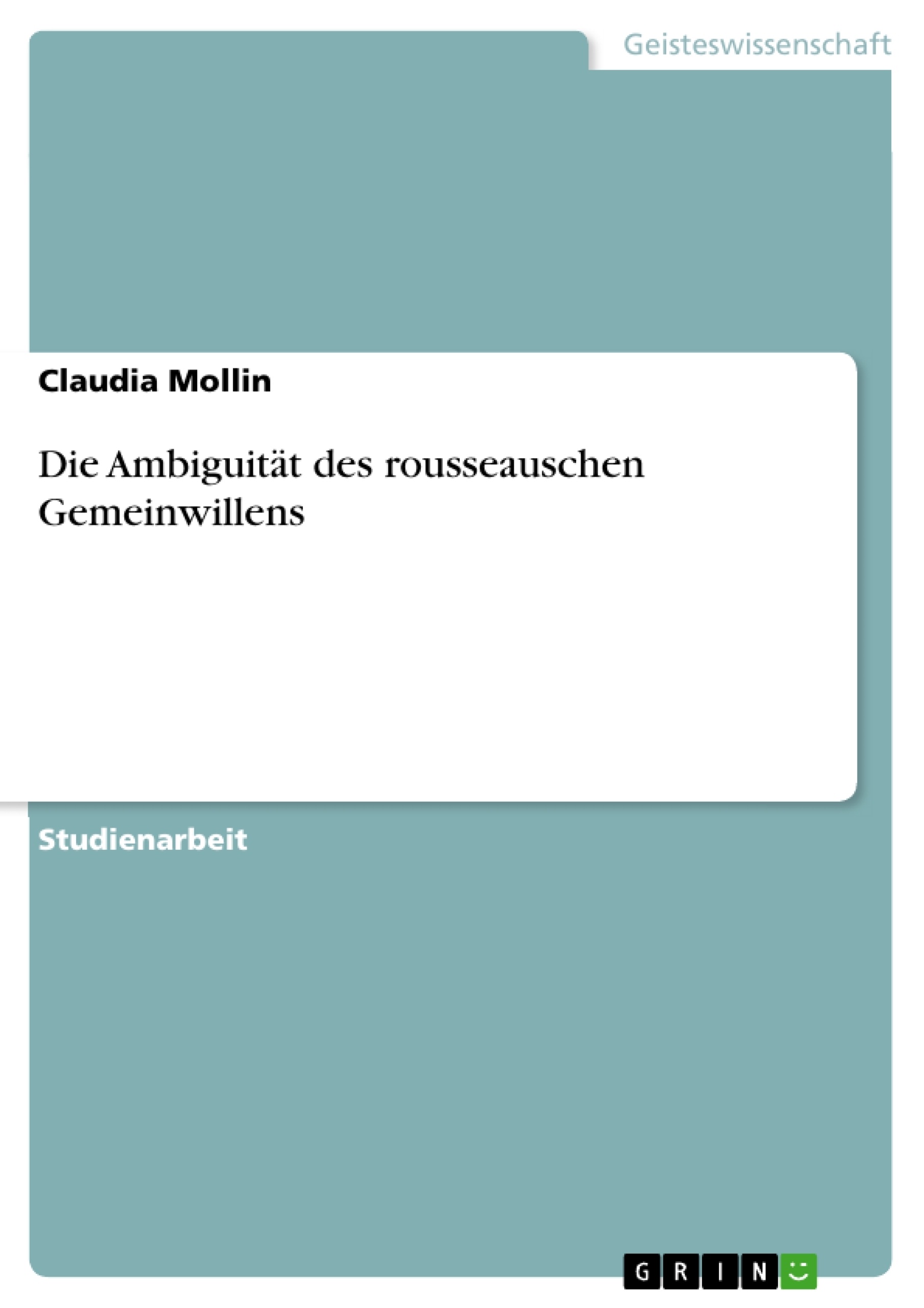Wird Rousseau's Werk: "Vom Gesellschaftsvertag", trotz der ihm zugrundeliegenden Konzeption eines allgemeinen Volkswillens, welcher sowohl totalitäre, als auch anti-totalitäre Elemente impliziert, überhaupt seinem demokratischen Anspruch gerecht?
Diese Hausarbeit geht dieser Frage nach und mündet schließlich in einer differenzierten Konklusion, welche dem demokratischen Wert des Gesellschaftsvertrages gerecht wird. Gleichzeitig werden relevante, durchaus berechtigte Kritikpunkte an der rousseauschen Konzeption des Gemeinwillens berücksichtigt.
Inhaltsverzeichnis
- I.) Einleitung
- 1.1. Vorstellung der Ausgangsfrage
- 1.2. Relevanz der Fragestellung
- II.) Hauptteil
- 2.Das Konzept des Gemeinwillens
- 2.1. Definition: „Gemeinwille“
- 2.2.Definition: „Gemeinwohl“
- 2.3.Signifikanz des Gemeinwillens
- 2.4.Zwei Deutungsmöglichkeiten der volonté générale und deren historische Konsequenzen:
- 2.4.1 die subversiv-demokratische Deutung
- 2.4.2 die totalitäre Deutung
- 3. Demokratie
- 3.1. Definition: „Demokratie
- 3.2. Zwei Demokratietheorien:
- 3.2.1 „Identitätstheorie“
- 3.2.2 „Konkurrenztheorie“
- III.) Schluss
- Fazit/ Beantwortung der Ausgangsfrage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Ambiguität des rousseauschen Gemeinwillens und dessen potenziellen Missbrauch in der selektiven Rezeption seines Werkes "Vom Gesellschaftsvertrag". Das zentrale Anliegen ist die Frage, ob Rousseaus Konzept des Gemeinwillens, das sowohl demokratische als auch totalitäre Elemente enthält, seinem demokratischen Anspruch gerecht wird.
- Die Ambiguität des Gemeinwillens im Werk von Rousseau
- Die subversiv-demokratische und die totalitäre Deutungsmöglichkeit des Gemeinwillens
- Der Einfluss des rousseauschen Gedankenguts auf die Französische Revolution
- Die Gefahr einer selektiven Rezeption von Rousseaus "Gesellschaftsvertrag"
- Die Unterscheidung zwischen dem damaligen und dem heutigen Demokratieverständnis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Ausgangsfrage vor: Kann Rousseaus "Vom Gesellschaftsvertrag", trotz der Konzeption des Gemeinwillens, die sowohl totalitäre als auch anti-totalitäre Aspekte umfasst, seinem demokratischen Anspruch gerecht werden? Die Relevanz der Fragestellung liegt in der Ambiguität des rousseauschen Konzepts, das zu unterschiedlichen Interpretationen und Rezeptionen führt.
Der Hauptteil untersucht zunächst das Konzept des Gemeinwillens, definiert die Begriffe „Gemeinwille“ und „Gemeinwohl“ und beleuchtet die Signifikanz des Gemeinwillens für Rousseaus Theorie. Im weiteren Verlauf werden zwei Deutungsmöglichkeiten der volonté générale und deren historische Konsequenzen aufgezeigt: die subversiv-demokratische Deutung und die totalitäre Deutung. Schließlich wird die Definition von „Demokratie“ erörtert, wobei zwei Demokratietheorien, die „Identitätstheorie“ und die „Konkurrenztheorie“, vorgestellt werden.
Schlüsselwörter
Gemeinwille, volonté générale, Gesellschaftsvertrag, Demokratie, Französische Revolution, subversiv-demokratische Deutung, totalitäre Deutung, Identitätstheorie, Konkurrenztheorie, politische Philosophie.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Rousseau unter dem "Gemeinwillen" (volonté générale)?
Der Gemeinwille ist der auf das Gemeinwohl ausgerichtete Wille des Volkes, der über den reinen Partikularinteressen der Einzelnen steht.
Warum wird Rousseaus Konzept als "ambivalent" bezeichnet?
Weil es sowohl radikal-demokratische Elemente (Volkssouveränität) als auch totalitäre Züge (Zwang zur Freiheit, Unterordnung unter das Kollektiv) enthält.
Was ist der Unterschied zwischen Identitätstheorie und Konkurrenztheorie?
Die Identitätstheorie geht von einem einheitlichen Volkswillen aus, während die Konkurrenztheorie (Pluralismus) den Wettstreit verschiedener Interessen als Kern der Demokratie sieht.
Welchen Einfluss hatte Rousseau auf die Französische Revolution?
Seine Ideen lieferten die theoretische Basis für den Umsturz der absolutistischen Herrschaft, wurden aber auch zur Rechtfertigung der Schreckensherrschaft (Terreur) herangezogen.
Kann der "Gesellschaftsvertrag" heute noch als demokratisch gelten?
Die Arbeit kommt zu einer differenzierten Konklusion, die seinen Wert für die Volkssouveränität anerkennt, aber vor einer selektiven, totalitären Interpretation warnt.
- Arbeit zitieren
- Claudia Mollin (Autor:in), 2018, Die Ambiguität des rousseauschen Gemeinwillens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437733