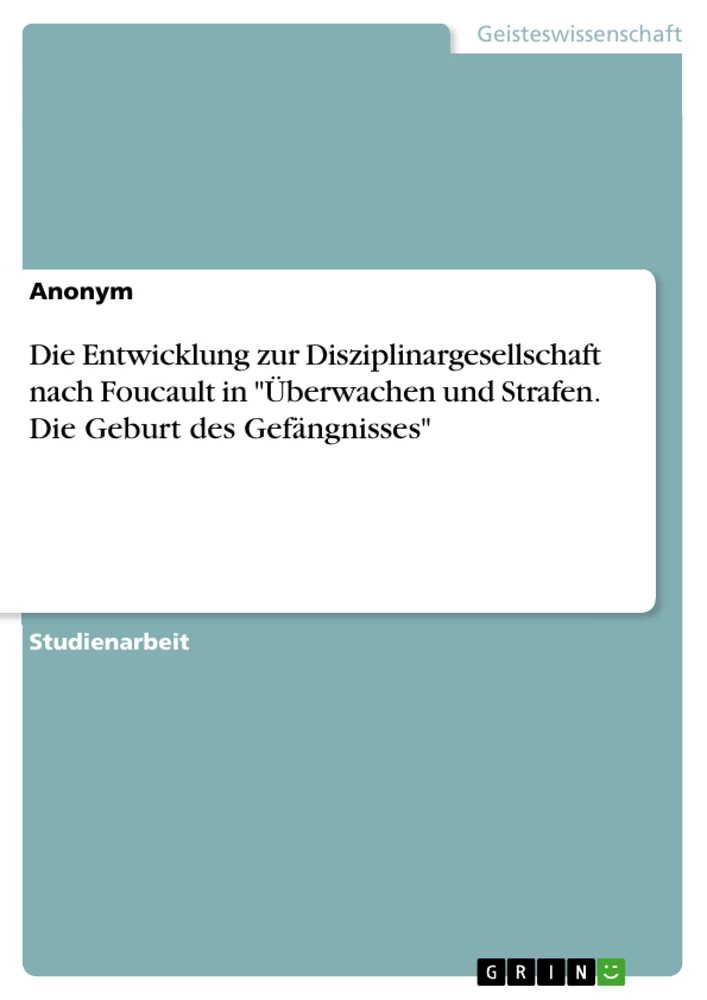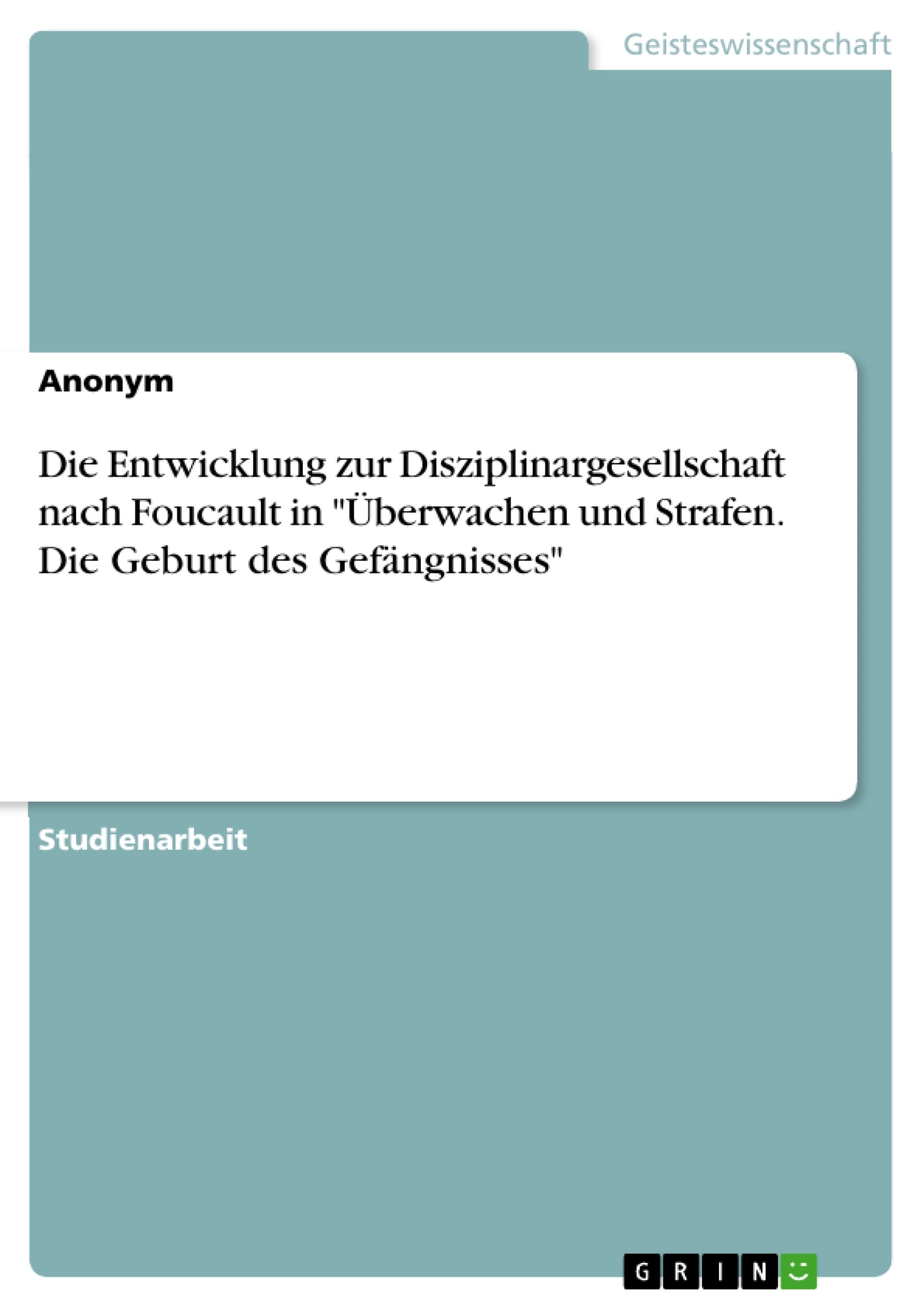Die vorliegende Thesis beschäftigt sich mit der Darstellung des Werkes "Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses", des Philosophen Michel Foucault, aus dem Jahre 1975. Hierbei soll der Fokus primär auf der historischen Entwicklung von der Marter- und Folterstrafe zu einer Disziplinargesellschaft liegen. Interessant für die Analyse ist hierbei, dass sich jegliche Ansätze, des von Foucault kritisierten Strafvollzugs des 19. Jahrhunderts, im heutigen Strafsystem wieder finden. Eben diese Strafanstalten sollen in dieser Arbeit näher betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überblick in Foucaults Werk
- Exkurs: Über die Macht
- Die Marter
- Ein verändertes Strafsystem
- Besserung der Seele anstatt Folter und Strafe
- Formen der Disziplinierung
- Macht und Körper
- Parzellierung
- Das Panoptikum
- Institution Gefängnis
- Kritik am Gefängnis
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Michel Foucaults Werk „Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses“ und untersucht die Entwicklung von der Marter- und Folterstrafe zu einer Disziplinargesellschaft. Der Fokus liegt dabei auf der Kritik am Strafvollzug des 19. Jahrhunderts und dessen Relevanz für das heutige Strafsystem.
- Historische Entwicklung des Strafsystems
- Die Machtmechanismen der Disziplinargesellschaft
- Der Einfluss von Foucaults Werk auf das Strafvollzugssystem
- Kritik am Gefängnis als Institution der Disziplinierung
- Foucaults Konzept der Macht und dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt das Werk von Michel Foucault und seine Kernaussagen zum Strafvollzug vor.
- Überblick in Foucaults Werk: Dieser Abschnitt bietet eine kurze Einführung in Foucaults philosophische Ansätze und seine zentralen Thesen über Macht und Disziplin.
- Die Marter: In diesem Kapitel werden die Martermethoden des 18. Jahrhunderts als ein Beispiel für die Macht des Staates und die öffentliche Demonstration von Strafe beschrieben.
- Ein verändertes Strafsystem: Hier wird die Entstehung des modernen Strafvollzugs im 19. Jahrhundert mit dem Fokus auf die Entwicklung von Gefängnissen und der Überwachungsfunktion beleuchtet.
- Besserung der Seele anstatt Folter und Strafe: Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit dem Wandel von Strafe hin zu einem System der Besserung und Rehabilitation des Gefangenen.
- Formen der Disziplinierung: Dieser Abschnitt stellt die verschiedenen Formen der Disziplinierung vor, die von Foucault als Mechanismen der Machtausübung in der Gesellschaft identifiziert werden.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Überwachen und Strafen, Disziplinargesellschaft, Gefängnis, Macht, Foucault, Marter, Folter, Strafvollzug, Körper, Panoptikum, Biomacht, Gouvernementalität, Transformation. Diese Begriffe sind zentral für das Verständnis von Foucaults Analyse der modernen Gesellschaft und den Auswirkungen von Macht auf Individuen und Institutionen.
Häufig gestellte Fragen
Was beschreibt Foucault mit dem Begriff der „Marter“?
Die Marter bezeichnet die öffentliche Folterstrafe des Ancien Régime, die als Machtdemonstration des Souveräns am Körper des Verurteilten vollzogen wurde.
Was versteht Foucault unter der „Disziplinargesellschaft“?
Es ist eine Gesellschaftsform, in der Macht nicht mehr durch sichtbare Gewalt, sondern durch subtile Überwachung, Normierung und die Abrichtung des Körpers in Institutionen (Schule, Kaserne, Fabrik) ausgeübt wird.
Was ist das Panoptikum?
Ein von Jeremy Bentham entworfenes Gefängnismodell, bei dem ein Wärter alle Gefangenen beobachten kann, ohne selbst gesehen zu werden. Für Foucault ist es das Symbol moderner Überwachungsmacht.
Warum änderte sich das Strafsystem im 19. Jahrhundert?
Anstatt den Körper zu quälen, zielte die neue Strafe auf die „Besserung der Seele“. Das Gefängnis wurde zur zentralen Institution, um Individuen durch Arbeit und Disziplin zu normalisieren.
Warum kritisiert Foucault das Gefängnis?
Foucault sieht im Gefängnis keine humane Verbesserung, sondern eine Perfektionierung der Macht, die Delinquenz produziert und zur allgemeinen Überwachung der Gesellschaft beiträgt.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2014, Die Entwicklung zur Disziplinargesellschaft nach Foucault in "Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/440836