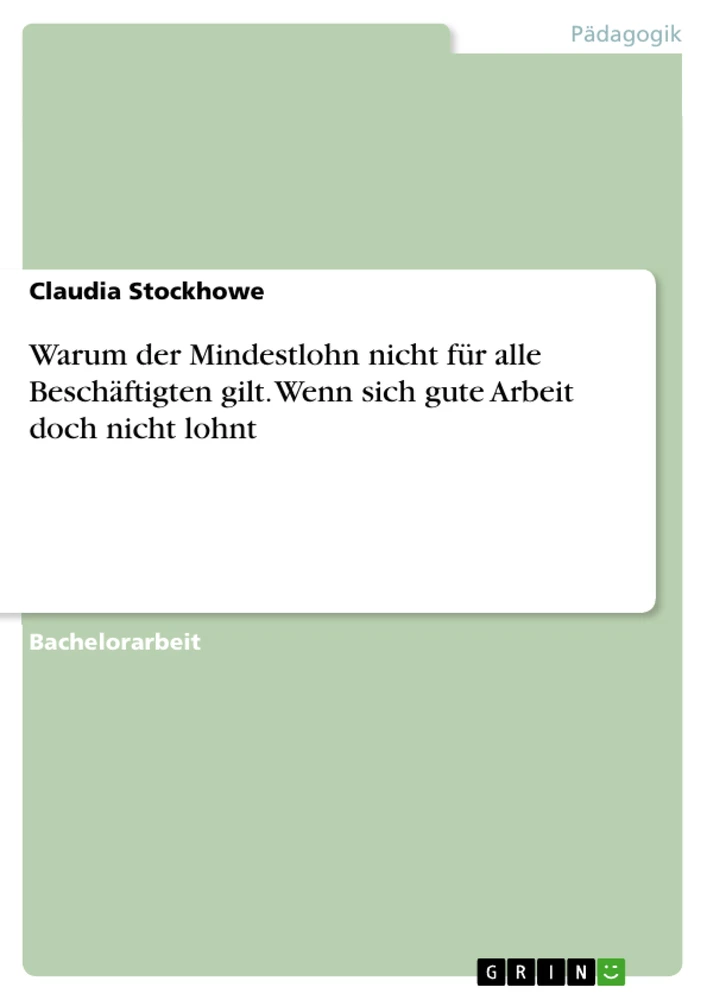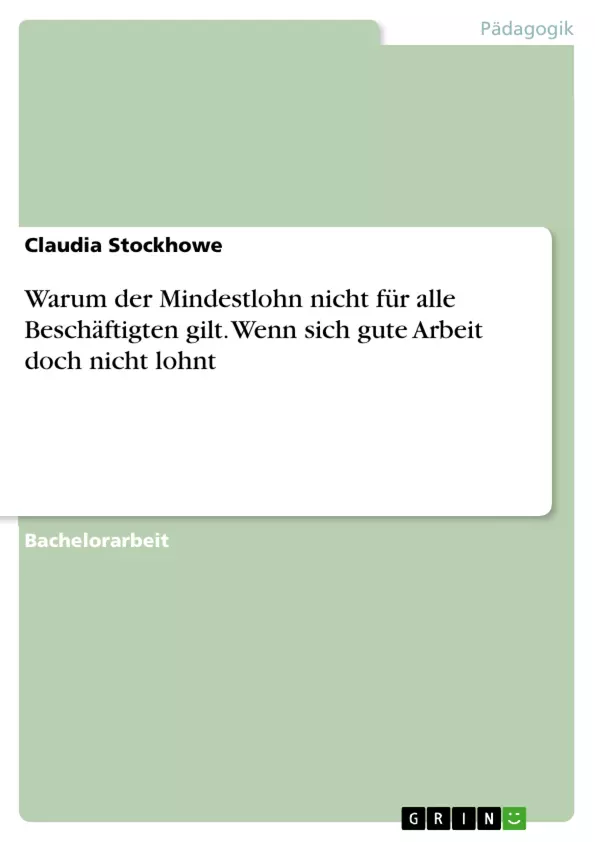Als die Ergebnisse der Bundestagswahl 2013 feststanden, wurde deutlich, dass die CDU/CSU als weiterhin stärkste Kraft nicht mehr auf ihren bisherigen Koalitionspartner FPD, der an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte, zurückgreifen konnte. Es begann die Suche nach einem neuen Koalitionspartner für die 18. Legislaturperiode. Zur Auswahl standen die SPD und das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die zum damaligen Zeitpunkt nur vereinzelt auf Länderebene bereits mit der CDU koalierten. Die Sondierungsgespräche ergaben eine Tendenz zur SPD und entsprechend selbstbewusst trat die SPD, mangels Alternativen der CDU/CSU, in den Koalitionsverhandlungen auf.
Die Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns, ein zentrales Anliegen der SPD im Wahlkampf, wurde gefordert. Diese Forderung fand ihren Weg in den Koalitionsvertrag vom 14. Dezember 2013. Es wurde die Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns in Höhe von 8,50€/h zum 01.01.2015 vereinbart. Ein entsprechendes Gesetz sollte im Dialog mit den Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern ausgearbeitet werden. Ziel war es, dass gute Arbeit sich wieder lohnen und existenzsichernd sein muss. Jedem Arbeitnehmer sollte von seinen Erwerbseinkünften ein Leben ohne staatliche Transferleistungen ermöglicht werden.
Laut Mindestlohngesetz (MiLoG) gilt das Recht auf existenzsichernde Entlohnung ab dem 01.01.2015 allerdings nicht für alle Arbeitnehmer und Beschäftigten. Im Anwendungsbereich werden z.B. Praktikanten, Langzeitarbeitslose in den ersten sechs Beschäftigungsmonaten und Jugendliche unter 18 Jahren als Bezugsberechtigte ausgeschlossen, für andere Gruppen wurden Übergangsfristen vereinbart. Von politikwissenschaftlichem Interesse ist dieser Umstand besonders, da per Gesetzbeschluss die gleiche Arbeit, verrichtet von unterschiedlichen Personengruppen, pauschal schlechter als 8,50€ pro Stunde entlohnt werden darf.
Die Abschlussarbeit geht der Frage nach, wie es zu der Einführung des Mindestlohngesetzes in seiner aktuellen Form mit der Begrenzung im Anwendungsbereich und den Übergangsfristen gekommen ist. Es soll analysiert werden, welchen Einflüssen das MiLoG ausgesetzt war, die dazu führten, dass bestimmte Personengruppen per Gesetzesbeschluss von dem Recht auf existenzsichernde Vergütung ausgeschlossen werden oder erst mit zeitlicher Verzögerung vom Mindestlohn profitieren durften, obwohl es das Bestreben der Regierungsparteien war, dass gute Arbeit sich wieder lohnen und existenzsichernd sein soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Begriffsdefinitionen
- Die Parteiendifferenzhypothese
- Die Machtressourcentheorie
- Das Mindestlohngesetz
- Ausgangslage und Notwendigkeit
- Die Begrenzung der Bezugsberechtigten
- Das Policy-Design des Mindestlohngesetzes
- Parteiendifferenz bei der Implementierung und Ausgestaltung des Mindestlohngesetzes
- Ideologie und Kernwählerschaft der Parteien
- Der Wahlkampf 2013
- Die Koalitionsverhandlungen
- Der Gesetzgebungsprozess
- Zwischenfazit: Koalitionszwänge begrenzen Parteiendifferenz
- Der Einfluss der Interessenvertretungen auf die Ausgestaltung des Mindestlohngesetzes
- Machtressourcen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter
- Positionierung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter
- Zwischenfazit: Machtressourcen ermöglichen Einflussnahme
- Parteiendifferenz bei der Implementierung und Ausgestaltung des Mindestlohngesetzes
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit analysiert die Einführung des Mindestlohngesetzes in Deutschland im Jahr 2015 und untersucht, warum bestimmte Personengruppen von dessen Anwendung ausgeschlossen oder zeitlich verzögert profitieren durften, obwohl die Regierungsparteien eine existenzsichernde Entlohnung für alle Arbeitnehmer anstrebten. Im Zentrum stehen die Einflüsse der Parteiendifferenz und der Machtressourcen der Interessenvertretungen auf das Policy-Design des Gesetzes.
- Einfluss der Parteiendifferenz auf die Ausgestaltung des Mindestlohngesetzes
- Rolle der Interessenvertretungen (Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter) beim Policy-Design
- Analyse der Machtressourcen der Interessenvertretungen
- Bedeutung von Koalitionszwängen für die Umsetzung des Mindestlohns
- Untersuchung der politischen Ideologien und Interessen der Kernwählerschaft verschiedener Parteien
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Bachelorarbeit ein und erläutert die Relevanz des Mindestlohngesetzes im Kontext der politischen Entwicklungen in Deutschland. Sie stellt die Forschungsfrage und die zu untersuchenden Hypothesen vor.
- Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Konzepte, die zur Analyse der Forschungsfrage herangezogen werden. Es definiert zentrale Begriffe, wie „Parteiendifferenz“ und „Machtressourcen“, und stellt die Parteiendifferenzhypothese und die Machtressourcentheorie vor.
- Das Mindestlohngesetz: Dieses Kapitel behandelt die Einführung des Mindestlohngesetzes in Deutschland und stellt dessen Ausgangslage sowie die Notwendigkeit dar. Es beleuchtet auch die Einschränkungen im Anwendungsbereich und die zeitlichen Übergangsfristen, die bestimmte Personengruppen vom unmittelbaren Bezug des Mindestlohns ausschlossen.
- Das Policy-Design des Mindestlohngesetzes: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss verschiedener Faktoren auf die Ausgestaltung des Mindestlohngesetzes. Es analysiert die Rolle der Parteiendifferenz im Implementierungsprozess und die Machtressourcen der Interessenvertretungen bei der Gestaltung des Gesetzes.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse des Policy-Designs des Mindestlohngesetzes in Deutschland. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind daher: Mindestlohn, Parteiendifferenz, Machtressourcen, Interessenvertretungen, Policy-Design, Koalitionszwänge, Ideologie, Kernwählerschaft, Anwendungsbereich, Übergangsfristen.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt der Mindestlohn nicht für alle Arbeitnehmer?
Bei der Einführung des Mindestlohngesetzes (MiLoG) wurden Ausnahmen für bestimmte Gruppen wie Praktikanten, Langzeitarbeitslose in den ersten sechs Monaten und Jugendliche unter 18 Jahren festgelegt, oft begründet durch arbeitsmarktpolitische Erwägungen.
Welchen Einfluss hatten die Koalitionsverhandlungen 2013?
Der Mindestlohn war ein zentrales Wahlversprechen der SPD. In den Koalitionsverhandlungen mit der CDU/CSU mussten jedoch Kompromisse eingegangen werden, die zu den heutigen Ausnahmeregelungen und Übergangsfristen führten.
Was besagt die Parteiendifferenzhypothese in diesem Kontext?
Diese Theorie besagt, dass die Ausgestaltung von Gesetzen stark von der Ideologie der regierenden Parteien abhängt. Während die SPD den Mindestlohn forcierte, drängten unionsgeführte Interessen auf Ausnahmen zum Schutz der Wirtschaft.
Wie beeinflussten Interessenverbände das Mindestlohngesetz?
Arbeitgeberverbände nutzten ihre Machtressourcen, um vor möglichen Jobverlusten zu warnen, was zur Implementierung von Übergangsfristen und Ausnahmen für bestimmte Branchen und Personengruppen beitrug.
Was war das ursprüngliche Ziel des flächendeckenden Mindestlohns?
Ziel war es, dass „gute Arbeit“ existenzsichernd sein muss und Arbeitnehmer ein Leben führen können, ohne auf zusätzliche staatliche Transferleistungen angewiesen zu sein.
- Citar trabajo
- Claudia Stockhowe (Autor), 2017, Warum der Mindestlohn nicht für alle Beschäftigten gilt. Wenn sich gute Arbeit doch nicht lohnt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/441889