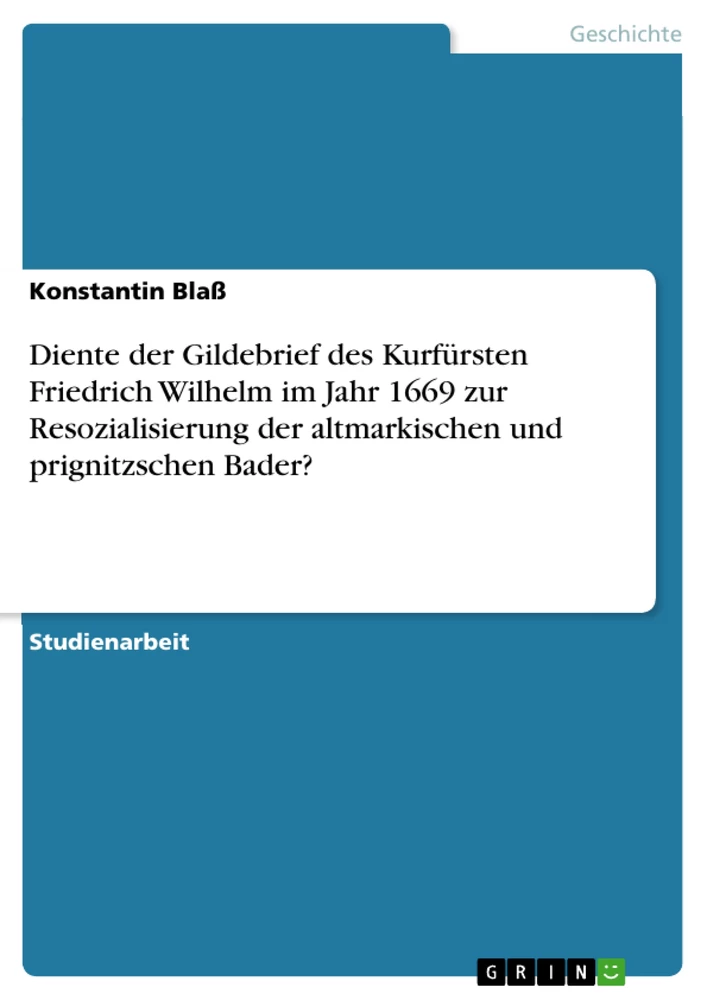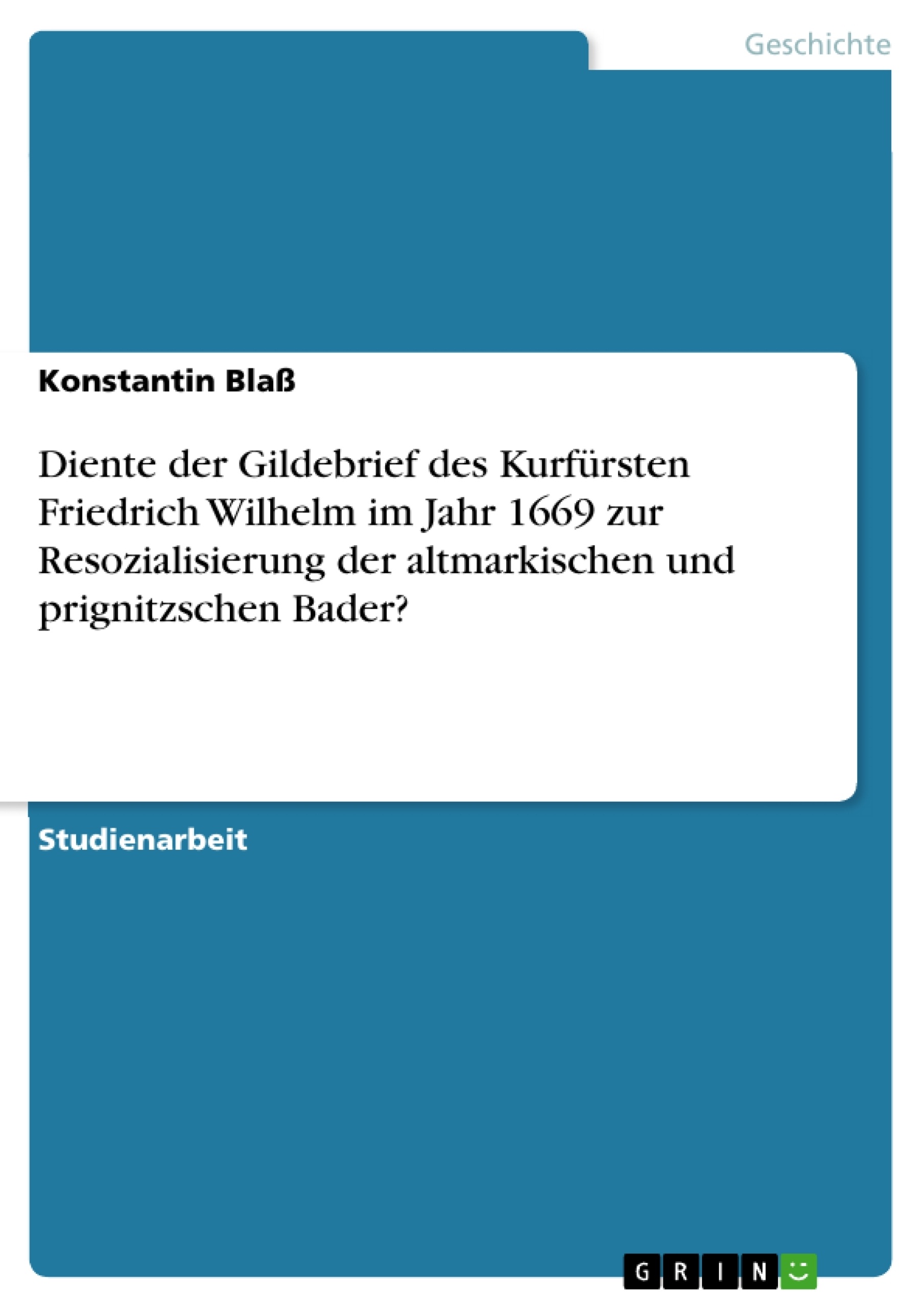Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Berufsgruppe der Bader in der Frühen Neuzeit. Interessant an diesem Beruf ist, dass seine Stellung innerhalb der Gesellschaft schwankte, sowohl regional wie auch epochal. In der wissenschaftlichen Literatur wird die Stellung der Bader am Rande der Gesellschaft verortet und beschrieben. Bis auf wenige Ausnahmen herrscht darüber auch Einigkeit. Die Arbeit des Baders wurde von allen Gesellschaftsschichten in Anspruch genommen. So ist die Frage, warum diese Gruppe, obwohl sie gesellschaftlich von Notwendigkeit war, ausgegrenzt wurde und wie die Obrigkeit zu ihr stand. In dieser Hausarbeit wird versucht, diese beiden Fragen zu klären. Um zu verstehen, wie die Obrigkeit handelte, müssen die Vorurteile gegen die Bader deutlich werden. Als Quelle dient dazu der Gildebrief aus dem Jahr 1669, konfirmiert durch den Kurfürsten Friedrich Wilhelm, an die Bader der Altmark und Prignitz. Die Frage an die Quelle ist, ob dieser Gildebrief der Resozialisierung diente.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgrenzung von (medizinisch) notwendigen Berufen
- Stellung der Bader innerhalb der Gesellschaft
- Pflichten und Aufgaben des Bader
- Die Badstube
- Untergang der Badstube
- Die Sittenlosigkeit in den Bädern
- Die Zunft
- Formen der Ausgrenzung
- Reaktionen der Obrigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Berufsgruppe der Bader in der Frühen Neuzeit. Ziel ist es, die Gründe für die gesellschaftliche Ausgrenzung dieser Berufsgruppe trotz ihrer Notwendigkeit zu erforschen und das Verhältnis der Obrigkeit zu den Badern zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die Vorurteile, die gegen die Bader bestanden und betrachtet den Gildebrief des Kurfürsten Friedrich Wilhelm aus dem Jahr 1669 als zentrale Quelle, um die Frage zu beantworten, ob dieser der Resozialisierung der Bader in der Altmark und Prignitz diente.
- Die Ausgrenzung (medizinisch) notwendiger Berufe in der Frühen Neuzeit
- Die Stellung der Bader innerhalb der Gesellschaft und die Gründe für ihre Ausgrenzung
- Die Rolle der Badstube und des Zunftwesens in der Bader-Gesellschaft
- Die Reaktionen der Obrigkeit auf die Bader und deren Auswirkungen
- Die Frage, ob der Gildebrief von 1669 zur Resozialisierung der Bader beitrug
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Diese Einleitung stellt die Berufsgruppe der Bader in der Frühen Neuzeit und ihre schwankende Stellung innerhalb der Gesellschaft vor. Sie führt die Frage nach der Ausgrenzung der Bader trotz ihrer gesellschaftlichen Notwendigkeit ein und beschreibt den Ansatz der Arbeit, diese Fragen anhand des Gildebriefs von 1669 zu untersuchen.
Ausgrenzung von (medizinisch) notwendigen Berufen
Dieses Kapitel beleuchtet die allgemeine Ausgrenzung von Randgruppen in der Gesellschaft. Es diskutiert die Gründe für die Stigmatisierung von Berufen, die Kontakt zu Tod oder Krankheit hatten, und untersucht die Rolle von Vorurteilen und der Vertiefung der Ständegesellschaft in diesem Kontext.
1 Der Bader in der Alten Marck und Prignitz Privilegium, hg. von Lieselott Enders (Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 59), Berlin 2008, Artikel, 2., S. 57.
2 Roeck, Bernd: Außenseiter, Randgruppen, Minderheiten. Fremde im Deutschland der frühen Neuzeit (Kleine Vandenhoeck-Reihe), Göttingen 1993, S. 106f.
3 Enders, Lieselott: Bader- und Barbiergilden in der frühneuzeitlichen Kurmark, in: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 59 (2008), S. 50.
4 Roeck: Unehrliche, S. 112f.
5 Van Dülmen, Richard: Der infame Mensch. Unehrliche Arbeit und soziale Ausgrenzung in der Frühen Neuzeit, in: Arbeit, Frömmigkeit und Eigensinn, hg. von Richard van Dülmen (Studien zur historischen Kulturforschung 2), Frankfurt a. M. 1990, S. 110.
6 Roeck: Unehrliche, S. 106,114.
7 Roeck: Unehrliche, S. 109.
8 Sander, Sabine: Bader und Barbiere, in: Das alte Handwerk: Von Bader bis Zinngießer, hg. von Reinhold Reith (Beck'sche Reihe 1841), München 2008, S. 19.
9 Van Dümen: Arbeit, S. 136.
10 Roeck: Unehrliche, S. 114.
11 Roeck: Unehrliche, S. 114.
12 Roeck: Unehrliche, S. 107.
13 Van Dümen: Arbeit, S. 111.
14 Roeck: Unehrlich, S. 106.
15 Van Dümen: Arbeit, S. 111.
16 Van Dümen: Arbeit, S. 112.
17 Roeck: Unehrliche, S. 112.
18 Pilhofer, Werner: Von Badhäusern, Badstuben und Badern: wie man im Mittelalter bis in die Neuzeit hinein badete, in: Alt-Gunzenhausen 65 (2010), S. 277.
19 Van Dümen: Arbeit, S. 136.
20 Van Dümen: Arbeit, S. 112.
21 Van Dümen: Arbeit, S. 118.
22 Van Dümen: Arbeit, S. 109.
23 Van Dümen: Arbeit, S.108.
24 Jütte, Robert: Bader, Barbiere und Hebammen. Heilkundige als Randgruppe?, in: Randgruppen der spätmittelalterlichen Gesellschaft. Ein Hand- und Studienbuch neu bearb. Ausgabe, hg. von Bernd-Ulrich Hergemöller, Warendorf 1990, S. 95.
25 Van Dümen: Arbeit, S. 109.
26 Jütte: Randgruppen, S. 92.
27 Wulz, Gustav: Bader und Barbiere in Nördlingen. Ein anrüchiges und ein angesehenes Gewerbe, in: Jahrbuch Historischer Verein für Nördlingen und das Ries 24 (1969), S. 75.
Stellung der Bader innerhalb der Gesellschaft
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Berufsgruppe der Bader. Es beleuchtet deren Pflichten und Aufgaben, die Rolle der Badstube, das Zunftwesen der Bader und die Formen der Ausgrenzung, denen sie ausgesetzt waren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Ausgrenzung, Randgruppen, Bader, Frühneuzeit, Gildebrief, Resozialisierung, Vorurteile, Zunftwesen, Badstube, Obrigkeit, Gesellschaft, Ständegesellschaft, Ehrlichkeit, Unehrlichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurden Bader in der Frühen Neuzeit gesellschaftlich ausgegrenzt?
Bader galten oft als „unehrlich“, da ihr Beruf Kontakt mit Krankheiten, Blut und dem menschlichen Körper beinhaltete, was in der damaligen Ständegesellschaft zu Vorurteilen führte.
Was war der Gildebrief des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von 1669?
Es handelt sich um ein Privileg bzw. eine Gildeordnung für die Bader der Altmark und Prignitz, in der Pflichten, Aufgaben und Rechte der Zunft festgelegt wurden.
Diente der Gildebrief der Resozialisierung der Bader?
Die Arbeit untersucht, ob die Obrigkeit durch solche Gildebriefe versuchte, die ausgegrenzte Berufsgruppe wieder stärker in die geordnete Gesellschaft zu integrieren.
Welche Rolle spielte die Badstube im Alltag?
Die Badstube war ein Ort der medizinischen Versorgung und Hygiene, stand aber oft im Ruf der Sittenlosigkeit, was zum Untergang vieler Badstuben beitrug.
Welche Aufgaben hatten Bader neben dem Baden?
Bader übernahmen oft auch Aufgaben wie das Aderlassen, das Ziehen von Zähnen und die Wundversorgung, was sie medizinisch notwendig machte.
- Citar trabajo
- Konstantin Blaß (Autor), 2013, Diente der Gildebrief des Kurfürsten Friedrich Wilhelm im Jahr 1669 zur Resozialisierung der altmarkischen und prignitzschen Bader?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/442002