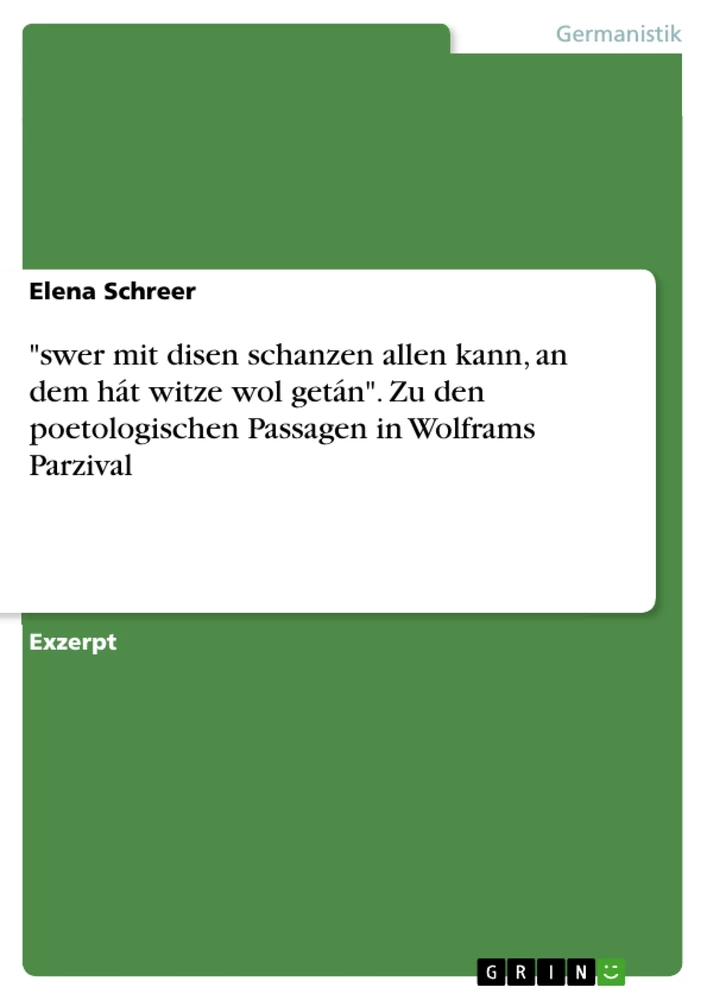Bei dieser Arbeit handelt es sich um ein Exzerpt (in Stichpunkten) der Textgrundlage: SCHIROK, Bernd. „swer mit disen schanzen allen kann, an dem hat witze wol getan “. Kölner Germanistische Studien, 1990, 30. Jg., S. 119-145.
Inhaltsverzeichnis
- Dunkelheit in der Rede im Parzival
- Probleme des Parzival-Prologs
- Bild der Elster
- Fabel der ungeduldigen Kuh
- Unbeständigkeitsgleichnisse im ersten Prologteil
- Aufbruch der Kalokagathie-Vorstellung
- Warum werden die Frauen überhaupt ausgelagert?
- Frauenabschnitt des Prologs als „Sprungbrett“ zur Selbstverteidigung
- Passage, die wie ein Bescheidenheitstopos einsetzt
- Diskussion um Selbstverteidigung
- Wolframs Zorn gegen eine Frau
- Zeitpunkt: vor der Digression
- Beginn der Selbstverteidigung präludiert das Thema des Vergleichs
- Wolfram begründet einen Zorn der Frau
- Schlag gegen andere Form des Minnesangs
- Bogengleichnis
- Zusammenhang zwischen Selbststilisierung
- Erzähler begründet, warum er seinen Hörers an dieser Stelle nähere Erklärungen
- Epilog zu Buch VI
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die poetologischen Passagen in Wolframs Parzival, insbesondere die Stellen, in denen der Erzähler auf seine Darstellungsweise eingeht und dem Hörer das rechte Verständnis vermitteln möchte. Dabei wird der Fokus auf die Dunkelheit und Unklarheit in der Rede gelegt, die besonders in den Prologabschnitten des Romans auftreten.
- Analyse der poetologischen Passagen in Wolframs Parzival
- Dunkelheit und Unklarheit in der Rede als Stilmittel
- Interpretation der Prologe und ihre Funktion im Gesamtzusammenhang
- Die Rolle des Erzählers in der Gestaltung der Geschichte
- Beziehung zwischen Erzähler, Hörer und Text
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Analyse der Schwierigkeiten im Umgang mit dem Prolog des Parzivals, die bis heute in der Forschung bestehen. Die Unklarheiten in der Rede werden auf zwei mögliche Ursachen zurückgeführt: mangelnde Klarheit in der mittelalterlichen Rhetorik oder nachträgliche Überarbeitungen. Anschließend werden die poetologischen Passagen im Prolog genauer untersucht, wobei die unterschiedlichen Interpretationen von Lachmann und Kläden dargestellt werden.
Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit den Problemen des Prologteils, die durch die Verwendung von Begriffen wie „zwivel“ und „verzaget“ entstehen. Der Autor analysiert die Bedeutung dieser Begriffe und untersucht die Unterschiede in ihrer Interpretation bei Hartmann und Wolfram. Im weiteren Verlauf werden die poetologischen Passagen weiter beleuchtet, wobei der Fokus auf das Bild der Elster und die Fabel der ungeduldigen Kuh liegt. Diese Passagen dienen dazu, die richtige Hörereinstellung zu vermitteln und die Verantwortung des Hörers im Umgang mit der Geschichte zu betonen.
Der Text geht dann auf den Abschnitt über Frauen im Prolog ein und analysiert die Rolle der Frau im Wertesystem des Romans. Dabei werden die Gleichnisse und die Vergänglichkeitsbilder, die in diesem Abschnitt verwendet werden, untersucht. Die Interpretation von Haug, der den Frauenabschnitt als verkürzt und außerhalb der literaturtheoretischen Problematik sieht, wird kritisch beleuchtet.
Im weiteren Verlauf wird die Selbstverteidigung des Erzählers im zweiten Buch des Romans analysiert. Der Text untersucht die Beziehung zwischen der Selbstverteidigung und dem Frauenabschnitt sowie die Rolle des Minnesangs im Gesamtzusammenhang. Dabei wird der Fokus auf Wolframs Kritik an der Gattung Minnesang und seine eigene Selbststilisierung als Dichter gelegt.
Die letzte Passage, die im Text behandelt wird, ist das Bogengleichnis. Der Text analysiert die Funktion des Bogengleichnisses und seinen Bezug zur Selbstverteidigung des Erzählers. Die Verbindung zwischen Selbststilisierung und der Ablehnung der Buchgelehrsamkeit wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: poetologische Passagen, Dunkelheit in der Rede, Prolog, Parzival, Wolfram von Eschenbach, mittelalterliche Rhetorik, Hörereinstellung, Frauendarstellung, Minnesang, Selbstverteidigung, Bogengleichnis, Buchgelehrsamkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was sind poetologische Passagen im „Parzival“?
Es sind Textstellen, in denen der Erzähler Wolfram von Eschenbach über seine eigene Dichtkunst, Sprache und Erzählweise reflektiert.
Warum ist der Prolog des „Parzival“ so schwer verständlich?
Wolfram nutzt bewusst „Dunkelheit in der Rede“ (Unklarheit) als Stilmittel, was in der Forschung oft als Herausforderung diskutiert wird.
Was symbolisiert das Bild der Elster im Prolog?
Es steht für das Schwanken zwischen „zwivel“ (Zweifel) und „unverzaget“ (Beständigkeit) im menschlichen Gemüt.
Was besagt das Bogengleichnis?
Wolfram nutzt es, um den Zusammenhang zwischen seiner Erzählstruktur und der Aufmerksamkeit des Hörers zu verdeutlichen.
Kritisiert Wolfram den traditionellen Minnesang?
Ja, in seinen poetologischen Exkursen grenzt er sich oft von anderen Formen des Minnesangs ab und stilisiert sich selbst als eigenwilligen Dichter.
- Citation du texte
- Elena Schreer (Auteur), 2017, "swer mit disen schanzen allen kann, an dem hát witze wol getán". Zu den poetologischen Passagen in Wolframs Parzival, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/443110