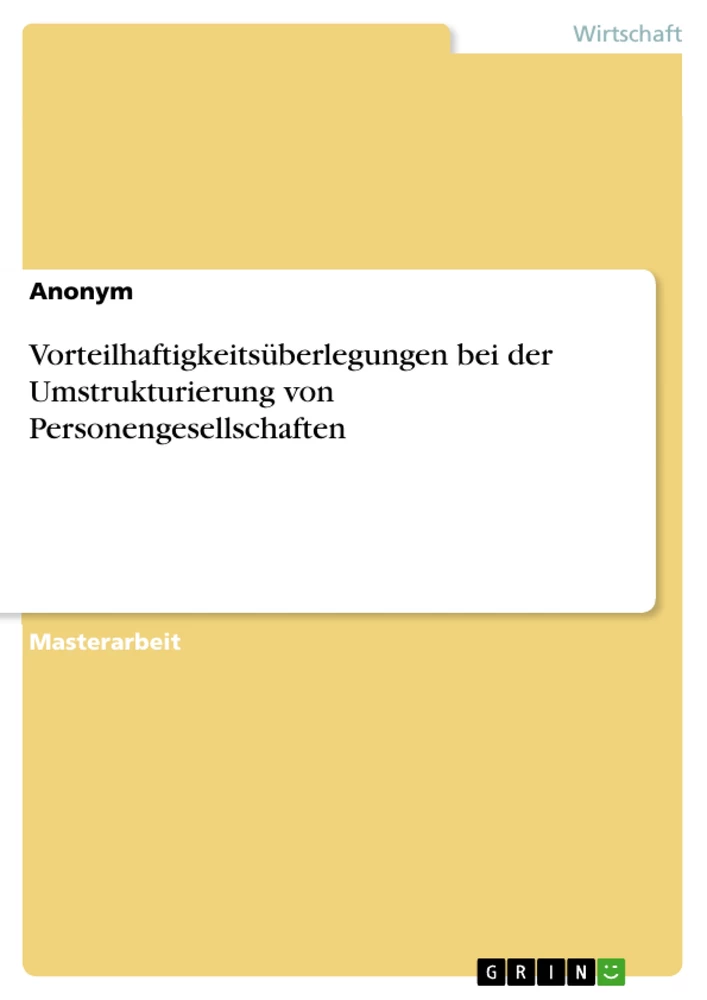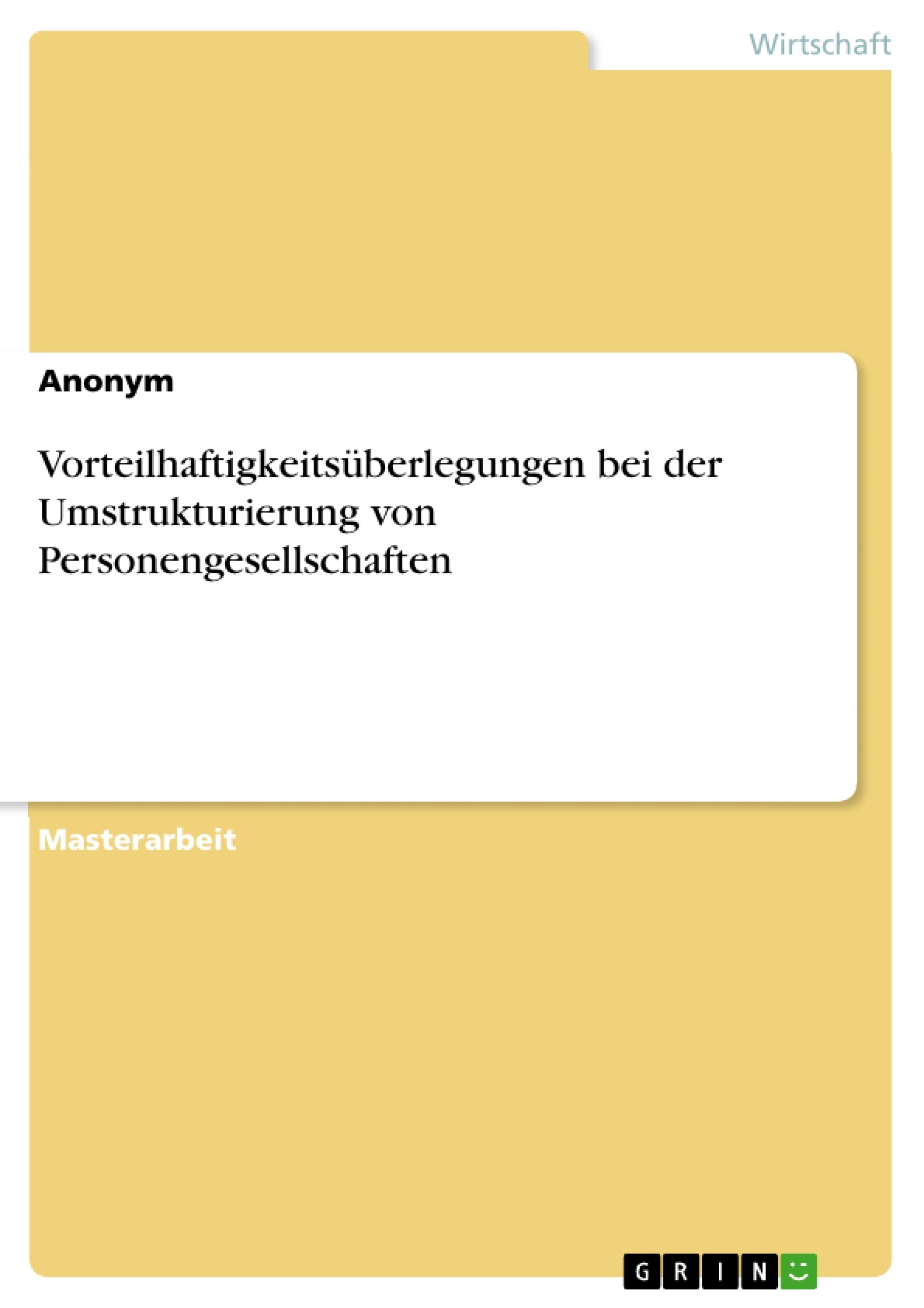Umstrukturierungen von einst als vorteilhaft qualifizierten Strukturen sind in der betrieblichen Realität notwendig, um sich den ständig ändernden wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen anzupassen und weiterhin im unternehmerischen Umfeld erfolgreich bestehen zu können. Nicht untypisch sind Motive wie der Zusammenschluss von Unternehmen, um Synergieeffekte auszunutzen oder Kosten zu reduzieren. Allerdings kann es vorkommen, dass die einst als vorteilhaft qualifizierte Umstrukturierungsmaßnahme nicht die erhoffte Wirkung zeigt oder die Gesellschafter nicht effizient zusammenarbeiten.
Die Gründe hierfür sind vielfältig. Deshalb kann eine erneute Umstrukturierung der Gesellschaft als notwendig erscheinen. Das Bedürfnis der Praxis nach betriebswirtschaftlich notwendigen Umstrukturierungen konfligiert jedoch regelmäßig mit dem Subjektsteuerprinzip. Obwohl der Bundesfinanzhof im Jahr 1993 ausdrücklich bestätigte, dass das deutsche Steuerrecht von einem Grundsatz beherrscht werde, welcher die interpersonelle Übertragung von Vermögen nicht erlaubt. wurden dennoch im Zeitverlauf zunehmend Ausnahmen durch den Gesetzgeber in das Steuerrecht implementiert.
Im Zuge dieser Rechtsprechung und der Entwicklung des Steuerrechts sind zahlreiche, kasuistische, aber wirtschaftlich vergleichbare Priviligierungsvorschriften entstanden. Insbesondere hervorzuheben sind die §§6Abs.5, 16Abs.3S.2 - 4EStG und §24UmwStG. Grundlegend verfolgen diese Vorschriften das Ziel, betriebswirtschaftlich erforderliche und sinnvolle Umstrukturierungsmaßnahmen nicht durch Steuerbelastungen zu erschweren, sofern die Besteuerung der stillen Reserven durch die Bundesrepublik Deutschland sichergestellt ist. Diese Vorschriften bilden jedoch ein Geflecht von untereinander unabgestimmten und in ihren Voraussetzungen sowie ihren jeweiligen Rechtsfolgen inkonsistententen Individualprivilegierungen.
Deshalb beschäftigt sich diese Masterarbeit mit der Frage, wie Umstrukturierungen bei Personengesellschaften durchgeführt werden sollten und wann welche der genannten Alternativen zu bevorzugen ist. Diese Frage ist erneut in den Mittelpunkt von Umstrukturierungsüberlegungen geraten, da der BFH, durch die Änderung seiner Rechtsauffassung hinsichtlich der Realteilung, neue Möglichkeiten zur Umstrukturierung von Personengesellschaften geschaffen hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundproblematik der stillen Reserven
- 2.1 Entstehung stiller Reserven
- 2.2 Ermittlung der stillen Reserven
- 2.3 Zahlung aus der Substanz
- 3. Umstrukturierungsmaßnahmen
- 3.1 Einbringung nach § 24 UmwStG
- 3.2 Realteilung nach § 16 Abs. 3 S. 2 EStG
- 3.3 Umstrukturierung nach § 6 Abs. 5 EStG
- 3.4 Übersicht und Beurteilung
- 4. Allgemeine Vorteilhaftigkeitsüberlegungen
- 4.1 Vermeidung der Gewinnrealisierung
- 4.2 Flexibilität der Wirtschaftsgüter
- 4.3 Kosten- und Zeiteffizienz
- 4.4 Methodische Vorgehensweise
- 5. Vorteilhaftigkeitsanalyse
- 5.1 Ausgangsfall
- 5.2 Ergebnis und Beurteilung
- 6. Sensitivitätsanalyse
- 6.1 Verbindlichkeiten
- 6.2 Vorliegen eines Teilbetriebs
- 6.3 Verlustvorträge
- 6.4 Änderung der Gesellschafterstruktur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Vorteilhaftigkeitsüberlegungen bei der Umstrukturierung von Personengesellschaften. Ziel ist es, verschiedene Umstrukturierungsmaßnahmen im Hinblick auf steuerliche und wirtschaftliche Aspekte zu analysieren und zu bewerten.
- Steuerrelevanteste Gestaltungsalternativen bei der Umstrukturierung von Personengesellschaften
- Analyse stiller Reserven und deren Auswirkungen auf die Umstrukturierung
- Bewertung verschiedener Umstrukturierungsmöglichkeiten (Einbringung, Realteilung, etc.)
- Entwicklung einer methodischen Vorgehensweise zur Vorteilhaftigkeitsanalyse
- Sensitivitätsanalyse der Ergebnisse unter Berücksichtigung verschiedener Einflussfaktoren
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Masterarbeit ein und beschreibt die Problemstellung der Vorteilhaftigkeitsüberlegungen bei der Umstrukturierung von Personengesellschaften. Es skizziert den Aufbau und den Gang der Untersuchung.
2. Grundproblematik der stillen Reserven: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Entstehung, Ermittlung und den Auswirkungen stiller Reserven auf Umstrukturierungsmaßnahmen. Es werden verschiedene Einflussgrößen wie Buchwert und Verkehrswert detailliert erläutert, und verschiedene Fallvarianten der Entstehung stiller Reserven werden vorgestellt. Der Begriff der "Zahlung aus der Substanz" wird im Kontext der stillen Reserven definiert und erklärt.
3. Umstrukturierungsmaßnahmen: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Umstrukturierungsmaßnahmen, darunter die Einbringung nach § 24 UmwStG, die Realteilung nach § 16 Abs. 3 S. 2 EStG und die Umstrukturierung nach § 6 Abs. 5 EStG. Für jede Maßnahme werden die relevanten gesetzlichen Bestimmungen, die Bewertung des eingebrachten Vermögens, sowie Missbrauchsklauseln und Sperrfristen detailliert untersucht. Es wird ein Vergleich der verschiedenen Maßnahmen durchgeführt, um deren Vor- und Nachteile aufzuzeigen.
4. Allgemeine Vorteilhaftigkeitsüberlegungen: In diesem Kapitel werden allgemeine Überlegungen zur Vorteilhaftigkeit von Umstrukturierungsmaßnahmen diskutiert. Im Fokus stehen dabei die Vermeidung von Gewinnrealisierung, die Flexibilität der Wirtschaftsgüter, die Kosten- und Zeiteffizienz der verschiedenen Maßnahmen. Des Weiteren wird die methodische Vorgehensweise für die anschließende Vorteilhaftigkeitsanalyse vorgestellt und begründet.
5. Vorteilhaftigkeitsanalyse: Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte Vorteilhaftigkeitsanalyse anhand eines konkreten Ausgangsfalles. Es werden verschiedene Alternativen zur Umstrukturierung (Einbringung, Kettenübertragung, § 6b EStG, Kombination) modelliert und miteinander verglichen. Das Kapitel endet mit einer Beurteilung der Ergebnisse und einer Ableitung von Handlungsempfehlungen.
Schlüsselwörter
Personengesellschaften, Umstrukturierung, stille Reserven, § 24 UmwStG, § 16 Abs. 3 S. 2 EStG, § 6 Abs. 5 EStG, Vorteilhaftigkeitsanalyse, Steueroptimierung, Bewertung, Verkehrswert, Buchwert, Teilbetrieb, Missbrauchsklauseln.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Vorteilhaftigkeitsüberlegungen bei der Umstrukturierung von Personengesellschaften
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Vorteilhaftigkeitsüberlegungen bei der Umstrukturierung von Personengesellschaften. Ziel ist die Analyse und Bewertung verschiedener Umstrukturierungsmaßnahmen unter steuerlichen und wirtschaftlichen Aspekten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die steuerelevantesten Gestaltungsalternativen bei der Umstrukturierung, die Analyse stiller Reserven und deren Auswirkungen, die Bewertung verschiedener Umstrukturierungsmöglichkeiten (Einbringung, Realteilung etc.), die Entwicklung einer methodischen Vorgehensweise zur Vorteilhaftigkeitsanalyse und eine Sensitivitätsanalyse der Ergebnisse unter Berücksichtigung verschiedener Einflussfaktoren.
Welche Umstrukturierungsmaßnahmen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Einbringung nach § 24 UmwStG, die Realteilung nach § 16 Abs. 3 S. 2 EStG und die Umstrukturierung nach § 6 Abs. 5 EStG. Für jede Maßnahme werden die gesetzlichen Bestimmungen, die Bewertung des eingebrachten Vermögens, Missbrauchsklauseln und Sperrfristen detailliert untersucht.
Wie wird die Vorteilhaftigkeitsanalyse durchgeführt?
Die Arbeit entwickelt eine methodische Vorgehensweise zur Vorteilhaftigkeitsanalyse. Diese wird anhand eines konkreten Ausgangsfalls angewendet, wobei verschiedene Alternativen (Einbringung, Kettenübertragung, § 6b EStG, Kombination) modelliert und verglichen werden. Die Ergebnisse werden beurteilt und Handlungsempfehlungen abgeleitet.
Welche Rolle spielen stille Reserven?
Die Arbeit befasst sich eingehend mit der Entstehung, Ermittlung und den Auswirkungen stiller Reserven auf Umstrukturierungsmaßnahmen. Es werden Buchwert und Verkehrswert detailliert erläutert und verschiedene Fallvarianten der Entstehung vorgestellt. Der Begriff der "Zahlung aus der Substanz" wird im Kontext der stillen Reserven definiert.
Welche Faktoren werden in der Sensitivitätsanalyse berücksichtigt?
Die Sensitivitätsanalyse berücksichtigt Verbindlichkeiten, das Vorliegen eines Teilbetriebs, Verlustvorträge und Änderungen der Gesellschafterstruktur.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Personengesellschaften, Umstrukturierung, stille Reserven, § 24 UmwStG, § 16 Abs. 3 S. 2 EStG, § 6 Abs. 5 EStG, Vorteilhaftigkeitsanalyse, Steueroptimierung, Bewertung, Verkehrswert, Buchwert, Teilbetrieb und Missbrauchsklauseln.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Grundproblematik der stillen Reserven, Umstrukturierungsmaßnahmen, Allgemeine Vorteilhaftigkeitsüberlegungen, Vorteilhaftigkeitsanalyse und Sensitivitätsanalyse. Jedes Kapitel wird zusammengefasst und die wichtigsten Ergebnisse dargestellt.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2018, Vorteilhaftigkeitsüberlegungen bei der Umstrukturierung von Personengesellschaften, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/443163