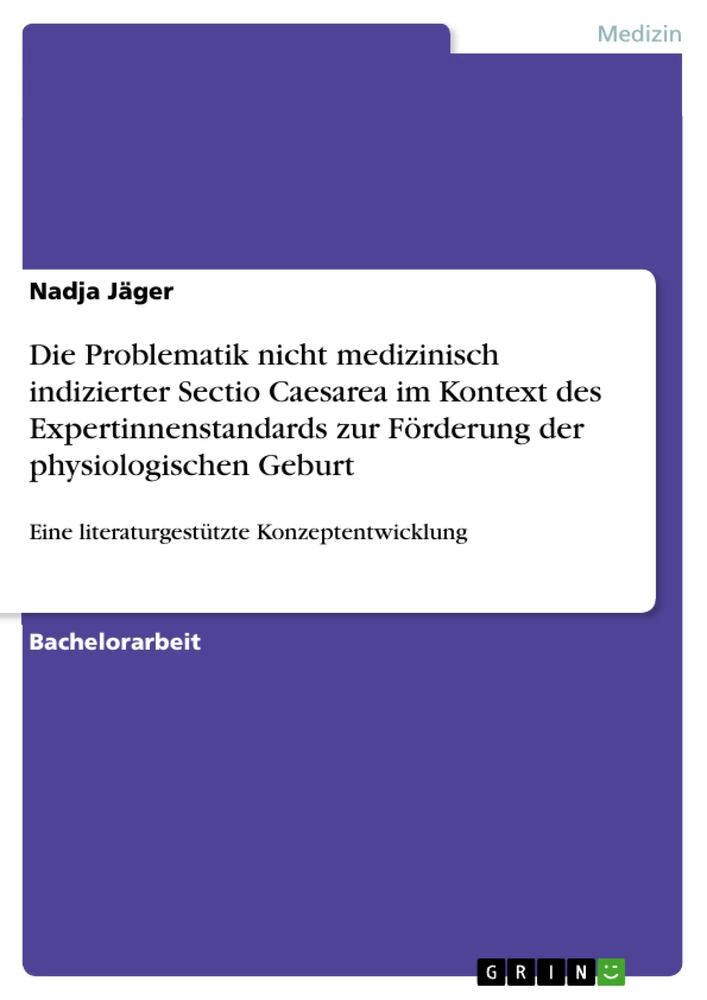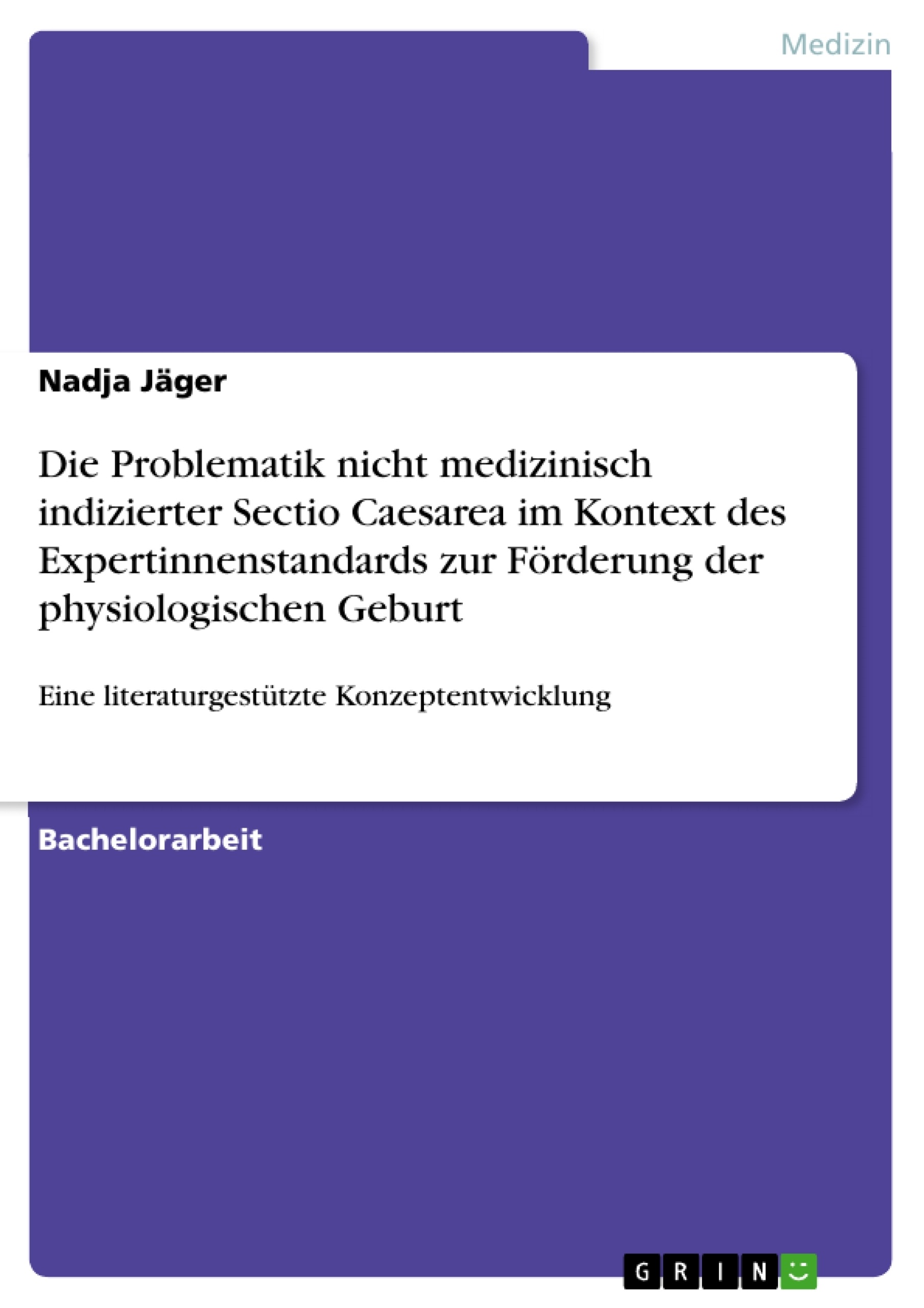In den letzten 20 Jahren ist die Kaiserschnittrate in Deutschland kontinuierlich angestiegen. Den Großteil davon stellen nicht-medizinisch indizierte Kaiserschnitte dar.
Das Ziel dieser Arbeit ist die Einflussfaktoren, welche Frauen zu dem Entschluss einer Kaiserschnittentbindung bewegen, sowohl auf gesellschaftlicher als auch individueller, persönlicher Ebene zu untersuchen. Zur Bearbeitung der Thematik und Beantwortung der Forschungsfragen ist eine systematische Literaturanalyse durchgeführt worden.
Als Haupteinflussfaktoren sind ein hohes Sicherheitsbedürfnis, die risikoarme, öffentliche Darstellung des Kaiserschnittes, prägende Persönlichkeitsmerkmale wie Introvertiertheit etc., Unsicherheit und Angst identifiziert worden. Darauf aufbauend wird im nächsten Schritt ein interdisziplinäres Beratungskonzept im Kontext des Expertinnenstandards zur Förderung der physiologischen Geburt theoretisch konzipiert und dessen einzelne Interventionsschritte erläutert. Der Fokus wird dabei auf die Aufklärung hinsichtlich des Kaiserschnittes, dem Aufzeigen der gesundheitsförderlichen Perspektive und der psychischen Betreuung mit Schwerpunkt auf der Bearbeitung von Emotionen gelegt.
Da Frauen, gerade zu Beginn der Schwangerschaft Informationen, professionellen Empfehlungen und einer Beratung offen gegenüber sind, verspricht dieser Interventionsansatz eine hohe Wirksamkeit, die Frauen in ihrer Entscheidung für einen Kaiserschnitt umzustimmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geburtsprozesse und ihre Veränderungen
- Physiologische Geburt
- Sectio Caesarea
- Der moderne Trend zur Kaiserschnittkultur
- Gesundheitsbezogene Problemlagen bei Kaiserschnitt
- Lösungsansatz des Expertinnenstandards
- Methodisches Vorgehen
- Einflussfaktoren und Entscheidungsprozesse in der Phase der Geburtsvorbereitung
- Gesellschaftliche Einflussfaktoren
- Individuelles Bedingungsgefüge
- Professionelle und individuelle Abwägungsprozesse für die Geburt
- Gesundheits- und lebensweltbezogene Aspekte bei physiologischer Geburt
- Gesundheits- und lebensweltbezogene Aspekte bei Kaiserschnitt
- Notwendigkeit eines effizienten Lösungsansatzes
- Konzeptentwicklung einer interdisziplinären pränatalen Beratung
- Struktur einer gesundheitsbezogenen Einzelberatung
- Theoriebasierte Konzeptskizze
- Eckpfeiler eines Beratungskonzeptes
- Haltung, Konsens und Widersprüche
- Kompetenzen der Beratenden
- Zugangswege zur Zielgruppe
- Beratungsinhalte
- Beziehungs- und Vertrauensaufbau
- Analyse und Förderung der Gesundheitskompetenz
- Analyse einflussnehmender Beweggründe
- Informationsweitergabe zur physiologischen Geburt
- Aufklärung über die Auswirkungen eines Kaiserschnittes
- Indizierung einer Umstimmung
- Aspekte der Gesundheitsförderung
- Bearbeitung von Emotionen
- Psychosoziale Betreuung und Angstmanagement
- Evaluation
- Diskussion der Umsetzungspotentiale im Hinblick auf eine Praxisimplementierung
- Zusammenfassung und Zukunftsausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Problematik nicht medizinisch indizierter Sectio Caesarea und entwickelt ein Konzept zur Förderung physiologischer Geburten. Ziel ist es, gesellschaftliche und individuelle Einflussfaktoren auf die Wahl des Geburtsmodus zu analysieren und ein interdisziplinäres Beratungsmodell zu entwerfen, das die Kaiserschnittrate senken soll.
- Analyse der zunehmenden Kaiserschnittrate in Deutschland
- Identifikation gesellschaftlicher und individueller Einflussfaktoren auf die Geburtswahl
- Entwicklung eines Beratungsmodells zur Förderung physiologischer Geburten
- Bewertung der Umsetzungspotentiale des entwickelten Modells
- Bedeutung des Expertinnenstandards in der Geburtshilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung des Geburtsvorgangs für die spätere gesundheitliche Entwicklung und stellt die steigende Kaiserschnittrate in Deutschland als Problem dar. Sie beschreibt den Fokus der Arbeit auf die Entwicklung eines Konzeptes zur Senkung der nicht medizinisch indizierten Kaiserschnittrate, basierend auf einem Expertinnenstandard und einer systematischen Literaturanalyse. Die Arbeit konzentriert sich auf die Perspektive der Frau und die Rolle der Hebamme.
Geburtsprozesse und ihre Veränderungen: Dieses Kapitel analysiert den Wandel in der Geburtshilfe hin zu mehr medizinischen Interventionen, insbesondere Kaiserschnitten. Es beleuchtet die gesellschaftliche Wahrnehmung des Kaiserschnitts als risikoarm und sicher im Gegensatz zur physiologischen Geburt. Die zunehmende Selbstbestimmungsorientierung von Frauen wird im Kontext der gesundheitsfördernden Perspektive diskutiert, die oft vernachlässigt wird. Die exponentiell steigende Kaiserschnittrate und deren negative Folgen werden hervorgehoben.
Methodisches Vorgehen: (Kapitelbeschreibung fehlt im Ausgangstext. Eine Zusammenfassung kann daher nicht erstellt werden.)
Einflussfaktoren und Entscheidungsprozesse in der Phase der Geburtsvorbereitung: Dieses Kapitel untersucht die gesellschaftlichen und individuellen Faktoren, die die Wahl des Geburtsmodus beeinflussen. Es beleuchtet sowohl gesellschaftliche Trends und Normen als auch die individuellen Bedürfnisse, Ängste und Erfahrungen von werdenden Müttern. (Die genaue Detaillierung der Analyse fehlt im Ausgangstext, somit ist eine detailliertere Zusammenfassung nicht möglich.)
Professionelle und individuelle Abwägungsprozesse für die Geburt: Das Kapitel beleuchtet die gesundheits- und lebensweltbezogenen Aspekte einer physiologischen Geburt und eines Kaiserschnitts. Es analysiert die Vor- und Nachteile beider Geburtsmodi aus verschiedenen Perspektiven (körperlich, emotional, sozial) und legt den Fokus auf die Entscheidungsfindung der werdenden Mutter. (Die genaue Detaillierung der Analyse fehlt im Ausgangstext, somit ist eine detailliertere Zusammenfassung nicht möglich.)
Notwendigkeit eines effizienten Lösungsansatzes: (Kapitelbeschreibung fehlt im Ausgangstext. Eine Zusammenfassung kann daher nicht erstellt werden.)
Konzeptentwicklung einer interdisziplinären pränatalen Beratung: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung eines umfassenden Beratungsmodells zur Senkung der Kaiserschnittrate. Es skizziert die Struktur einer Einzelberatung, die theoretischen Grundlagen und die Eckpfeiler des Konzepts, einschließlich der Kompetenzen der Berater und der Beratungsinhalte. Die wichtigsten Elemente des Konzeptes sind die Förderung der Gesundheitskompetenz der Schwangeren, die Aufklärung über physiologische Geburt und Kaiserschnitt und die Bearbeitung von Emotionen und Ängsten.
Diskussion der Umsetzungspotentiale im Hinblick auf eine Praxisimplementierung: (Kapitelbeschreibung fehlt im Ausgangstext. Eine Zusammenfassung kann daher nicht erstellt werden.)
Schlüsselwörter
Sectio Caesarea, physiologische Geburt, Kaiserschnittrate, Geburtshilfe, Expertinnenstandard, pränatale Beratung, Gesundheitskompetenz, gesellschaftliche Einflussfaktoren, individuelle Entscheidungsfindung, Risikofaktoren.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Analyse der Kaiserschnittrate und Entwicklung eines Beratungsmodells
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Problematik der nicht medizinisch indizierten Sectio Caesarea (Kaiserschnitt) in Deutschland und entwickelt ein Konzept zur Förderung physiologischer Geburten. Sie analysiert gesellschaftliche und individuelle Einflussfaktoren auf die Wahl des Geburtsmodus und entwirft ein interdisziplinäres Beratungsmodell zur Senkung der Kaiserschnittrate.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist die Entwicklung eines Beratungsmodells, das Schwangere in ihren Entscheidungen rund um die Geburt unterstützt und die Anzahl nicht medizinisch notwendiger Kaiserschnitte reduziert. Die Arbeit analysiert dazu die steigende Kaiserschnittrate, identifiziert Einflussfaktoren und bewertet die Umsetzungspotenziale des entwickelten Modells. Ein weiterer Fokus liegt auf der Bedeutung des Expertinnenstandards in der Geburtshilfe.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Analyse der zunehmenden Kaiserschnittrate, die Identifikation gesellschaftlicher und individueller Einflussfaktoren auf die Geburtswahl, die Entwicklung eines Beratungsmodells zur Förderung physiologischer Geburten, die Bewertung der Umsetzungspotenziale und die Bedeutung des Expertinnenstandards.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Geburtsprozesse und ihre Veränderungen, Methodischem Vorgehen, Einflussfaktoren und Entscheidungsprozessen in der Geburtsvorbereitung, Professionellen und individuellen Abwägungsprozessen für die Geburt, der Notwendigkeit eines effizienten Lösungsansatzes, der Konzeptentwicklung einer interdisziplinären pränatalen Beratung, der Diskussion der Umsetzungspotentiale und Zusammenfassung sowie Zukunftsausblick.
Was wird im Kapitel "Geburtsprozesse und ihre Veränderungen" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert den Wandel in der Geburtshilfe hin zu mehr medizinischen Interventionen, insbesondere Kaiserschnitten. Es beleuchtet die gesellschaftliche Wahrnehmung des Kaiserschnitts und die zunehmende Selbstbestimmungsorientierung von Frauen, die oft die gesundheitsfördernde Perspektive vernachlässigt. Die steigende Kaiserschnittrate und deren negative Folgen werden hervorgehoben.
Was beinhaltet das Kapitel zur Konzeptentwicklung einer interdisziplinären pränatalen Beratung?
Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung eines umfassenden Beratungsmodells zur Senkung der Kaiserschnittrate. Es beinhaltet die Struktur einer Einzelberatung, die theoretischen Grundlagen und Eckpfeiler des Konzepts (Kompetenzen der Berater, Beratungsinhalte). Wichtige Elemente sind die Förderung der Gesundheitskompetenz, Aufklärung über physiologische Geburt und Kaiserschnitt sowie die Bearbeitung von Emotionen und Ängsten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Sectio Caesarea, physiologische Geburt, Kaiserschnittrate, Geburtshilfe, Expertinnenstandard, pränatale Beratung, Gesundheitskompetenz, gesellschaftliche Einflussfaktoren, individuelle Entscheidungsfindung und Risikofaktoren.
Welche Perspektive wird in der Arbeit eingenommen?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Perspektive der Frau und die Rolle der Hebamme bei der Entscheidungsfindung um den Geburtsmodus.
Welche Methode wurde angewendet? (Methodisches Vorgehen)
Eine detaillierte Beschreibung des methodischen Vorgehens fehlt im bereitgestellten Text. Daher kann diese Frage nicht beantwortet werden.
Welche Ergebnisse liefert die Arbeit?
Die Arbeit liefert ein konkretes Beratungsmodell zur Förderung physiologischer Geburten und analysiert die Einflussfaktoren auf die Wahl des Geburtsmodus. Die Umsetzungspotenziale des Modells werden diskutiert.
- Quote paper
- Nadja Jäger (Author), 2018, Die Problematik nicht medizinisch indizierter Sectio Caesarea im Kontext des Expertinnenstandards zur Förderung der physiologischen Geburt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/443859