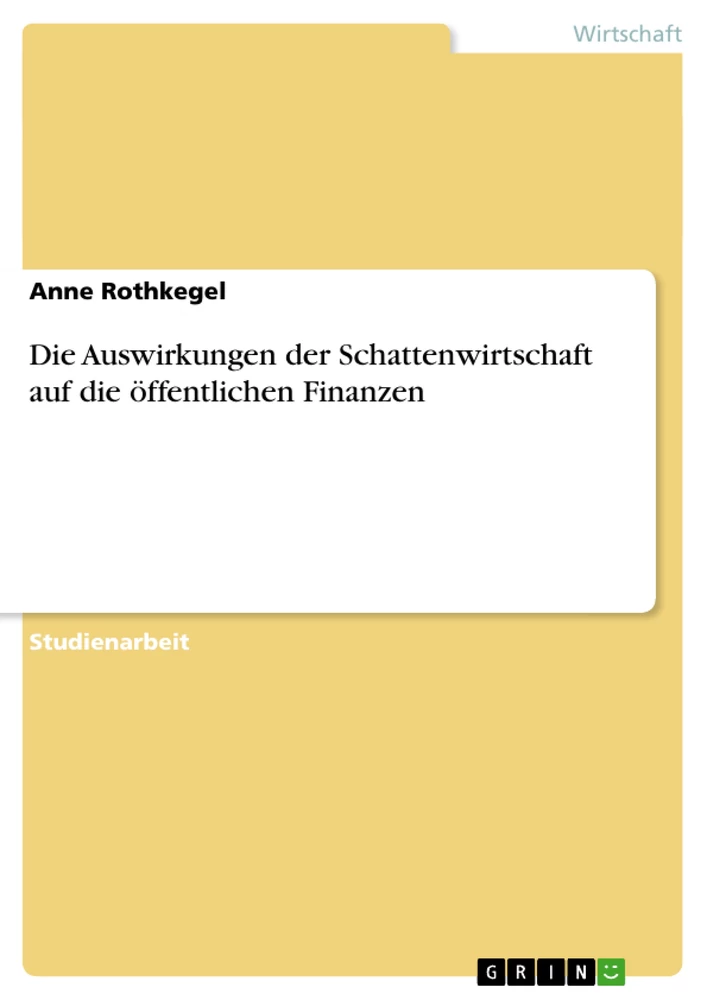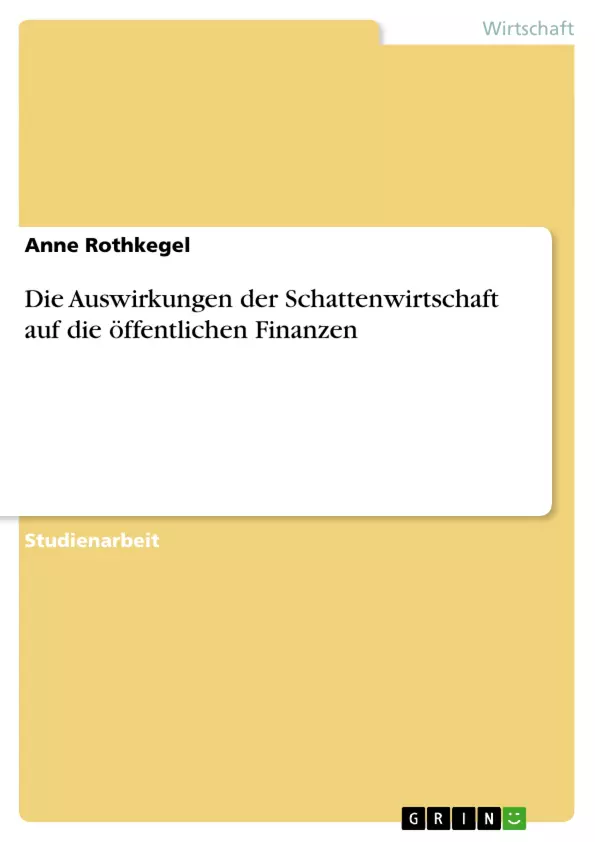Etwa 17 Prozent des Bruttoinlandproduktes, das sind anders ausgedrückt rund 370 Milliarden Euro, beklagt der Staat an Mindereinnahmen derzeit jährlich durch Schwarzarbeit. Der Umfang ist dabei in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, neben Deutschland auch in den restlichen OECD-Staaten. In Deutschland hat sich der Umfang allein in den letzten 20 Jahren verdoppelt und eine Eindämmung der Expansion ist momentan nicht zu erkennen. Zu diesem Thema werden in der Öffentlichkeit zwei wesentliche Standpunkte vertreten. Die eine Seite empfindet die Schattenwirtschaft als effizienteste Form des Wirtschaftens oder als Freiraum in einem Staat der als vollkommen überreguliert gilt. Die andere Seite betrachtet die damit verbundenen wirtschaftspolitischen Probleme wie Steuerhinterziehung, sinkende Einnahmen bei den Sozialversicherungen und Arbeitsplatzverluste. In Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit kommt es wegen dieser differenzierten Standpunkte immer wieder zu kontroversen Diskussionen, die einerseits den Informationsbedarf und andererseits den Handlungsbedarf aufzeigen.
Interessant sind vor allem die Motive, die den Einzelnen dazu bewegen, schwarzarbeitend tätig zu werden. Die allgemeine Ursachenanalyse in Bezug auf die Schwarzarbeit ist daher Schwerpunkt dieser Hausarbeit. Zum Verständnis der Problematik, was unter Schwarzarbeit und Schattenwirtschaft zu verstehen ist, werden zunächst die Begriffe definiert und dargestellt in welcher Wechselwirkung sie zueinander stehen. Anschließend werden als Ausgangspunkt die Folgen auf makroökonomischer Ebene erläutert. Ausführlich werden die fiskalischen Auswirkungen analysiert, andere werden nur kurz erwähnt. Nachdem die vorwiegend negativen Folgen aus gesamtwirtschaftlicher Sicht verdeutlicht sind, wird im Hauptteil geklärt, auf Grund welcher Einflussfaktoren die einzelnen Individuen gesetzeswidrig handeln, obwohl die meisten der negativen Auswirkungen der Öffentlichkeit bekannt sind.
Darauf aufbauend werden Ansätze gezeigt, die zur Eindämmung der Schwarzarbeit sinnvoll erscheinen. Schlussendlich wird die Frage, warum die Schwarzarbeit seitens des Staates unter Mitwirkung der Bevölkerung nicht mit vollem Einsatz bekämpft wird, näher betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit
- 3. Folgen der Schwarzarbeit auf makroökonomischer Ebene
- 3.1. Auswirkungen auf die Steuereinnahmen
- 3.2. Andere ausgewählte Wirkungen
- 4. Das neoklassisches Einkommen-Freizeit-Modell als Ausgangspunkt zur
Ursachen- und Wirkungsanalyse
- 4.1 Präferenzen und Restriktionen
- 4.2 Graphische Darstellung des Grundmodells
- 4.3 Erweitertes Grundmodell
- 5. Ursachen- und Wirkungsanalyse auf mikroökonomischer Ebene
- 5.1. Regelarbeitszeit und Arbeitszeitverkürzungen
- 5.2. Steuer- und Abgabenbelastung
- 5.3. Transferzahlungen
- 5.4. Regulierungsdichte auf dem Arbeitsmarkt
- 5.5. Steuermentalität und Steuermoral
- 6. Bekämpfungsbereitschaft
- 7. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Auswirkungen der Schattenwirtschaft, insbesondere der Schwarzarbeit, auf die öffentlichen Finanzen. Sie befasst sich mit den Folgen für die Steuereinnahmen und anderen ökonomischen Aspekten.
- Auswirkungen der Schwarzarbeit auf die Steuereinnahmen
- Mikroökonomische Ursachen und Wirkungen der Schattenwirtschaft
- Bedeutung des neoklassischen Einkommen-Freizeit-Modells für die Analyse
- Faktoren wie Steuer- und Abgabenbelastung, Transferzahlungen und Regulierungsdichte
- Steuermoral und die Bekämpfungsbereitschaft der Schattenwirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in die Thematik der Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit. Das zweite Kapitel widmet sich den Folgen der Schwarzarbeit auf makroökonomischer Ebene, insbesondere den Auswirkungen auf die Steuereinnahmen. Kapitel drei stellt das neoklassische Einkommen-Freizeit-Modell als Ausgangspunkt für die Ursachen- und Wirkungsanalyse vor. Kapitel vier untersucht die Ursachen und Wirkungen der Schwarzarbeit auf mikroökonomischer Ebene, wobei Faktoren wie Regelarbeitszeit, Steuer- und Abgabenbelastung, Transferzahlungen, Regulierungsdichte und Steuermoral im Mittelpunkt stehen. Kapitel fünf befasst sich mit der Bekämpfungsbereitschaft der Schattenwirtschaft. Das sechste Kapitel bietet eine Zusammenfassung der Ergebnisse und einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Schattenwirtschaft, Schwarzarbeit, Steuereinnahmen, Makroökonomie, Mikroökonomie, Einkommen-Freizeit-Modell, Steuerbelastung, Transferzahlungen, Regulierungsdichte, Steuermoral, Bekämpfungsbereitschaft.
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch sind die Mindereinnahmen durch Schwarzarbeit in Deutschland?
Schätzungen zufolge belaufen sich die Mindereinnahmen auf etwa 17 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, was rund 370 Milliarden Euro jährlich entspricht.
Was sind die makroökonomischen Folgen der Schattenwirtschaft?
Dazu gehören massive Steuerausfälle, sinkende Einnahmen der Sozialversicherungen, eine Verzerrung des Wettbewerbs und der Verlust von regulären Arbeitsplätzen.
Warum entscheiden sich Menschen für Schwarzarbeit?
Die mikroökonomische Analyse nennt als Motive die hohe Steuer- und Abgabenbelastung, die Regulierungsdichte am Arbeitsmarkt sowie individuelle Präferenzen im Rahmen des Einkommen-Freizeit-Modells.
Was ist das neoklassische Einkommen-Freizeit-Modell?
Es ist ein Modell, das erklärt, wie Individuen ihre Zeit zwischen bezahlter Arbeit und Freizeit aufteilen. Hohe Steuern machen Schwarzarbeit attraktiver, da der Netto-Nutzen der Freizeit im Vergleich zur legalen Arbeit steigt.
Welche Rolle spielt die Steuermoral bei der Schattenwirtschaft?
Eine sinkende Steuermoral und die Akzeptanz von Schwarzarbeit in der Bevölkerung erschweren die staatliche Bekämpfung, da die Schattenwirtschaft oft als „effizienter Freiraum“ wahrgenommen wird.
- Citar trabajo
- Anne Rothkegel (Autor), 2004, Die Auswirkungen der Schattenwirtschaft auf die öffentlichen Finanzen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44453