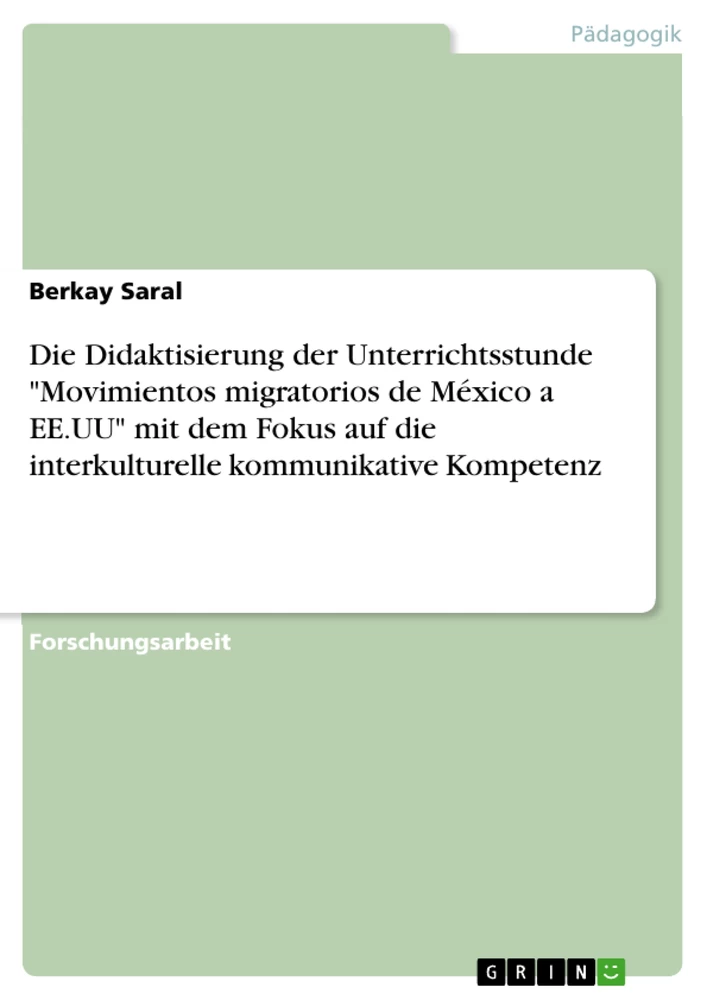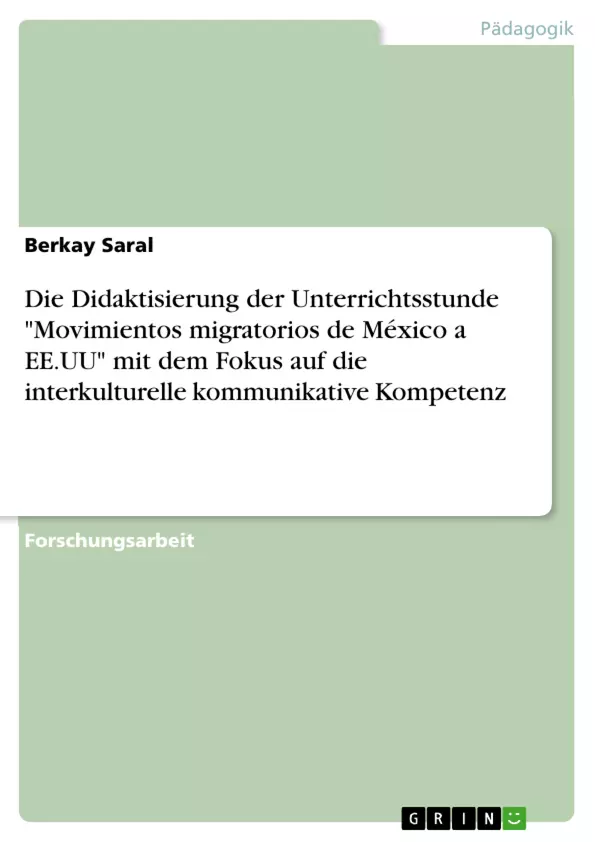Die vorliegende Arbeit thematisiert die Literaturdidaktik im Spanischunterricht mit dem Fokus auf die „interkulturelle kommunikative Kompetenz“. Zunächst erfolgt ein allgemeiner Teil zur fachdidaktischen Perspektive. Hierbei wird auf Kreativität sowie interkulturelles Lernen eingegangen und verdeutlicht, welche Wichtigkeit diese für den Fremdsprachenunterricht darstellen. Im Anschluss daran soll der Fokus auf die Kompetenzen gelegt werden, da diese den Schwerpunkt dieser Arbeit ausmachen sollen. Zudem soll beleuchtet werden, welche Lernziele und Kompetenzen die SuS in der geplanten Unterrichtsstunde erreichen sollen und wie das Thema der “movimientos migratorios de México a EE.UU” im Unterricht behandelt werden kann. Anschließend erfolgt der praktische Teil dieser Arbeit. In diesem Teil wird die Unterrichtsstunde vorgestellt, worin die Angaben zu den Rahmenbedingungen und das Thema des Unterrichtsvorhabens dargestellt werden. Im Anschluss wird das Kernanliegen formuliert und der Stundenverlaufsplan in tabellarischer Form aufgelistet. Des Weiteren wird die 60-minütige Unterrichtsstunde in die Unterrichtsreihe eingeordnet und die didaktische Analyse der Phasen verfasst. Im Fazit soll schließlich die Frage beantwortet werden, ob es für die Lehrkraft im Fremdsprachenunterricht wichtig ist, die interkulturelle kommunikative Kompetenz zu fördern und welche Schwierigkeiten diese mit sich bringt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fachdidaktische Perspektive
- Kreativität im Fremdsprachenunterricht
- Interkulturelles Lernen
- Kompetenzen
- Interkulturelle kommunikative Kompetenz
- Funktionale kommunikative Kompetenz
- Text- und Medienkompetenz
- Die Unterrichtsstunde
- Angaben zur Rahmenbedingungen
- Thema des Unterrichtsvorhabens
- Kernanliegen
- Stundenverlaufsplan
- Einordnung in die Unterrichtsreihe
- Didaktische Analyse der Phasen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Literaturdidaktik im Spanischunterricht, wobei der Fokus auf die "interkulturelle kommunikative Kompetenz" liegt. Sie beleuchtet die Bedeutung von Kreativität und interkulturellem Lernen im Fremdsprachenunterricht und untersucht die relevanten Kompetenzen, die die Lernenden in einer geplanten Unterrichtsstunde erwerben sollen. Die Arbeit zeigt außerdem, wie das Thema der "movimientos migratorios de México a EE.UU\" im Unterricht behandelt werden kann.
- Bedeutung von Kreativität und interkulturellem Lernen im Fremdsprachenunterricht
- Entwicklung und Förderung interkultureller kommunikativer Kompetenz
- Analyse von Kompetenzen, die die Lernenden in der geplanten Unterrichtsstunde erreichen sollen
- Didaktische Umsetzung des Themas "movimientos migratorios de México a EE.UU\" im Spanischunterricht
- Bewertung der Relevanz der interkulturellen kommunikativen Kompetenz für den Fremdsprachenunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert die Zielsetzung sowie den Aufbau. Der Abschnitt "Fachdidaktische Perspektive" beleuchtet zunächst die Bedeutung von Kreativität im Fremdsprachenunterricht und geht dabei auf den gemäßigten Konstruktivismus ein. Im Anschluss wird der Stellenwert von interkulturellem Lernen im Fremdsprachenunterricht herausgearbeitet und die verschiedenen Komponenten der interkulturellen Kompetenz beleuchtet. Das Kapitel "Kompetenzen" behandelt die verschiedenen Kompetenzen, die im Fremdsprachenunterricht von Bedeutung sind, insbesondere die interkulturelle kommunikative Kompetenz.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der "Unterrichtsstunde", die im Detail vorgestellt wird. Dazu gehören die Angaben zu den Rahmenbedingungen, das Thema des Unterrichtsvorhabens, das Kernanliegen, der Stundenverlaufsplan, die Einordnung in die Unterrichtsreihe und eine didaktische Analyse der einzelnen Phasen. Schließlich befasst sich das Fazit mit der Frage, ob die Förderung der interkulturellen kommunikativen Kompetenz für die Lehrkraft im Fremdsprachenunterricht wichtig ist und welche Schwierigkeiten diese mit sich bringt.
Schlüsselwörter
Interkulturelle kommunikative Kompetenz, Fremdsprachenunterricht, Literaturdidaktik, Kreativität, Interkulturelles Lernen, Kompetenzen, Unterrichtsstunde, Didaktische Analyse, "movimientos migratorios de México a EE.UU", Kulturbegriff, Kulturstandards, Stereotypen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist interkulturelle kommunikative Kompetenz?
Es ist die Fähigkeit, in einer Fremdsprache nicht nur grammatikalisch korrekt, sondern auch kulturell angemessen zu kommunizieren und Stereotype zu hinterfragen.
Wie wird das Thema Migration im Spanischunterricht behandelt?
Die Arbeit zeigt eine Didaktisierung am Beispiel der "movimientos migratorios de México a EE.UU", um Schüler für soziale und kulturelle Realitäten zu sensibilisieren.
Warum ist Kreativität im Fremdsprachenunterricht wichtig?
Kreative Methoden fördern laut dem gemäßigten Konstruktivismus die aktive Auseinandersetzung mit der Sprache und steigern die Lernmotivation.
Welche Kompetenzen sollen Schüler in dieser Unterrichtsstunde erwerben?
Neben der interkulturellen Kompetenz stehen funktionale kommunikative Kompetenz sowie Text- und Medienkompetenz im Vordergrund.
Was sind die Schwierigkeiten bei der Vermittlung interkultureller Inhalte?
Herausforderungen liegen oft in der Komplexität von Kulturstandards und der Gefahr, bestehende Stereotypen ungewollt zu verfestigen statt abzubauen.
- Arbeit zitieren
- Berkay Saral (Autor:in), 2017, Die Didaktisierung der Unterrichtsstunde "Movimientos migratorios de México a EE.UU" mit dem Fokus auf die interkulturelle kommunikative Kompetenz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444790