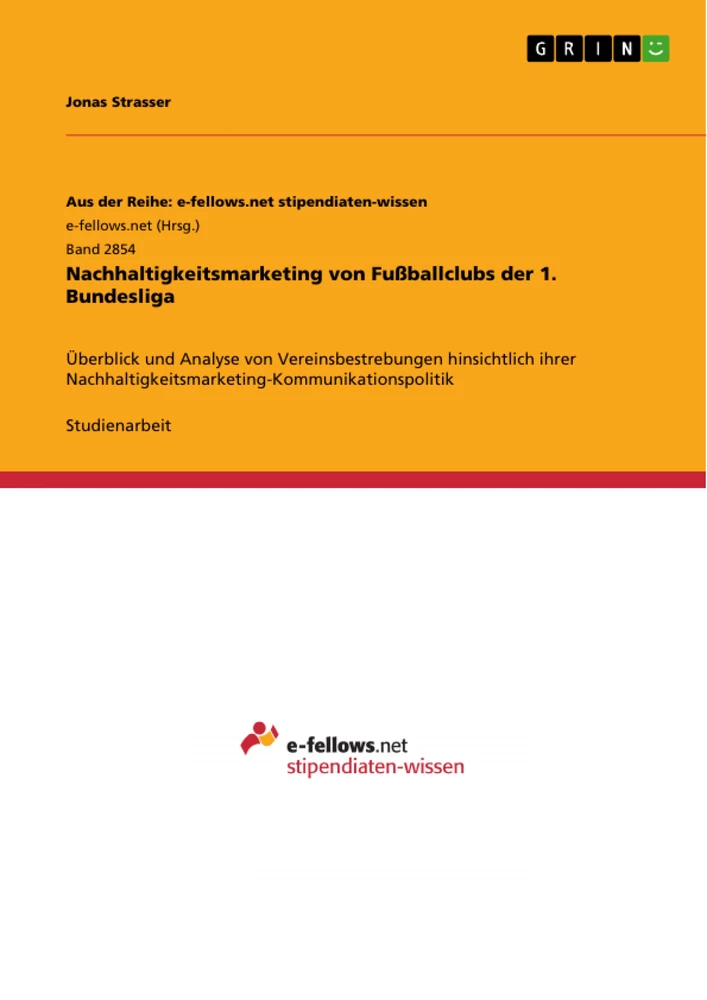„Die Qualität eines Fußballvereins zeigt sich darin, wie er seinen sozialen Aufgaben gerecht wird“, postulierte schon vor etwa 100 Jahren Franz Jacobi, einer der Mitbegründer des BVB. Es scheint, als seien nachhaltiges Engagement in der DNA eines jeden Fußballclubs, doch gerade erst in den vergangenen Jahren lässt sich unter Fußballvereinen ein Trend in Richtung öffentlichkeitswirksamer Übernahme von sozialer Verantwortung oder eine offensiv nachhaltigere Ausgestaltung der Wertschöpfungsketten feststellen: „Der Sport wird grün“ , titelte schon ein deutsches Marketing-Magazin. Tatsächlich befinden sich aktuell viele Unternehmen in einem Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit, doch ist dies tatsächlich auch eine zu erkennende Tendenz bei Bundesliga-Clubs? Oder waren diese vielmehr nicht schon seit ihrer Gründung vorwiegend nachhaltig orientierte Organisationen, die ihre Nachhaltigkeit jetzt in Form ihrer Kommunikationspolitik besonders hervorheben und von daher erst jetzt eine breite Öffentlichkeit darauf aufmerksam wird?
Diese Arbeit gibt neben grundsätzlicher Begriffsklärungen eine grobe Übersicht darüber, inwiefern Bundesliga-Clubs mit dem Thema Nachhaltigkeitsmarketing umgehen, welche Strategien und allen voran welche konkreten Maßnahmen hier besonders zum Tragen kommen. Deutlich gemacht wird dies an den zwei Beispielen von Borussia Dortmund und dem Hamburger SV. Aufgrund ihrer existenziellen Ausrichtung in Richtung der sportlichen Ertüchtigung sowie weiterer gemeinnütziger Zwecke verfolgen Fußballvereine ohnehin in ihrem strategischen und operativen Marketing tendenziell gemeinwirtschaftliche Zwecke. Dennoch veröffentlicht beispielsweise der BVB wie viele rein profitorientierte Unternehmen immer häufiger CR-Berichte gemäß internationaler Standards - dies mag in vielerlei Hinsicht sehr positiv sein, allerdings ist die Gefahr groß, dass es schnell zu einer viel weitreichenderen Amnesie hinsichtlich des ursprünglich sozial ausgerichteten Club-Selbstverständnisses kommen kann, wenn solche Maßnahmen vorrangig von Marketing-Abteilungen und nicht aus der intrinsischen Motivation aller Vereinsmitglieder selbst heraus angetrieben werden. So viele Pros und Kontras es auch gibt: Deutschen Bundesliga-Clubs kommt eine immense gesellschaftliche Aufmerksamkeit und dadurch Verantwortung zu - mit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsmarketing können sie so zweifelsfrei einen nicht zu unterschätzenden Beitrag für eine ökonomische, ökologische und soziale Entwicklung leisten.
Inhaltsverzeichnis
- Nachhaltigkeitsmarketing von Bundesliga-Clubs - ein neuer Trend?
- Überblick über Nachhaltigkeitsmarketing im Allgemeinen und diverse Implikationen
- Begriffsklärung der Marketing-Norm Nachhaltigkeit
- Grundlegende marketingtheoretische Einordnung
- Strategische und operative Zielsetzungen
- Nachhaltigkeitsmarketing von Profifußballclubs
- Überblick zu deutschen Bundesliga-Clubs und deren organisationaler Aufbauten
- Besonderheiten im Marketing von Fußballclubs
- Überblick zu Club-Bestrebungen im Bereich Nachhaltigkeit
- Status Quo der Nachhaltigkeits-Außenkommunikation der Vereine in der 1. Bundesliga im Überblick
- Analyse der Nachhaltigkeitsmarketing-Kommunikationspolitik zweier konkreter Bundesliga-Clubs
- Nachhaltigkeitsmarketing von Borussia Dortmund
- Nachhaltigkeitsmarketing des Hamburger SV
- Resümierende Gegenüberstellung beider Club-Aktivitäten
- Kritische Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht das Nachhaltigkeitsmarketing von Fußballclubs der 1. Bundesliga. Ziel ist es, einen Überblick über die Strategien und Maßnahmen der Vereine in diesem Bereich zu geben und deren Kommunikationspolitik zu analysieren. Die Arbeit klärt grundlegende Begriffe und untersucht den Status Quo der Nachhaltigkeitsbestrebungen.
- Definition und Einordnung von Nachhaltigkeitsmarketing
- Struktureller Aufbau und Besonderheiten im Marketing von Bundesliga-Clubs
- Analyse der Nachhaltigkeits-Kommunikationspolitik ausgewählter Vereine
- Status Quo und zukünftige Entwicklungen im Nachhaltigkeitsmarketing von Fußballclubs
- Vergleichende Betrachtung unterschiedlicher Vereinsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Nachhaltigkeitsmarketing von Bundesliga-Clubs - ein neuer Trend?: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage, ob das Engagement von Bundesliga-Clubs im Bereich Nachhaltigkeit ein neuer Trend ist oder ob es sich um eine verstärkte Kommunikation bereits bestehender nachhaltiger Praktiken handelt. Die Arbeit wird strukturiert und die methodische Vorgehensweise skizziert. Der Bezug auf Franz Jacobi und die Überschrift eines Marketing-Magazins verdeutlicht die Relevanz des Themas und den Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit im Sport. Die Arbeit verspricht eine Begriffsklärung, einen Überblick über den Umgang der Bundesliga-Clubs mit Nachhaltigkeitsmarketing und eine Analyse konkreter Maßnahmen.
Überblick über Nachhaltigkeitsmarketing im Allgemeinen und diverse Implikationen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Nachhaltigkeit und Marketing und deren Zusammenführung im Nachhaltigkeitsmarketing. Es erläutert den Begriff der Nachhaltigkeit ausgehend vom Brundtland-Bericht und den drei Säulen Ökonomie, Ökologie und Soziales. Die marketingtheoretische Einordnung beschreibt Marketing als Ausrichtung der Unternehmensaktivitäten auf die Bedürfnisse der Nachfrager und den Einsatz klassischer Marketinginstrumente. Nachhaltigkeitsmarketing wird als langfristige, werteorientierte Marketingkonzeption positioniert, die über ein rein ökonomisches Kalkül hinausgeht und soziale und ökologische Aspekte berücksichtigt. Strategische und operative Ziele des Nachhaltigkeitsmarketings werden ebenfalls erörtert, mit Fokus auf Kundenbindung, Stakeholder-Management und authentischer Kommunikation.
Nachhaltigkeitsmarketing von Profifußballclubs: Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über den strukturellen Aufbau deutscher Bundesliga-Clubs und die Besonderheiten ihres Marketings. Es werden die spezifischen Herausforderungen und Chancen im Kontext von Nachhaltigkeit beleuchtet. Der Status Quo der Nachhaltigkeitsbestrebungen der Vereine und die Art und Weise ihrer Vermarktung wird analysiert. Dieser Abschnitt legt die Grundlage für die anschließende Fallstudienanalyse, indem er den Kontext und das Umfeld der Nachhaltigkeitsbemühungen von Fußballclubs beschreibt.
Schlüsselwörter
Nachhaltigkeitsmarketing, Bundesliga, Fußballclubs, soziale Verantwortung, Kommunikationspolitik, Nachhaltigkeit, Marketingstrategie, Stakeholder-Management, Unternehmenskommunikation, Ökologie, Ökonomie, Soziales.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Nachhaltigkeitsmarketing von Bundesliga-Clubs - ein neuer Trend?
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Studienarbeit untersucht das Nachhaltigkeitsmarketing von Fußballclubs der 1. Bundesliga. Sie analysiert die Strategien und Maßnahmen der Vereine in diesem Bereich und deren Kommunikationspolitik. Ein Schwerpunkt liegt auf der Klärung grundlegender Begriffe und der Untersuchung des Status Quo der Nachhaltigkeitsbestrebungen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Definition und Einordnung von Nachhaltigkeitsmarketing, den strukturellen Aufbau und Besonderheiten im Marketing von Bundesliga-Clubs, eine Analyse der Nachhaltigkeits-Kommunikationspolitik ausgewählter Vereine, den Status Quo und zukünftige Entwicklungen im Nachhaltigkeitsmarketing von Fußballclubs sowie einen Vergleich unterschiedlicher Vereinsansätze.
Welche Vereine werden im Detail untersucht?
Die Arbeit analysiert die Nachhaltigkeitsmarketing-Kommunikationspolitik von Borussia Dortmund und dem Hamburger SV im Detail und vergleicht deren Aktivitäten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage stellt und den Aufbau der Arbeit skizziert. Es folgen Kapitel zu Nachhaltigkeitsmarketing im Allgemeinen, Nachhaltigkeitsmarketing von Profifußballclubs, einer detaillierten Analyse der Fallstudien (Borussia Dortmund und Hamburger SV) und einer kritischen Zusammenfassung mit Ausblick.
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Die konkreten Ergebnisse der Analyse der Nachhaltigkeitsmarketing-Aktivitäten von Borussia Dortmund und dem Hamburger SV werden im Hauptteil der Arbeit dargelegt. Die Arbeit liefert einen Überblick über den Status Quo, identifiziert Best Practices und zeigt Unterschiede in den Ansätzen der Vereine auf. Die Schlussfolgerung beinhaltet eine kritische Bewertung und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Nachhaltigkeitsmarketing von Fußballclubs.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die methodische Vorgehensweise wird in der Einleitung skizziert. Die Arbeit kombiniert deskriptive Elemente (Überblicke, Beschreibungen) mit einer analytischen Betrachtung der Fallstudien. Der genaue methodische Ansatz wird im Hauptteil der Arbeit detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselbegriffe werden verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Nachhaltigkeitsmarketing, Bundesliga, Fußballclubs, soziale Verantwortung, Kommunikationspolitik, Nachhaltigkeit, Marketingstrategie, Stakeholder-Management, Unternehmenskommunikation, Ökologie, Ökonomie, Soziales.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob das Engagement von Bundesliga-Clubs im Bereich Nachhaltigkeit ein neuer Trend ist oder ob es sich um eine verstärkte Kommunikation bereits bestehender nachhaltiger Praktiken handelt.
Wie wird Nachhaltigkeit in der Arbeit definiert?
Die Arbeit definiert Nachhaltigkeit ausgehend vom Brundtland-Bericht und den drei Säulen Ökonomie, Ökologie und Soziales. Nachhaltigkeitsmarketing wird als langfristige, werteorientierte Marketingkonzeption positioniert, die über ein rein ökonomisches Kalkül hinausgeht und soziale und ökologische Aspekte berücksichtigt.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit Sportmarketing, Nachhaltigkeitsmanagement und Unternehmenskommunikation beschäftigen, sowie für Fußballclubs, Marketing-Fachleute und alle Interessierten, die sich für Nachhaltigkeit im Sport interessieren.
- Citar trabajo
- Jonas Strasser (Autor), 2018, Nachhaltigkeitsmarketing von Fußballclubs der 1. Bundesliga, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/445070