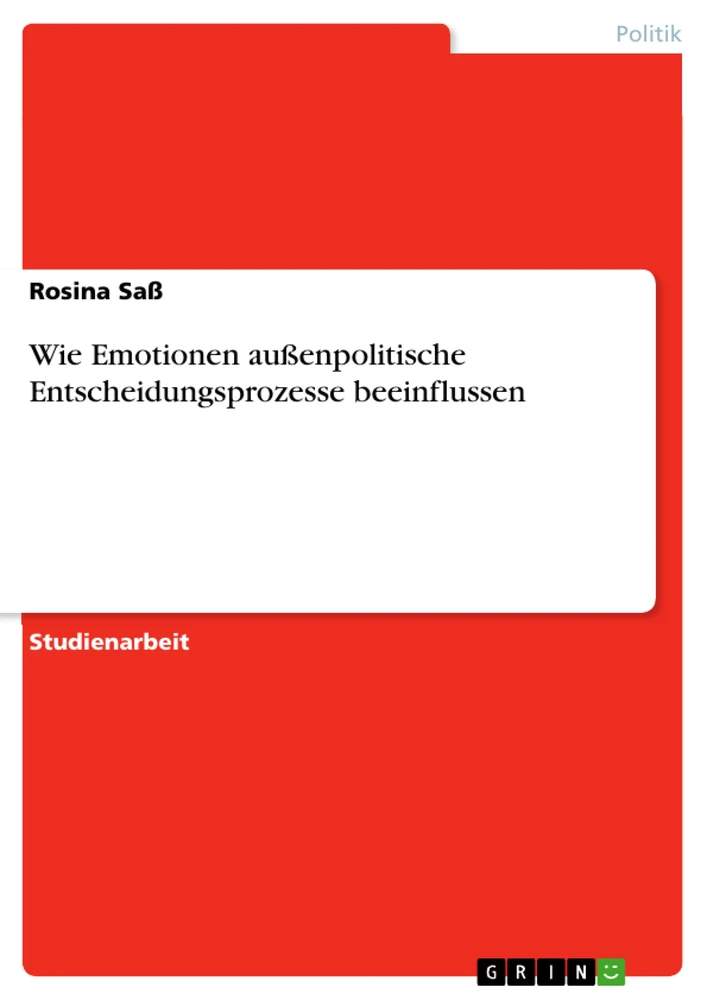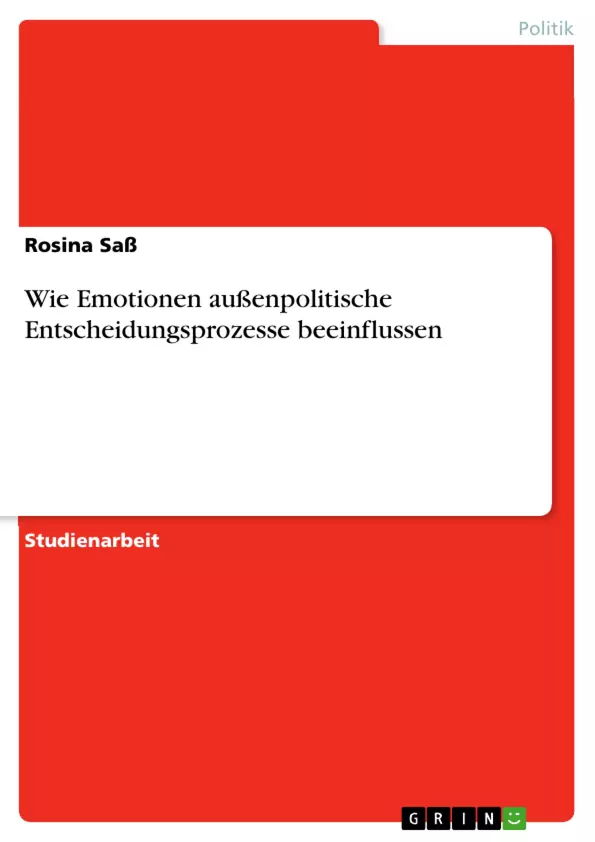Wenn man liest, welche Art von terroristischen Anschlägen in Europa in den letzten zwei Jahren geschehen sind, wird man emotional. Man verspürt Wut auf die Verantwortlichen und Mitgefühl mit den Betroffenen, vielleicht Demütigung und den Willen nach Rache, sowie ein Zusammengehörigkeitsgefühl als Europäer. Doch welchen Einfluss nehmen solche Emotionen auf Politiker und somit auf die außenpolitischen Entscheidungsprozesse, die solchen Ereignissen folgen? Befasst man sich mit außenpolitischen Entscheidungsprozessen, stößt man vor allem auf das Rational Choice Modell. Dieses besagt, dass Menschen sich immer rational für diejenige Handlungsoption entscheiden, die den größtmöglichen Gewinn bedeutet. Emotionen werden hier traditionell als Gegenteil zur rationalen Handlung und als störend angesehen. Andere Autoren sehen Emotionen allerdings als eine Erweiterung des Rational Choice Modells.
Der Begriff der Emotion umfasst die Bewertung eines situationsbedingten Impulses oder Kontextes sowie gegebenenfalls eine damit verbundene körperliche Reaktion. Ein wichtiger Bestandteil einer Emotion ist außerdem ihre Intentionalität. Emotionen und ihre Äußerung können weiterhin kulturell bedingt sein. Emotionen sind kurzweilig und brauchen einen Auslöser. Sie können aber längerfristig sein, wenn sich die Auslöser wiederholen, wie z.B. bei Patriotismus. Der Akteur oder die Akteurin wird durch eine Emotion in Handlungsbereitschaft versetzt. Dabei spielen Emotionen auch eine evaluierende Rolle, indem sie stark oder schwach ausfallen. Allerdings kann keine Differenzierung in Bezug auf ein Objekt stattfinden, Emotionen sind also ein „homogener state of mind“ (Schnabel 2005). In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, wie Emotionen außenpolitische Entscheidungsprozesse beeinflussen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Emotionen und Rational Choice
- Amerikanische Außenpolitik nach 9/11
- In-Group/Out-Group Theorie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den Einfluss von Emotionen auf außenpolitische Entscheidungsprozesse. Sie untersucht, wie Emotionen das Rational Choice Modell beeinflussen oder erweitern können, und beleuchtet den Einfluss von Gruppenzugehörigkeiten und Gruppenemotionen.
- Der Einfluss von Emotionen auf das Rational Choice Modell
- Die Rolle von Gruppenzugehörigkeiten und Gruppenemotionen
- Die amerikanische Außenpolitik nach 9/11 im Kontext von Emotionen
- Die Relevanz von Emotionen für das Verständnis außenpolitischer Entscheidungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und führt in die Thematik der Emotionen im Kontext von außenpolitischen Entscheidungsprozessen ein. Dabei werden Beispiele für terroristische Anschläge in Europa herangezogen, um die emotionalen Reaktionen von Politikern und der Bevölkerung zu veranschaulichen.
Emotionen und Rational Choice
Dieses Kapitel beleuchtet das Rational Choice Modell und untersucht die Beziehung zwischen Emotionen und Rationalität. Es analysiert, wie Emotionen das Modell beeinflussen oder erweitern können und untersucht verschiedene Relationen zwischen Emotion und Rationalität.
Amerikanische Außenpolitik nach 9/11
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die amerikanische Außenpolitik nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und analysiert, wie Emotionen wie Demütigung die Entscheidungen der amerikanischen Regierung beeinflusst haben könnten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Emotionen, Rational Choice, außenpolitische Entscheidungsprozesse, Gruppenzugehörigkeit, Gruppenemotionen und die amerikanische Außenpolitik nach 9/11.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen Emotionen politische Entscheidungen?
Emotionen wie Wut, Angst oder Demütigung können Politiker dazu bringen, von rein rationalen Kosten-Nutzen-Abwägungen abzuweichen und impulsivere oder symbolischere Entscheidungen zu treffen.
Was besagt das Rational Choice Modell?
Dieses Modell geht davon aus, dass Akteure stets die Handlungsoption wählen, die ihren persönlichen oder staatlichen Nutzen maximiert. Emotionen wurden hier lange Zeit als Störfaktoren betrachtet.
Welche Rolle spielten Emotionen nach den Anschlägen vom 11. September?
Emotionen wie Demütigung und der Wunsch nach Vergeltung prägten die amerikanische Außenpolitik maßgeblich und führten zu weitreichenden militärischen Entscheidungen.
Was ist die In-Group/Out-Group Theorie?
Sie beschreibt, wie die Zugehörigkeit zu einer Gruppe (In-Group) Gefühle von Solidarität stärkt, während andere Gruppen (Out-Group) oft abgewertet oder als Bedrohung wahrgenommen werden, was Außenpolitik beeinflusst.
Können Emotionen rational sein?
Einige Autoren sehen Emotionen als Erweiterung der Rationalität, da sie helfen, Prioritäten zu setzen und komplexe Situationen schnell zu bewerten.
- Citation du texte
- Rosina Saß (Auteur), 2017, Wie Emotionen außenpolitische Entscheidungsprozesse beeinflussen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446043