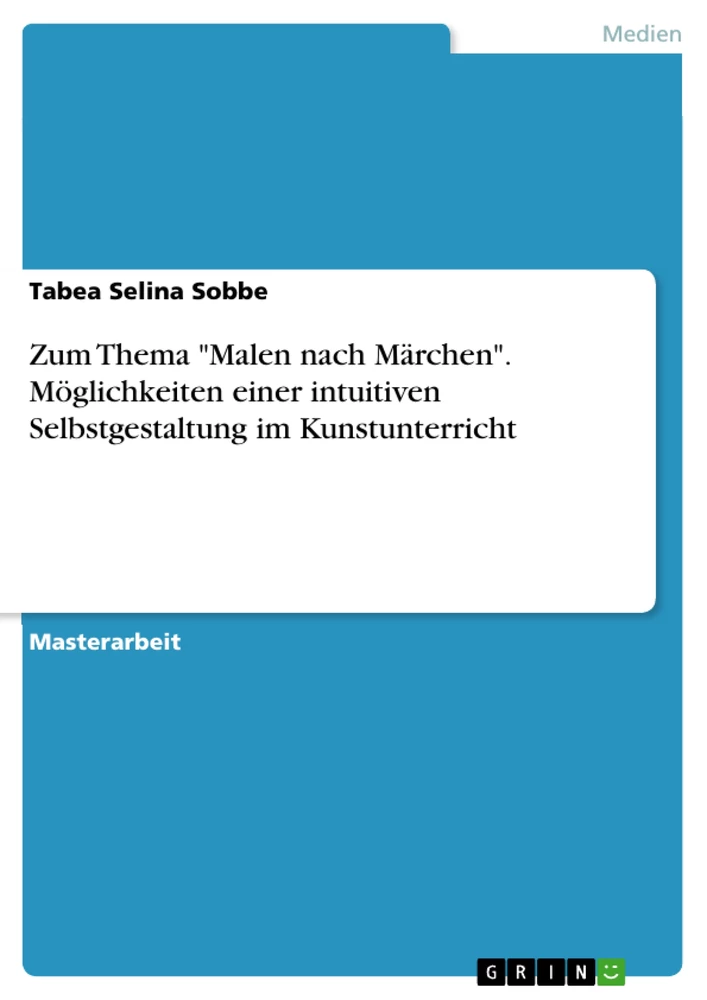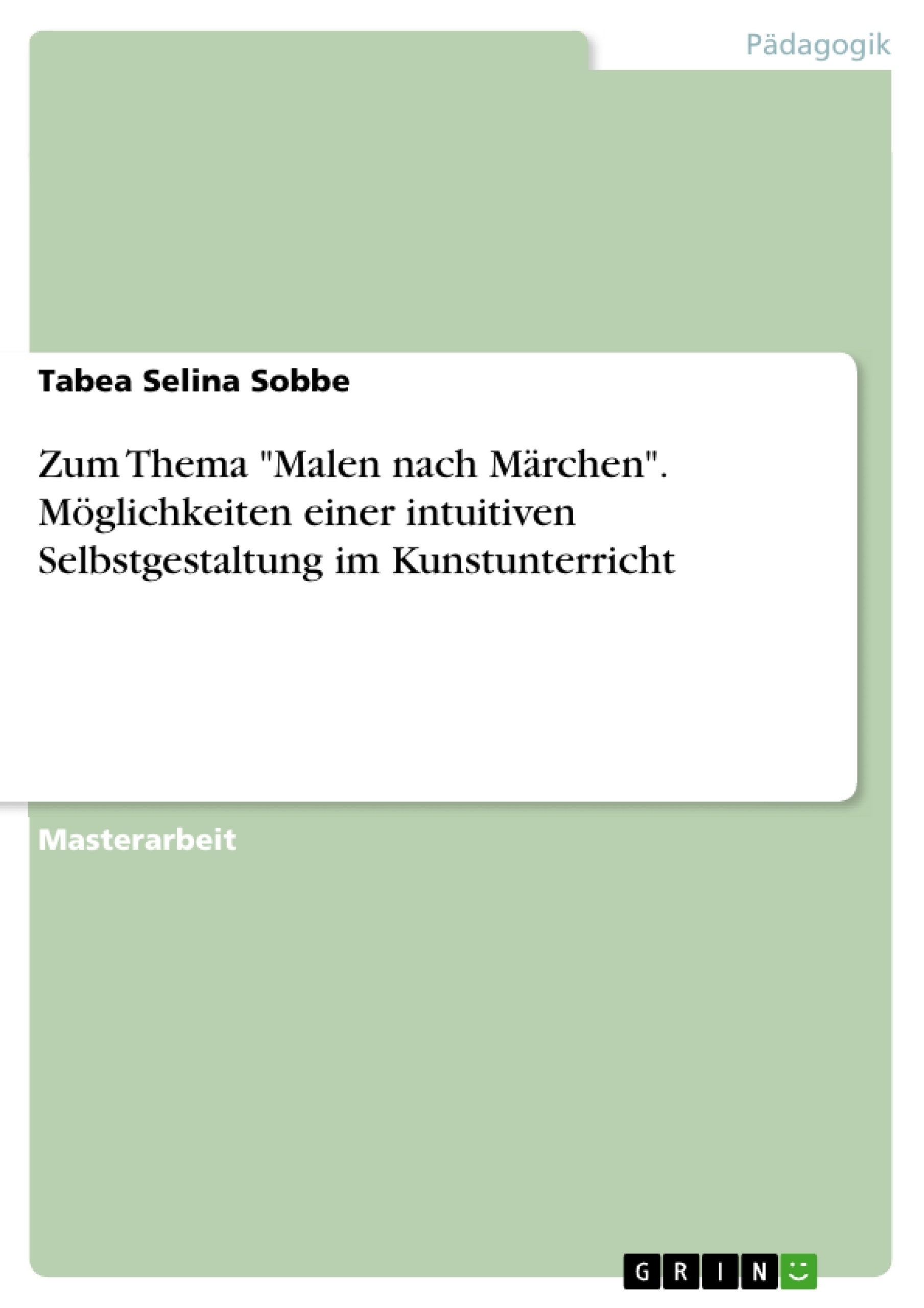Die meisten Menschen haben Lieblingsmärchen, besonders aus der Grimm’schen Sammlung, die sie in ihrer Kindheit gelesen oder gehört haben. Doch der Zauber, der von diesen Erzählungen ausgeht, verliert mit zunehmendem Alter seinen Reiz. Möglicherweise erinnern wir uns noch schemenhaft an die Handlung von Schneewittchen oder Aschenputtel, deren Darstellungen nicht nur in Märchenbüchern erscheinen, sondern uns im Alltag durch zahlreiche Konsumgüter begleiten.
Die Geschichten, die uns als Kinder so faszinierten, erfahren im Jugend- und Erwachsenenalter einen Wandel hin zu wirklichkeitsfremden Träumereien oder geradezu zu Lügen. Dadurch erzählen immer weniger Eltern ihren Kindern Märchen, sie haben Angst, falsche moralische und gesellschaftliche Vorstellungen zu vermitteln.
Im Zusammenhang mit erzieherischen Konzepten weisen wissenschaftliche Untersuchungen nach, dass viele Heranwachsende in einer seelisch und physisch gesundheitsschädigenden Umgebung groß werden. Das Fehlen von Geborgenheit und innigen Beziehungen kann der Auslöser für tiefe psychische Konflikte, wie der Unfähigkeit Vertrauen aufzubauen oder sich selbstständig zu beschäftigen, sein.
Eben weil dem Kind sein Leben häufig irritierend vorkommt, muss man ihm Wege eröffnen, um Selbsterfahrungen zu gewinnen und seine Emotionen zu begreifen. Das Kind benötigt Impulse, die ihm helfen, in seinem Gefühlsleben und Alltag Strukturen aufzubauen, und es bedarf einer moralischen Wertevermittlung, um unbewusst Konsequenzen von unmoralischen Tätigkeiten zu lernen. All diese Möglichkeiten eröffnen sich im Märchen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das europäische Volksmärchen
- 2.1 Terminologische und etymologische Begriffsbestimmung
- 2.2 Geschichtliche Erkenntnisse der europäischen Märchen
- 2.3 Literarische Gattungsmerkmale des Volksmärchens
- 2.4 Die ursprüngliche Funktion des Märchens
- 3. Brauchen Kinder heute noch Märchen?
- 3.1 Das Märchenalter
- 3.2 Das zauberhafte Denken des Kindes
- 3.3 Märchen als Unterstützung in den kindlichen Entwicklungsphasen
- 3.4 Märchen als Mittel interkulturellen Lernens
- 3.5 Mediale Adaptionen von Volksmärchen
- 4. Der Einsatz von Märchen in der psychotherapeutischen Behandlung von Kindern
- 4.1 Das Konzept einer Maltherapie nach Carl Gustav Jung
- 4.1.1 Das kollektive Unbewusste
- 4.1.2 Malen zu einem archetypischen Motiv
- 4.2 Die tiefenpsychologische Methode Malen nach Märchen
- 4.3 Maltherapeutische Märchenarbeit in der Gruppe
- 4.4 Die maltherapeutische Wirkung der Märchenarbeit
- 4.1 Das Konzept einer Maltherapie nach Carl Gustav Jung
- 5. Psychoanalytische Ansätze im gymnasialen Kunstunterricht einer fünften Klasse - auf der Grundlage der Methode Malen nach Märchen
- 5.1 Legitimation der maltherapeutisch orientierten Märchenarbeit im Kunstunterricht
- 5.2 Individuelle und soziale Voraussetzungen der Lerngruppe
- 5.3 Exemplarische Gestaltungsaufgaben aus der therapieorientierten Märchenreihe im Kunstunterricht
- 5.3.1 Illustrationen kolorieren – Die Wirkung von Farben und Kontrasten in Märchenbildern
- 5.3.2 Ein unbekanntes Märchen weiterführen
- 5.3.2.1 Aktive Imagination und Fünf-Minuten-Schreiben
- 5.3.2.2 „Furchtbare“ Märchencollagen – Ein Volksmärchen gestalterisch weiterführen und umformen
- 5.3.3 Märchenrequisiten – Mit verschiedenen Maltechniken und -materialien experimentieren
- 5.3.4 Mein Lieblingsmärchen – Eine Märchenszene malen
- 5.3.5 Märchenfiguren als Projektionsträger - Ein Gruppenbild für das Märchenbuchcover
- 5.4 Reflexion und Auswertung der Märcheneinheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Möglichkeiten einer intuitiven Selbstgestaltung im Kunstunterricht mithilfe der Methode „Malen nach Märchen“. Ziel ist es, die Einbindung psychoanalytischer Ansätze, speziell der Maltherapie mit Märchen, in den multikulturellen Kunstunterricht zu evaluieren und deren Wirksamkeit im Hinblick auf die Förderung der persönlichen Entfaltung von Schülerinnen und Schülern zu belegen.
- Die Bedeutung von Märchen in der kindlichen Entwicklung
- Der Einsatz von Märchen in der Kunst- und Gestaltungstherapie
- Die Methode „Malen nach Märchen“ als didaktisches Konzept im Kunstunterricht
- Die Reflexion individueller und sozialer Prozesse im Kunstunterricht durch die Auseinandersetzung mit Märchen
- Die Rolle von Kreativität und intuitiver Selbstgestaltung im Lernprozess
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die grundlegende Fragestellung der Arbeit vor: die Möglichkeit der Integration von Maltherapie mit Märchen in den Kunstunterricht zur Förderung intuitiver Selbstgestaltung. Sie argumentiert, dass Märchen, trotz des Verlustes an Bedeutung in der heutigen Gesellschaft, wertvolle Werkzeuge zur Bewältigung innerer Konflikte und zur Persönlichkeitsentwicklung sein können. Die Einleitung verweist auf die Notwendigkeit, Kindern Wege zur Selbsterfahrung und zum Verständnis ihrer Emotionen zu eröffnen, eine Aufgabe, die Märchen erfüllen können. Der Bezug auf wissenschaftliche Studien unterstreicht die Bedeutung von Geborgenheit und positiven Beziehungen für die kindliche Entwicklung und verdeutlicht, wie Märchen in diesem Kontext unterstützen können.
2. Das europäische Volksmärchen: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit dem europäischen Volksmärchen. Es beginnt mit einer terminologischen und etymologischen Begriffsbestimmung und beleuchtet die geschichtlichen Hintergründe der Entstehung von Märchen. Anschließend werden die literarischen Gattungsmerkmale des Volksmärchens unter stilistischer und struktureller Analyse erörtert, wobei die ursprüngliche Funktion des Märchens im Fokus steht. Dieser Abschnitt legt das notwendige theoretische Fundament für die spätere Untersuchung der Anwendung von Märchen im pädagogischen und therapeutischen Kontext.
3. Brauchen Kinder heute noch Märchen?: Das Kapitel hinterfragt die Relevanz und Aktualität von Märchen im 21. Jahrhundert. Es beleuchtet die Bedeutung des „Märchenalters“, das zauberhafte Denken des Kindes und die unterstützende Rolle von Märchen in verschiedenen kindlichen Entwicklungsphasen. Weiterhin wird die Bedeutung von Märchen als Mittel interkulturellen Lernens und die Thematik der medialen Adaptionen von Volksmärchen behandelt. Der Fokus liegt auf dem Nachweis des anhaltenden Wertes von Märchen für die kindliche Entwicklung und das Erwachsenwerden in der heutigen Zeit.
4. Der Einsatz von Märchen in der psychotherapeutischen Behandlung von Kindern: Dieses Kapitel untersucht den Einsatz von Märchen in der psychotherapeutischen Arbeit mit Kindern. Es erläutert das Konzept der Maltherapie nach Carl Gustav Jung, inklusive des Konzepts des kollektiven Unbewussten und der Bedeutung des Malens zu archetypischen Motiven. Die tiefenpsychologische Methode „Malen nach Märchen“, deren Anwendung in Gruppensettings und deren therapeutische Wirkung werden detailliert beschrieben. Der Abschnitt verbindet theoretische Grundlagen mit praktischen Anwendungsmöglichkeiten der Märchenarbeit in der Therapie.
5. Psychoanalytische Ansätze im gymnasialen Kunstunterricht einer fünften Klasse - auf der Grundlage der Methode Malen nach Märchen: Dieses Kapitel beschreibt die Umsetzung der maltherapeutisch orientierten Märchenarbeit im Kunstunterricht einer fünften Klasse. Es beleuchtet die Legitimation dieses Ansatzes im schulischen Kontext und berücksichtigt die individuellen und sozialen Voraussetzungen der Lerngruppe. Es präsentiert exemplarische Gestaltungsaufgaben, wie das Kolorieren von Illustrationen, das Weiterführen unbekannter Märchen mittels aktiver Imagination und Fünf-Minuten-Schreiben, die Gestaltung von Märchencollagen und das Experimentieren mit verschiedenen Maltechniken. Die Kapitel beschreibt die Durchführung der einzelnen Aufgaben und die angestrebte Reflexion und Auswertung der Einheit.
Schlüsselwörter
Märchen, Maltherapie, Kunsttherapie, Intuitive Selbstgestaltung, Kindliche Entwicklung, Psychoanalyse, Kunstunterricht, Interkulturelles Lernen, Volksmärchen, Carl Gustav Jung, Archetypen, Gestaltungsaufgaben, Reflexion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Psychoanalytische Ansätze im gymnasialen Kunstunterricht - Malen nach Märchen
Was ist das Thema der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Möglichkeiten intuitiver Selbstgestaltung im Kunstunterricht mithilfe der Methode „Malen nach Märchen“. Sie evaluiert die Einbindung psychoanalytischer Ansätze, speziell der Maltherapie mit Märchen, in den multikulturellen Kunstunterricht und beleuchtet deren Wirksamkeit bei der Förderung der persönlichen Entfaltung von Schülerinnen und Schülern.
Welche Inhalte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine umfassende Auseinandersetzung mit europäischen Volksmärchen, ihrer Bedeutung in der kindlichen Entwicklung und ihrem Einsatz in der Kunst- und Gestaltungstherapie. Sie beschreibt die Methode „Malen nach Märchen“ als didaktisches Konzept, reflektiert individuelle und soziale Prozesse im Kunstunterricht und beleuchtet die Rolle von Kreativität und intuitiver Selbstgestaltung im Lernprozess. Ein besonderer Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung im Kunstunterricht der 5. Klasse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung, 2. Das europäische Volksmärchen, 3. Brauchen Kinder heute noch Märchen?, 4. Der Einsatz von Märchen in der psychotherapeutischen Behandlung von Kindern und 5. Psychoanalytische Ansätze im gymnasialen Kunstunterricht einer fünften Klasse - auf der Grundlage der Methode Malen nach Märchen. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas, beginnend mit einer theoretischen Einführung über Märchen bis hin zur praktischen Anwendung im Unterricht.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Wirksamkeit der Methode „Malen nach Märchen“ im Kunstunterricht zu belegen. Es soll gezeigt werden, wie Märchen als Werkzeug zur Bewältigung innerer Konflikte und zur Persönlichkeitsentwicklung eingesetzt werden können und wie sie die intuitive Selbstgestaltung von Schülern fördern.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit kombiniert theoretische Analysen von Märchen und deren Bedeutung mit der praktischen Umsetzung der Methode „Malen nach Märchen“ im Kunstunterricht. Sie stützt sich auf psychoanalytische Ansätze, insbesondere die Maltherapie nach Carl Gustav Jung. Die Auswertung der praktischen Arbeit im Kunstunterricht ist integraler Bestandteil der Arbeit.
Welche Rolle spielt die Maltherapie nach Carl Gustav Jung?
Die Maltherapie nach Carl Gustav Jung bildet eine wichtige Grundlage der Arbeit. Das Konzept des kollektiven Unbewussten und die Bedeutung des Malens zu archetypischen Motiven werden erläutert und in den Kontext der Märchenarbeit eingebunden. Die Methode „Malen nach Märchen“ wird als Anwendung dieser therapeutischen Ansätze im pädagogischen Kontext vorgestellt.
Wie wird die Methode „Malen nach Märchen“ im Kunstunterricht umgesetzt?
Die Arbeit beschreibt exemplarische Gestaltungsaufgaben, die im Kunstunterricht der 5. Klasse umgesetzt wurden. Dazu gehören das Kolorieren von Illustrationen, das Weiterführen von Märchen, die Gestaltung von Collagen und das Experimentieren mit verschiedenen Maltechniken. Die Reflexion der Schüler und die Auswertung der Einheit werden ebenfalls detailliert beschrieben.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Pädagogen, Kunsttherapeuten, Psychologen und alle, die sich für den Einsatz von Märchen in der Bildung und Therapie interessieren. Sie bietet praktische Anregungen für den Kunstunterricht und liefert theoretische Grundlagen zum Verständnis der Bedeutung von Märchen in der kindlichen Entwicklung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Märchen, Maltherapie, Kunsttherapie, Intuitive Selbstgestaltung, Kindliche Entwicklung, Psychoanalyse, Kunstunterricht, Interkulturelles Lernen, Volksmärchen, Carl Gustav Jung, Archetypen, Gestaltungsaufgaben, Reflexion.
- Citar trabajo
- Tabea Selina Sobbe (Autor), 2017, Zum Thema "Malen nach Märchen". Möglichkeiten einer intuitiven Selbstgestaltung im Kunstunterricht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446594