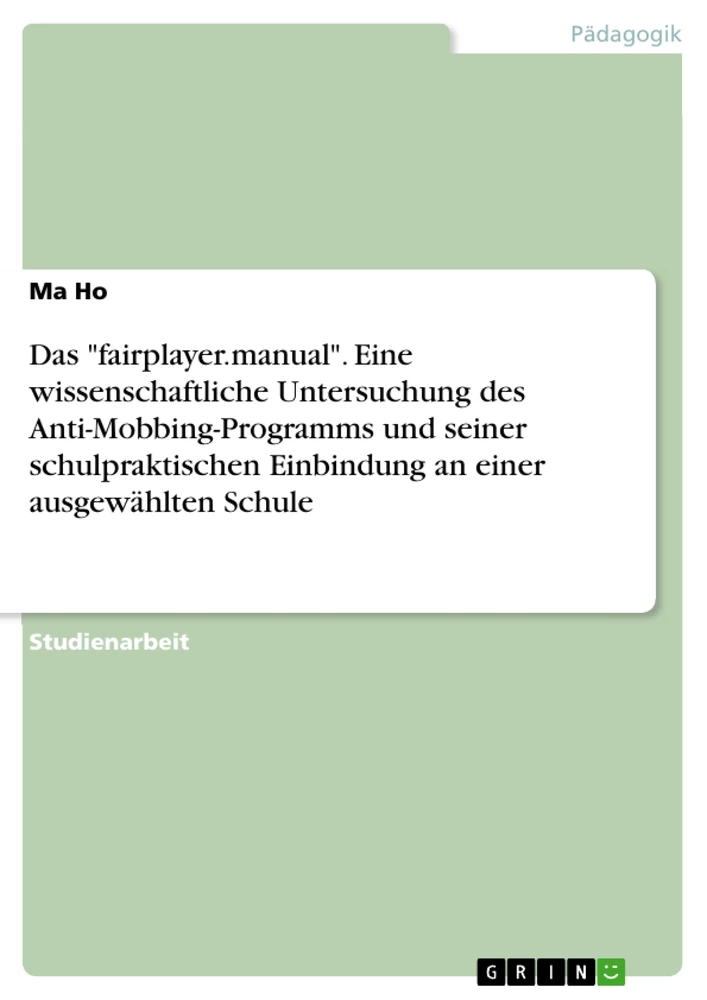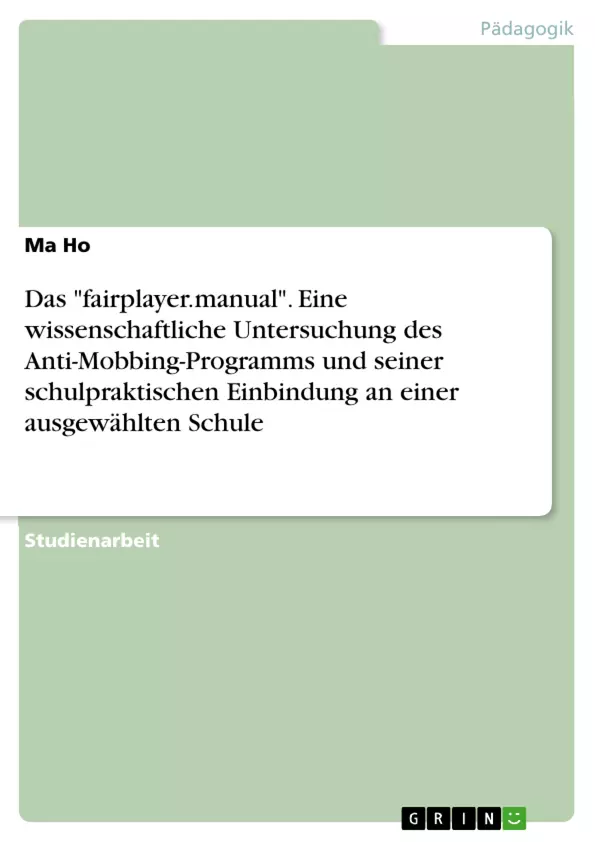Diese Arbeit analysiert das "fairplayer.manual" gegen Mobbing und Gewalt und untersucht dessen praktische Einbindung in den schulischen Unterricht an einer Beispielschule. Bei dieser Beispielschule handelt es sich um eine ausgewählte Realschule in Hessen.
Die Analyse des "fairplayer.manuals" geschieht in nachfolgender Gliederung: Zunächst wird als Grundlage für die wissenschaftliche Untersuchung mit der Definition von Mobbing und der kurzen Skizzierung seiner Erscheinungsformen begonnen. Gliederungspunkt 2.2 belegt anschließend durch empirische Studien die gesellschaftliche Notwendigkeit, Mobbing und Gewalt bereits in der Schule entgegenzuwirken. Punkt 2.3 stellt das Verständnis der ausgewählten Beispielschule dar, nach welchem Mobbing und Gewalt präventiv im Rahmen einer schulischen Friedenserziehung aufgelöst werden sollen. Der anschließende Gliederungspunkt 2.4 arbeitet die Gründe heraus, weshalb sich die hessische Realschule für die Realisierung der Friedenserziehung mit Hilfe des "fairplayer.manuals" entschieden hat. 2.5 stellt zunächst die Grundgedanken und Materialien des fairplayer Programms vor, bevor in 2.6 seine konkrete Implementierung in den Unterricht an der Beispielschule detailliert geschildert wird. Im Fazit in Punkt 3 werden diese Aspekte abschließend zusammenfassend bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das fairplayer.manual gegen Mobbing und Gewalt in der Schule
- 2.1 Definition und Erscheinungsformen von Mobbing und Gewalt in der Schule
- 2.2 Die durch Studien belegte Notwendigkeit Mobbing und Gewalt in der Schule entgegenzuwirken
- 2.3 Das fairplayer.manual als Ansatz zur Lösung der geschilderten gesellschaftlichen Probleme
- 2.4 Die Entscheidungsgründe für den Einsatz des fairplayer.manuals
- 2.5 Die Grundgedanken und Materialien des fairplayer.manuals
- 2.6 Die Implementierung des fairplayer.manuals an der Beispielschule
- 2.6.1 Die Einbindung des fairplayer.manuals in den Unterricht und seine Struktur
- 2.6.2 Eine exemplarische fairplayer Stunde A
- 2.6.3 Eine exemplarische fairplayer Stunde B
- 2.6.4 Das fairplayer.manual auf einem städtischen Präventionstag
- 3. Fazit zum fairplayer.manual als Instrument zur Prävention gegen Mobbing und Gewalt in der Schule
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse des fairplayer.manuals, einem Anti-Mobbing-Programm, und dessen praktischer Einbindung in den schulischen Unterricht. Der Fokus liegt dabei auf der Untersuchung der Implementierung des Programms an einer ausgewählten Realschule in Hessen. Die Arbeit zielt darauf ab, das fairplayer.manual im Kontext von Mobbing und Gewalt in der Schule zu betrachten und seine Wirksamkeit als Präventionsinstrument zu beleuchten.
- Definition und Erscheinungsformen von Mobbing und Gewalt in der Schule
- Die gesellschaftliche Notwendigkeit, Mobbing und Gewalt in der Schule entgegenzuwirken
- Das fairplayer.manual als Präventionsansatz
- Die Implementierung des Programms an der Beispielschule
- Bewertung des fairplayer.manuals als Instrument zur Prävention
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung Dieses Kapitel führt in die Thematik des fairplayer.manuals ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Es stellt die Beispielschule vor, an der das Programm implementiert wurde, und skizziert die Gliederung der folgenden Kapitel.
- Kapitel 2: Das fairplayer.manual gegen Mobbing und Gewalt in der Schule Dieses Kapitel behandelt das fairplayer.manual selbst. Es definiert Mobbing und Gewalt in der Schule, beleuchtet die Notwendigkeit, diesen Phänomenen entgegenzuwirken, und stellt das Programm als Lösung für gesellschaftliche Probleme vor. Des Weiteren werden die Entscheidungsgründe für den Einsatz des fairplayer.manuals an der Beispielschule erläutert. Das Kapitel schließt mit einer detaillierten Beschreibung der Grundgedanken, Materialien und der Implementierung des Programms im schulischen Alltag.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Mobbing, Gewalt, Prävention, Schule, fairplayer.manual, Anti-Mobbing-Programm, soziale Kompetenz, Zivilcourage, Jugend, Schulpraktik, Implementierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "fairplayer.manual"?
Es ist ein wissenschaftlich fundiertes Anti-Mobbing-Programm, das darauf abzielt, Gewalt und Mobbing in Schulen durch gezielte pädagogische Interventionen und Materialien entgegenzuwirken.
Wie wird Mobbing in dieser Arbeit definiert?
Mobbing wird als systematisches, über einen längeren Zeitraum anhaltendes Schikanieren oder Ausgrenzen einzelner Personen durch eine Gruppe im schulischen Kontext definiert.
Wo wurde das Programm in dieser Fallstudie eingesetzt?
Die Untersuchung bezieht sich auf die konkrete Implementierung an einer ausgewählten Realschule in Hessen.
Welche Ziele verfolgt die schulische Friedenserziehung?
Ziel ist die präventive Auflösung von Konflikten, die Förderung von Zivilcourage und die Stärkung der sozialen Kompetenzen der Schüler.
Wie sieht eine typische "fairplayer"-Stunde aus?
Die Arbeit beschreibt exemplarische Stundenstrukturen, in denen mit speziellen Materialien und Übungen gearbeitet wird, um Empathie und Konfliktfähigkeit zu trainieren.
Warum ist Gewaltprävention bereits in der Schule so wichtig?
Empirische Studien belegen die gesellschaftliche Notwendigkeit, da frühzeitiges Entgegenwirken langfristig das soziale Klima verbessert und psychische Folgen für Opfer minimiert.
- Quote paper
- Ma Ho (Author), 2017, Das "fairplayer.manual". Eine wissenschaftliche Untersuchung des Anti-Mobbing-Programms und seiner schulpraktischen Einbindung an einer ausgewählten Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446878