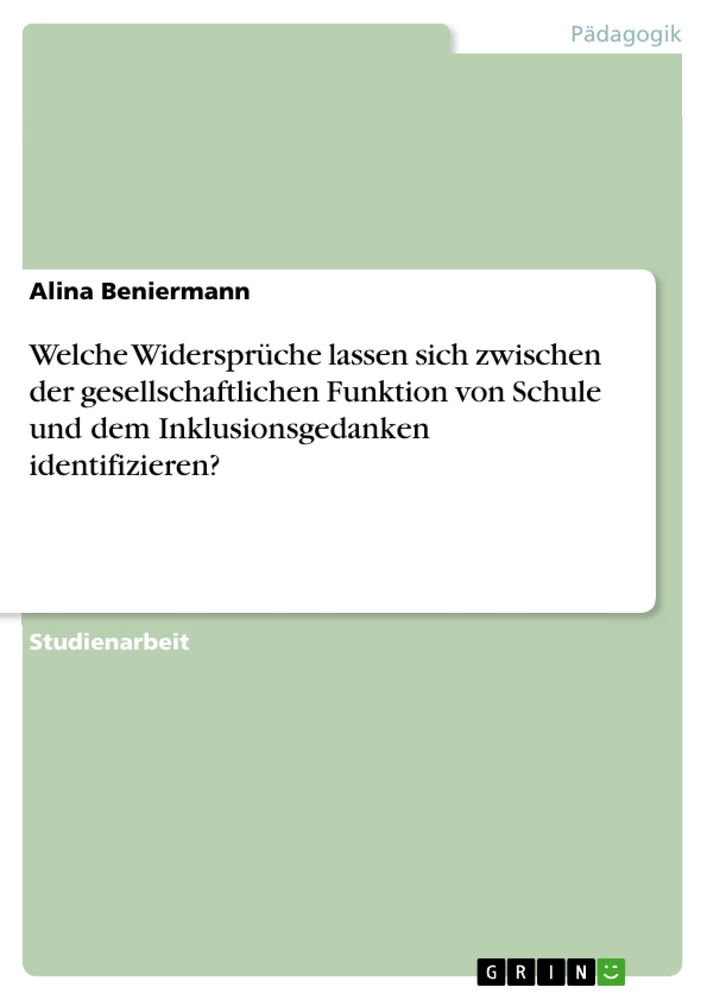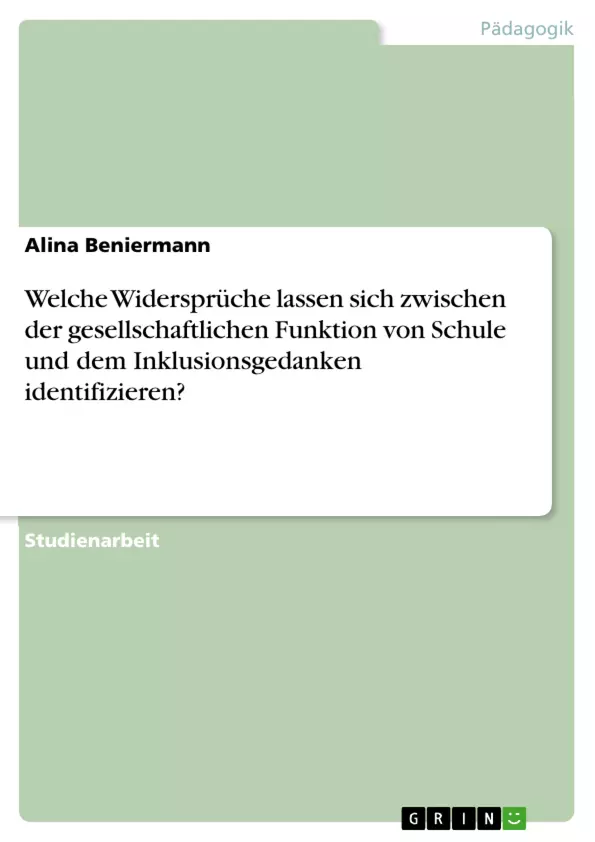In den letzten Jahren ist womöglich kein anderer Begriff in der bildungspolitischen Fachdiskussion so präsent wie "Inklusion"". "Eine Schule für alle!" So wird der strukturelle Wandel in unserem deutschen Schulsystem spätestens seit der Ratifizierung der UN BRK (2009) in Deutschland bejubelt. Seither kursieren zahlreiche Zahlen, die die vermeintlichen "Inklusionszahlen" präsentieren und als bildungspolitische Erfolge verkünden. Tatsächlich muss jedoch festgestellt werden, dass die Umsetzung des Inklusionsgedankens gesamtgesellschaftlich und vor allem, und darauf soll der Fokus im Rahmen dieser Arbeit liegen, im deutschen Schulsystem bislang in erster Linie als fiktive Vorstellung etikettiert werden kann. Dieser Tatsache liegen vielschichtige Probleme, wie etwa Diskrepanzen bzgl. der Finanzierung oder mangelnder Ressourcen in sämtlichen Bereichen,
zugrunde.
Weiterhin lassen sich zahlreiche Widersprüche zwischen der gesellschaftlichen Funktion von Schule und dem Inklusionsgedanken identifizieren. So stellen etwa der Balanceakt zwischen der Akzeptanz von Heterogenität und dem gleichzeitigen Versuch Homogenität herzustellen, die Differenzherstellung und –bearbeitung oder die individuelle Leistungsbewertung während normative Vorstellungen zugrunde gelegt werden, Herausforderungen dar, die neben zahlreichen Unsicherheiten bei der Bevölkerung, die Umsetzung der Inklusion behindern.
Im Rahmen dieser Arbeit sollen jene Widersprüche diskutiert werden. Dabei sollen die Differenzen zwischen dem leistungsorientierten Schulsystem und dem Inklusionsgedanken herausgearbeitet werden und vor allem im Hinblick auf die Rolle der Lehkraft diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Das deutsche Schulsystem
- 2. Inklusion
- 2.1 Entwicklungslinien
- 2.2 Grundgedanken der Inklusion
- 2.3 Umsetzung der Inklusion
- 3. Diskussion
- 4. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Widersprüche zwischen der gesellschaftlichen Funktion von Schule und dem Inklusionsgedanken. Der Fokus liegt auf dem deutschen Schulsystem und dessen Herausforderungen bei der Umsetzung des Inklusionsgedankens.
- Analyse der gesellschaftlichen Funktion des deutschen Schulsystems
- Entwicklung und Grundgedanken der Inklusion
- Identifizierung von Widersprüchen zwischen der gesellschaftlichen Funktion von Schule und dem Inklusionsgedanken
- Diskussion der Herausforderungen und Unsicherheiten bei der Umsetzung von Inklusion im Schulsystem
- Aufzeigen von Chancen und Notwendigkeiten für die LehrerInnenentwicklung im Hinblick auf Inklusion
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel werden die grundlegenden Eigenschaften und Strukturen des deutschen Schulsystems sowie dessen gesellschaftliche Funktion erläutert. Das Kapitel beleuchtet die zentrale Rolle des Leistungsprinzips und den Umgang mit Heterogenität im Schulsystem.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Entwicklung und den Grundgedanken der Inklusion. Es werden die historischen Entwicklungen der Inklusion sowie die wichtigsten Prinzipien und Ziele des Inklusionsgedankens vorgestellt.
Das dritte Kapitel widmet sich der Diskussion der Widersprüche zwischen der gesellschaftlichen Funktion von Schule und dem Inklusionsgedanken. Es werden verschiedene Problemfelder, wie z.B. der Umgang mit Heterogenität und die Leistungsbewertung im Kontext von Inklusion, analysiert.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Inklusion, deutsches Schulsystem, gesellschaftliche Funktion, Heterogenität, Leistungsprinzip, Widersprüche, LehrerInnenentwicklung, Inklusionszahlen, UN BRK, Finanzierung, Ressourcen, Bildung, Qualifikation, Selektion, Allokation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptwiderspruch zwischen Schule und Inklusion?
Der zentrale Widerspruch liegt im leistungsorientierten Schulsystem, das auf Selektion und Homogenisierung setzt, während Inklusion die uneingeschränkte Akzeptanz von Heterogenität und individueller Förderung fordert.
Welche Rolle spielt die UN-BRK für das deutsche Schulsystem?
Seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009 ist Deutschland verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem zu schaffen, was einen tiefgreifenden strukturellen Wandel erfordert.
Warum wird die Umsetzung der Inklusion oft kritisiert?
Kritiker bemängeln, dass Inklusion oft nur als fiktive Vorstellung existiert, da es an Finanzierung, personellen Ressourcen und einer Anpassung der Leistungsbewertung mangelt.
Was sind die gesellschaftlichen Funktionen von Schule?
Zu den Kernfunktionen gehören Qualifikation, Selektion (Auswahl nach Leistung), Allokation (Zuweisung von Positionen in der Gesellschaft) und Integration.
Wie verändert Inklusion die Anforderungen an Lehrkräfte?
Lehrkräfte müssen neue Kompetenzen entwickeln, um den Spagat zwischen normativen Leistungsanforderungen und der individuellen Vielfalt der Schüler bewältigen zu können.
- Quote paper
- Alina Beniermann (Author), 2016, Welche Widersprüche lassen sich zwischen der gesellschaftlichen Funktion von Schule und dem Inklusionsgedanken identifizieren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/448288