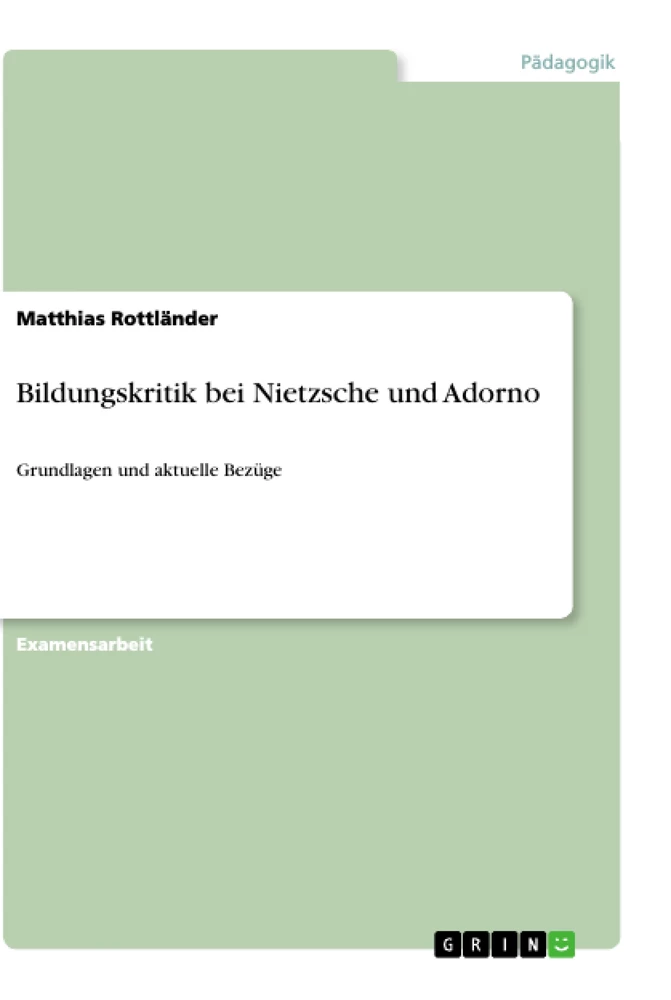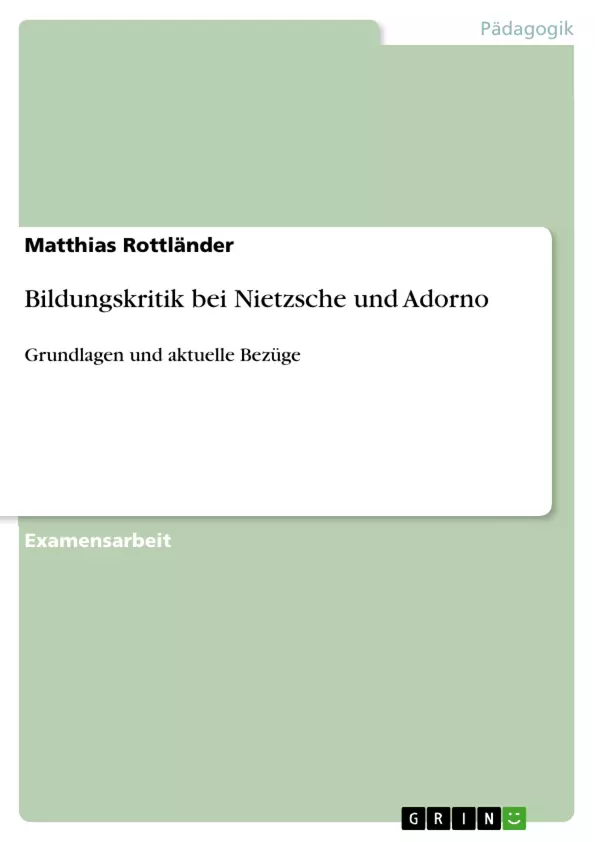Ausgehend von unterschiedlichen Missständen des aktuellen Bildungssystems knüpft der erste Teil dieser Arbeit an der fast schon vergessenen Bildungskritik des jungen Friedrich Wilhelm Nietzsche aus der Mitte des 19. Jahrhunderts an. Vor allem die Schriften „Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten“ und die „Unzeitgemäßen Betrachtungen“ liefern hier aussagekräftige Erkenntnisse. Nietzsche beschreibt mit beeindruckendem rhetorischem Gestus die Missstände des Bildungssystems seiner Zeit. Bildung werde als reines Instrument verstanden. Ihr Ziel sei es, „courante Menschen“ hervorzubringen, d. h. einen wie eine Münze sich stetig im Umlauf befindenden, jederzeit austauschbaren Massenmenschen. Nationalökonomie und Staat haben auch hier ein großes Interesse an der Ökonomisierung der Bildung und an der Produktion von „Humankapital“. Dem Menschen wird so viel Bildung zugebilligt – und so viel wird auch von ihm gefordert – wie für die ökonomischen Staatszwecke nötig. Während Nietzsche die moderne Staatlichkeit verurteilt, sieht er in der antiken Kultur den Weg zur wahren Bildung: „Nicht Grenzwächter, Regulator, Aufseher war für seine Kultur der Staat, sondern der derbe muskulöse zum Kampf gerüstete Kamerad und Weggenosse, der dem bewunderten, edleren und gleichsam überirdischen Freund das Geleit durch rauhe Wirklichkeiten giebt und dafür dessen Dankbarkeit erntet.“
Im zweiten Teil der Arbeit wird das Bildungsverständnis Adornos und der Kritischen Theorie in den Blick genommen und dem Nietzsches gegenüber gestellt. Immanuel Kant definierte in seiner Schrift „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ den Prozess der Aufklärung als Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Nach Adorno ist dieser Prozess selbst verantwortlich für die halbgebildete Gesellschaft. Das Bürgertum, dessen Emanzipation vom Adel sich spätestens seit der französischen Revolution vollzog, hat im Laufe der folgenden Zeit eine eigene abgeschottete gesellschaftliche Schicht gebildet. War die Aufklärung u.a. mit dem Postulat einer Bildung für alle angetreten, so muss Adorno ihren Fehlschlag konstatieren.
Eine der wichtigsten Voraussetzungen zur individuellen Bildung, Muße, wurde vor allem dem Proletariat nicht zugestanden bzw. nur für den eigenen Stand eingefordert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Bildung oder was ist der Mensch?
- 2. Was ist Kritik?
- 2.1. Kritik und Aufklärung
- 2.2. Gouvernementalität und Neoliberalismus
- 3. Bildungskritik Teil 1: Friedrich Nietzsche
- 3.1. Die Basler Vorträge „Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten“
- 3.2. Nietzsches Idee der Selbstbildung: „Werde, der du bist“
- 3.2.1. 1. Etappe: Selbstbildung am Beispiel Sprache
- 3.2.2. 2. Etappe: der Prozess der „großen Loslösung“
- 3.2.3. 3. Etappe: die Selbsttransformation
- 4. Bildungskritik Teil 2: Theodor W. Adorno
- 4.1. Halbbildung und Kulturindustrie als Antiaufklärung
- 4.2. Der Doppelcharakter der Kultur
- 4.3. Das Dilemma der Kritik und die Funktion der Kunst
- 5. Resümee: Bildung und Widerstand
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit setzt sich zum Ziel, die Bildungskritik von Friedrich Nietzsche und Theodor W. Adorno im Kontext der aktuellen Bildungsdiskussion zu untersuchen. Sie beleuchtet die grundlegenden Überlegungen der beiden Denker und ihre Relevanz für das heutige Bildungsverständnis.
- Die Bedeutung von Kritik für die Bildung
- Die Rolle der Selbstbildung im Denken Nietzsches
- Adornos Kritik an Halbbildung und Kulturindustrie
- Der Einfluss von Neoliberalismus auf die Bildung
- Die Frage nach der Funktion der Kunst im Bildungsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des gegenwärtigen Bildungsverständnisses vor, das durch den Einfluss neoliberaler Denkmuster geprägt ist. Kapitel 2 untersucht den Begriff der Kritik und dessen Bedeutung im Kontext der Aufklärung und Gouvernementalität. In Kapitel 3 wird die Bildungskritik von Friedrich Nietzsche anhand seiner Basler Vorträge und seiner Idee der Selbstbildung beleuchtet. Kapitel 4 widmet sich Adornos Kritik an Halbbildung und Kulturindustrie sowie dem Dilemma der Kritik und der Funktion der Kunst.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Bildungskritik, Selbstbildung, Kritik, Aufklärung, Neoliberalismus, Halbbildung, Kulturindustrie, Kunst und Widerstand. Die Arbeit fokussiert auf die Analyse der Bildungsphilosophien von Friedrich Nietzsche und Theodor W. Adorno und deren Bedeutung für das aktuelle Bildungsverständnis.
Häufig gestellte Fragen
Was kritisierte Nietzsche am Bildungssystem seiner Zeit?
Er sah Bildung als reines Instrument zur Produktion von „couranten Menschen“ und Humankapital für Staats- und Wirtschaftszwecke.
Was versteht Adorno unter „Halbbildung“?
Halbbildung ist ein Zustand, in dem Bildungsinhalte nur oberflächlich konsumiert werden, was durch die Kulturindustrie gefördert wird und Aufklärung verhindert.
Welche Rolle spielt die „Muße“ für die Bildung?
Muße gilt als notwendige Voraussetzung für individuelle Bildung, wurde aber historisch vor allem dem Proletariat vorenthalten.
Was bedeutet Nietzsches Ideal „Werde, der du bist“?
Es beschreibt den Prozess der Selbstbildung und Selbsttransformation jenseits staatlicher Dressur und Massenkonformität.
Inwiefern ist die Kulturindustrie nach Adorno „Antiaufklärung“?
Sie bietet standardisierte Ersatzbefriedigung, die kritisches Denken einschläfert und den Menschen in Unmündigkeit hält.
- Quote paper
- Matthias Rottländer (Author), 2012, Bildungskritik bei Nietzsche und Adorno, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/448545