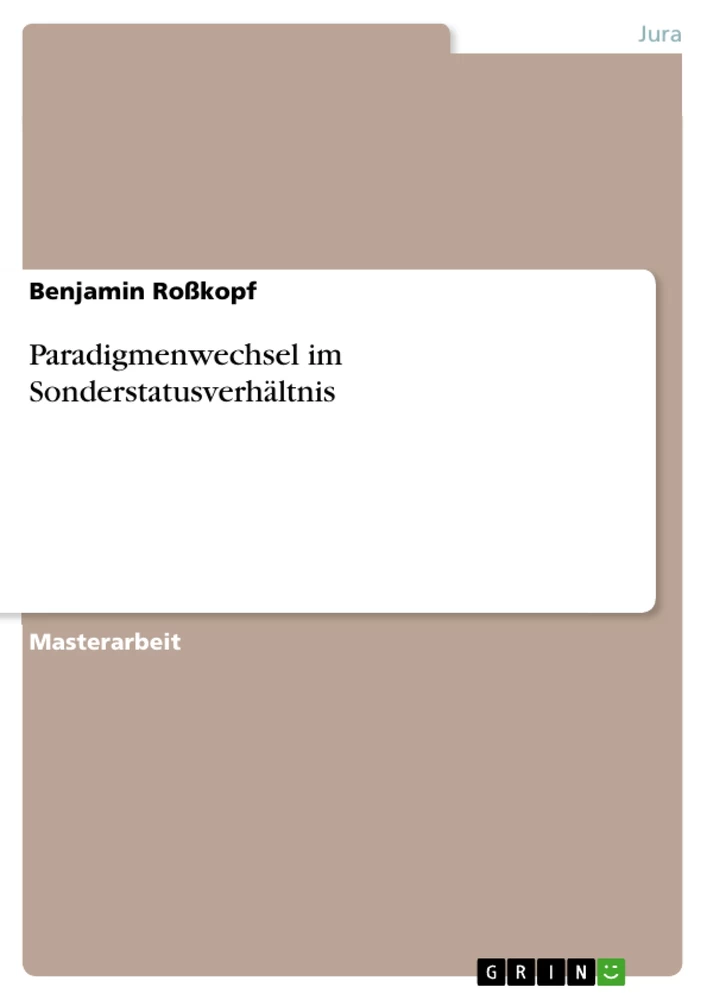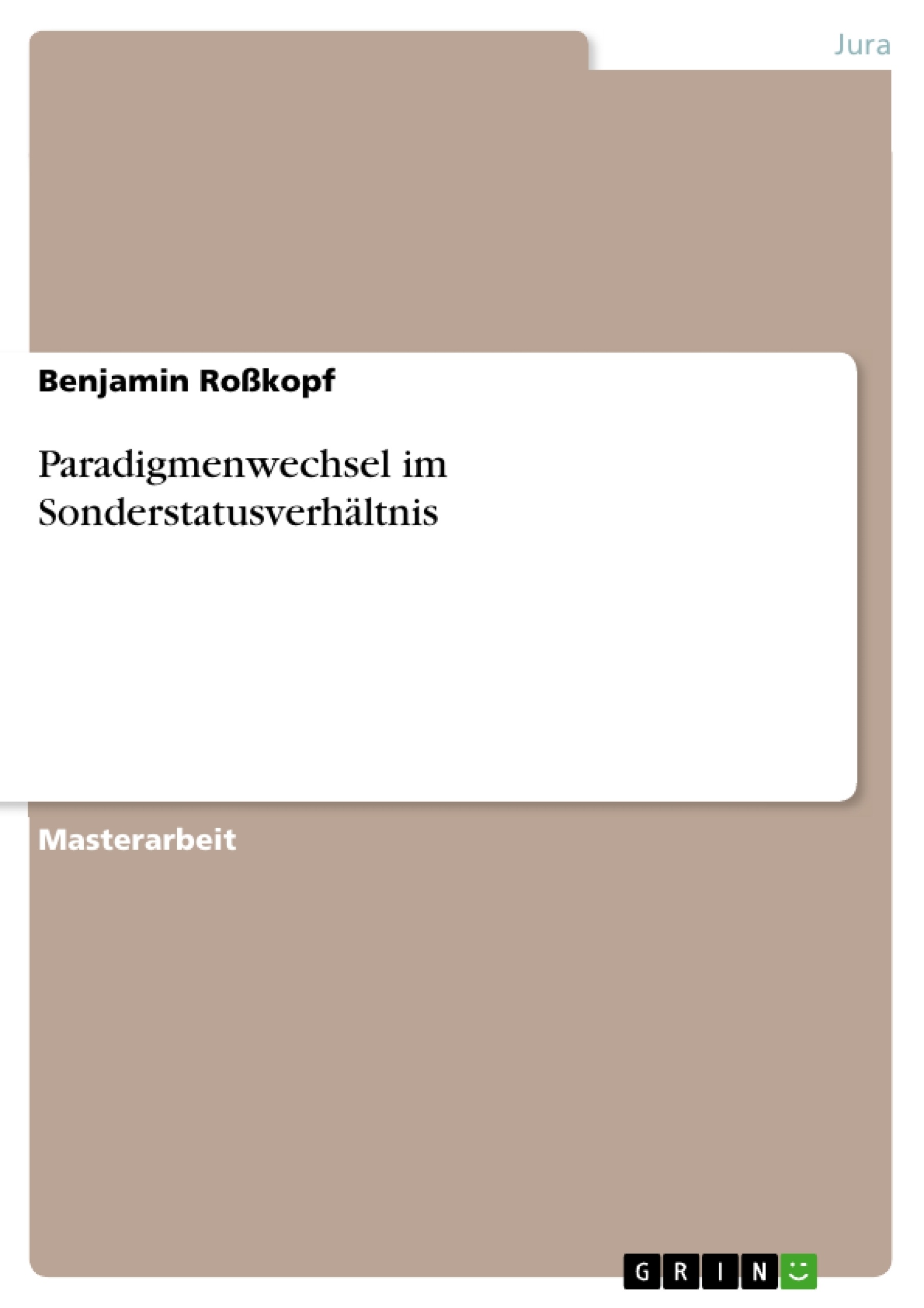Das Stichwort des „Sonderstatusverhältnisses“ stellt eine schillernde Rechtsfigur dar, die zu den Grundlagen der staats- und verfassungsrechtlichen Ausbildung gehört, über deren konkrete Bedeutung indes ein hohes Maß an Unklarheit herrscht. Da die Fallkonstellationen des Sonderstatusverhältnisses aufgrund der Vielzahl der sich in solchen Verhältnissen bewegenden Personen keine Seltenheit sind und es aufgrund der bestehenden Unklarheiten in diesem Bereich immer wieder zu Problemen kommt, wenn versucht wird, die dort entstehenden Divergenzen aufzulösen, ist diese Thematik in dieser Arbeit aufgerollt worden.
Es werden das Sonderstatusverhältnis und der sich dort vollzogene Paradigmenwechsel dargestellt und kritisch beleuchtet. Zu diesem Zweck wurde zunächst in einem ersten Teil auf die Herkunft und die weitere geschichtliche Entwicklung dieses Rechtsinstituts eingegangen. In diesem Zusammenhang wurden vor allem die Hintergründe für die Schaffung dieser Rechtsfigur aufgezeigt. In einem zweiten Teil wurden die heutige Begrifflichkeit des „Sonderstatusverhältnisses“ erörtert und die Konturen dieser Figur aufgezeigt. Anschließend wurde in einem dritten Teil der aktuelle Diskussionsstand zu dieser Thematik dargelegt. Dabei wurde insbesondere herausgearbeitet, welche Rolle dieses Institut derzeit in der aktuellen Rechtspraxis spielt und welchen stand das Sonderstatusverhältnis hat. Nachdem im letzten Teil ein Fazit zu der dargestellten Thematik gezogen worden ist, wurden mögliche Entwicklungen hierzu aufgezeigt. Neben der Aufrechterhaltung des Bewusstseins, welch elementare Rolle dieses Rechtsinstitut in der deutschen Jurisprudenz doch spielt, war Ziel dieser Arbeit, einen Beitrag zur Lösung etwaiger zukünftiger Grundrechtskollisionen im Rahmen von sich in Sonderstatusverhältnissen befindlichen Parteien zu leisten.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Hinführung zum Thema - Begriffsbestimmung
- 1. Das allgemeine Gewaltverhältnis
- 2. Das besondere Gewaltverhältnis
- II. Aktualität dieser Thematik
- III. Hintergrund und Ziel dieser Arbeit
- B. Erster Teil - Historie
- I. Kapitel 1: Geschichtliche Entstehung der Rechtsfigur
- 1. Die Entstehung des „allgemeinen Gewaltverhältnisses“
- 2. Die Figur des „besonderen Gewaltverhältnisses“
- a) Der Begriff des „Gewaltverhältnisses“
- b) Beamtenrechtliche Wurzeln
- c) Disziplinarrechtliche Wurzeln
- aa) Die Forschungen von Albert Haenel
- bb) Die Untersuchungen von Georg Jellinek
- d) Der Entwurf Otto Mayers
- aa) Bildung einer eigenständigen Rechtsfigur
- bb) Die Kontur der Rechtsfigur nach Otto Mayer
- (1) Drei maßgebliche Gewaltformen
- (2) Konkrete Ausprägungen der Rechtsfigur
- II. Kapitel 2: Die Entwicklung der Figur in der Folgezeit
- 1. Die Rechtsfigur im deutschen Kaiserreich
- 2. Die Rechtsfigur im republikanischen Deutschland
- a) Die Weimarer Staatsrechtslehre
- aa) Schleichender Erosionsprozess
- bb) Ablösung von seinem dogmatischen Fundament
- b) Die Staatsrechtslehre der Bundesrepublik Deutschland
- aa) Kontinuität des besonderen Gewaltverhältnisses
- bb) Rückzug des Rechtsinstituts
- C. Zweiter Teil - Bestandsaufnahme
- I. Kapitel 3: Abkehr vom besonderen Gewaltverhältnis
- 1. Die Strafgefangenentscheidung vom 14.03.1972
- a) Hintergrund der Entscheidung
- b) Ergebnis der Verfassungsbeschwerde
- 2. Auswirkungen des Strafgefangenurteils
- II. Kapitel 4: Entwicklung einer neuen Rechtsfigur
- 1. Die Rehabilitation der Rechtsfigur
- 2. Die Figur des „Sonderstatusverhältnisses“
- a) Begriffsbezeichnung
- b) Konturen des „Sonderstatusverhältnisses“
- aa) Personengruppen innerhalb institutioneller Kontexte
- bb) Weitreichende Einschränkbarkeit der Grundrechte
- cc) Die Geltung der Grundrechte
- (1) Der Erlass des Grundgesetzes
- (2) Spezifische Regelungen für Näheverhältnisse
- (a) Die Vorbehaltsklausel des Art. 17 a GG
- (b) Die Regelung des Art. 33 IV und V GG
- (c) Die Bedeutung von Art. 137 I GG
- III. Kapitel 5: Derzeitiger Meinungsstand
- 1. Festhalten am Grundgedanken
- 2. Kernprobleme des Sonderstatusverhältnisses
- a) Angriffspunkte des besonderen Gewaltverhältnisses
- aa) Parallelen zum allgemeinen Gewaltverhältnis
- bb) Die Anzeichen der Eigengesetzlichkeit
- cc) Der Rechtsschutz der Rechtsfigur
- b) Die wesentlichen Fragenkreise der Diskussion
- 3. Grundrechtsschutz in der Eingliederungslage
- a) Erweiterte Rechtfertigungsmöglichkeiten
- b) Gesetzesvorbehalt und Wesentlichkeitstheorie
- c) Rechtsschutz in den Eingliederungsverhältnissen
- d) Mögliche Handlungsformen
- aa) Verwaltungsakt vs. Verwaltungsinternum
- bb) Satzung bzw. Verordnung vs. Verwaltungsvorschrift
- D. Dritter Teil - Fazit
- I. Kapitel 6: Resümee
- 1. Wandel des Verständnisses der Rechtsfigur
- 2. Kritik an der herrschenden Schrankenlösung
- II. Kapitel 7: Ausblick
- 1. Notwendigkeit einer klaren Problemlösung
- 2. Mögliche Lösungsansätze
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Wandel des Sonderstatusverhältnisses in Deutschland und analysiert dessen historische Entwicklung und aktuelle Rechtslage. Sie untersucht die Abkehr vom traditionellen „besonderen Gewaltverhältnis“ hin zu einer neuen Rechtsfigur, dem „Sonderstatusverhältnis“. Dabei werden die zentralen Argumentationslinien und Debatten im Zusammenhang mit diesem Paradigmenwechsel beleuchtet.
- Historische Entwicklung des „besonderen Gewaltverhältnisses“ und seine Ablösung durch das „Sonderstatusverhältnis“
- Kritik an der „Schrankenlösung“ und deren Auswirkungen auf den Grundrechtsschutz
- Bedeutung des „Sonderstatusverhältnisses“ für die Einschränkung von Grundrechten in institutionellen Kontexten
- Die wesentlichen Fragenkreise der aktuellen Diskussion, wie z.B. die Rechtfertigungsmöglichkeiten für Grundrechtseinschränkungen und die unterschiedlichen Formen des Rechtsschutzes in Eingliederungsverhältnissen
- Mögliche Lösungsansätze für die Probleme des Sonderstatusverhältnisses
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Sonderstatusverhältnisses ein und definiert die relevanten Begrifflichkeiten. Anschließend wird die Aktualität des Themas und der Hintergrund der Arbeit dargelegt.
Im ersten Teil, „Historie“, wird die historische Entwicklung des „besonderen Gewaltverhältnisses“ von seinen Anfängen bis zur Gegenwart beleuchtet. Kapitel 1 behandelt die Entstehung der Rechtsfigur und ihre Ausprägung in der Rechtswissenschaft. Kapitel 2 analysiert die Entwicklung der Rechtsfigur im deutschen Kaiserreich und im republikanischen Deutschland, einschließlich der Staatsrechtslehre der Weimarer Republik und der Bundesrepublik Deutschland.
Der zweite Teil, „Bestandsaufnahme“, widmet sich der aktuellen Rechtslage. Kapitel 3 untersucht die Abkehr vom „besonderen Gewaltverhältnis“ und die Auswirkungen der Strafgefangenentscheidung vom 14.03.1972. Kapitel 4 analysiert die Entwicklung des „Sonderstatusverhältnisses“ als neue Rechtsfigur und die Konturen dieser Figur. Kapitel 5 gibt einen Überblick über den derzeitigen Meinungsstand in der Rechtswissenschaft und die zentralen Streitpunkte in Bezug auf das Sonderstatusverhältnis.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Grundrechtseinschränkung, des Sonderstatusverhältnisses, des „besonderen Gewaltverhältnisses“, der Eingliederungslage, der Rechtfertigungsmöglichkeiten für Grundrechtseinschränkungen, der Gesetzesvorbehaltslehre und der Wesentlichkeitstheorie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein "Sonderstatusverhältnis"?
Es bezeichnet ein Rechtsverhältnis, in dem Personen (z.B. Beamte, Soldaten, Strafgefangene) in einer engen Beziehung zum Staat stehen, was besondere Grundrechtseinschränkungen zur Folge haben kann.
Was war das "besondere Gewaltverhältnis"?
Dies ist die historische Vorläuferfigur, die davon ausging, dass in bestimmten staatlichen Bereichen Grundrechte ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage eingeschränkt werden durften.
Welche Bedeutung hat das Strafgefangenurteil von 1972?
Dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts markierte die Abkehr vom "besonderen Gewaltverhältnis" und stellte klar, dass auch in Sonderstatusverhältnissen Grundrechtseingriffe einer gesetzlichen Grundlage bedürfen.
Was besagt die Wesentlichkeitstheorie in diesem Kontext?
Sie besagt, dass der Gesetzgeber alle wesentlichen Entscheidungen, insbesondere solche, die Grundrechte betreffen, selbst treffen muss und nicht der Verwaltung überlassen darf.
Sind Grundrechte in Sonderstatusverhältnissen voll wirksam?
Ja, Grundrechte gelten grundsätzlich auch hier, können jedoch aufgrund der institutionellen Besonderheiten unter Beachtung des Gesetzesvorbehalts eingeschränkt werden.
- Quote paper
- Benjamin Roßkopf (Author), 2018, Paradigmenwechsel im Sonderstatusverhältnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/449785