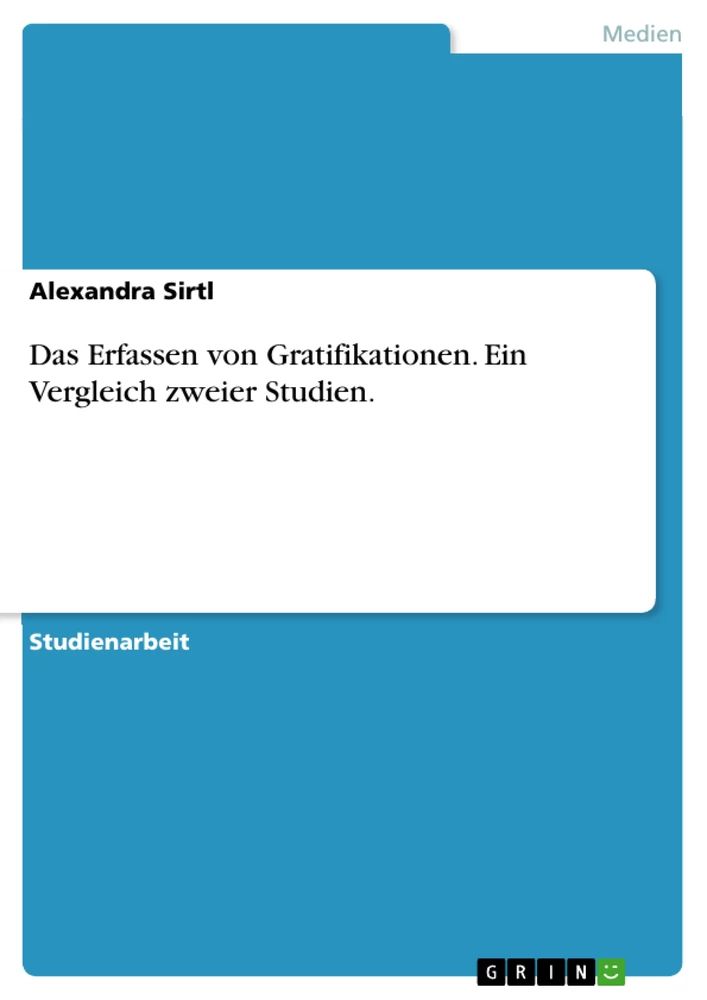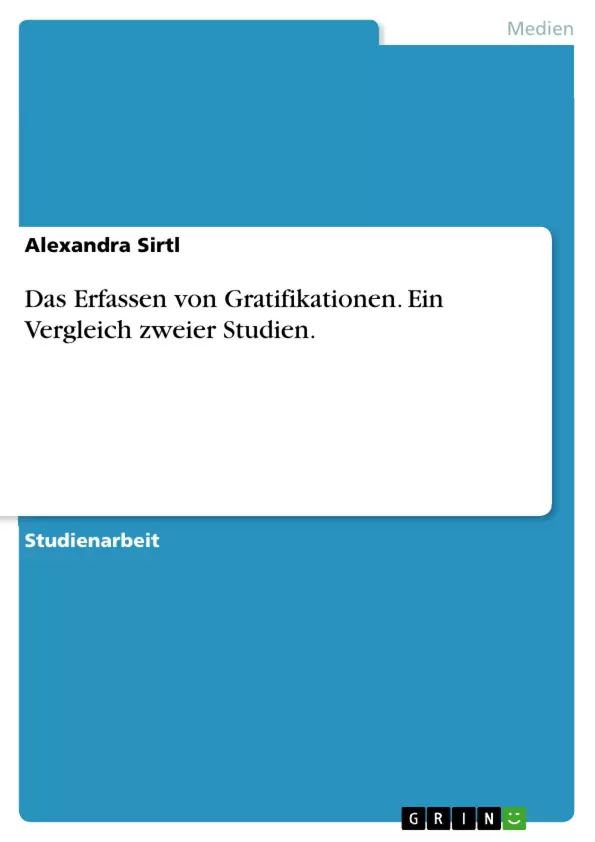Einleitung
Studien zum Thema „Uses and Gratifications“ gibt es viele, und noch mehr kommerzielle Untersuchungen beinhalten zumindest einige Fragen zu den Motiven der Rezipienten. Vor allem neuere Studien übernehmen jedoch meistens nur Typologien und Items aus früheren Arbeiten, ohne deren Gültigkeit in Frage zu stellen oder zu überprüfen. Deshalb erscheint ein Vergleich zweier Studien, deren Typologien häufig übernommen werden, sinnvoll. Die Typologien von McQuail, Blumler und Brown(1) zur Fernsehnutzung von Erwachsenen und von Greenberg(2) zur Fernsehnutzung von Kindern und Jugendlichen werden in vielen Überblicksdarstellungen
als Beispiel genannt(3). Auch die Gratifikationsdimensionen und die
Items dieser Studien werden immer wieder übernommen(4), so dass diese beiden Arbeiten gut für einen Vergleich geeignet sind.
[...]
______
1 Denis McQuail/J.G. Blumler/J.R. Brown: The Television Audience. A Revised Perspective, in: McQuail, Denis (Hrsg.): Sociology of Mass Communications, Middlesex 1972, S.135-165
2 Bradley S. Greenberg: Gratifications of Television Viewing and their Correlates for British Children, in: Blumler, J.G./Elihu Katz (Hrsg.): The Uses of Mass Communications. Current Perspectives on Gratifications Research, Beverly Hills 1974, S.71-92
3 Vgl. z.B. Michael Schenk: Medienwirkungsforschung, Tübingen 1987, S.392 ff.; Roland Burkart: Kommunikationswissenschaft.
Grundlagen und Problemfelder. Umrisse einer interdisziplinären Sozialwissenschaft, Wien u.a. 21995, S.219 ff.; Bernd Büchner: Der Kampf um die Zuschauer. Neue Modelle zur Fernsehprogrammwahl,
München 1989, S.23 f.
4 Vgl. z.B. Alan M. Rubin: Television uses and gratifications. The interaction of viewing patterns and motivations, in: Journal of Broadcasting, Jg. 27 (1983), S.37-51, hier S.40, Fußnote 16
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Uses and Gratifications-Approach
- Das Erfassen von Gratifikationen
- Methoden und Ansätze
- Probleme
- Typologien
- McQuail, Denis/J.G. Blumler/J.R. Brown: The Television Audience. A Revised Perspective (1972)
- Ziele und Annahmen
- Methoden
- Ergebnisse
- Greenberg, Bradley S.: Gratifications of Television Viewing and their Correlates for British Children (1974)
- Ziele
- Methoden
- Ergebnisse
- McQuail, Denis/J.G. Blumler/J.R. Brown: The Television Audience. A Revised Perspective (1972)
- Vergleich und Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit hat zum Ziel, zwei einflussreiche Studien zum Uses and Gratifications-Ansatz zu vergleichen und deren Typologien und methodische Ansätze zu analysieren. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Übereinstimmung und der Unterschiede in den Ansätzen von McQuail, Blumler und Brown sowie Greenberg. Die Arbeit beleuchtet die Stärken und Schwächen der jeweiligen Methoden und trägt somit zu einem besseren Verständnis der Gratifikationsforschung bei.
- Vergleich der Typologien von McQuail/Blumler/Brown und Greenberg
- Analyse der Methoden zur Erfassung von Gratifikationen
- Bewertung der Stärken und Schwächen des Uses and Gratifications-Ansatzes
- Untersuchung der Probleme bei der Erhebung von Gratifikationsdaten
- Diskussion der verschiedenen Forschungsansätze innerhalb des Uses and Gratifications-Paradigmas
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Uses and Gratifications-Ansatzes ein und begründet die Wahl der beiden ausgewählten Studien von McQuail, Blumler und Brown sowie Greenberg für einen detaillierten Vergleich. Die Autorin argumentiert, dass viele neuere Studien bestehende Typologien übernehmen, ohne deren Gültigkeit zu überprüfen, und sieht daher einen direkten Vergleich als notwendig an, um die Aussagekraft dieser etablierten Arbeiten zu evaluieren und kritisch zu hinterfragen. Der Fokus wird auf die weit verbreitete Verwendung der Typologien und Items dieser Studien gelegt, was die Relevanz des Vergleichs unterstreicht.
2. Der Uses and Gratifications-Approach: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über den Uses and Gratifications-Ansatz, beginnend mit frühen Studien der 1940er Jahre, die sich mit den Gratifikationen von Radiohörern und Zeitungslesern auseinandersetzten. Es wird deutlich, dass diese frühen Arbeiten vor allem beschreibend waren und noch keine umfassenden theoretischen Erklärungen für die Entstehung und Erfüllung von Gratifikationen lieferten. Das Kapitel beschreibt die Entwicklung hin zu komplexeren theoretischen Modellen in den 1970er Jahren, die die Zusammenhänge zwischen Bedürfnissen, Motiven, Erwartungen, Mediennutzung und deren Folgen untersuchen. Die fünf grundlegenden Annahmen des Ansatzes, insbesondere die aktive Rolle des Publikums und die Bedeutung des Rezipienten im Kommunikationsprozess, werden hervorgehoben. Des Weiteren wird die Berücksichtigung funktionaler Alternativen zum Medienkonsum thematisiert und die methodischen Herausforderungen bei der Erfassung von Gratifikationen, wie die Notwendigkeit, die Kategorien in den Worten der Rezipienten zu formulieren, erläutert.
3. Das Erfassen von Gratifikationen: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit verschiedenen Methoden und Ansätzen zur Erfassung von Gratifikationen. Es werden drei von Katz, Blumler und Gurevitch vorgeschlagene Ansätze vorgestellt und deren Vor- und Nachteile diskutiert. Diese Ansätze unterscheiden sich darin, ob sie von den Bedürfnissen der Rezipienten, von deren Problemen oder von konkreten Medieninhalten ausgehen. Das Kapitel analysiert kritisch die jeweiligen Stärken und Schwächen, wobei insbesondere die Frage der subjektiven Bewertung von Bedürfnissen und der möglichen Vernachlässigung bestimmter Gratifikationsarten thematisiert wird. Zusätzlich werden Beckers drei Methoden zur Messung von Gratifikationen vorgestellt, inklusive der Herausforderungen und Limitationen jedes Ansatzes. Die Notwendigkeit, die möglichen Gratifikationen zu kennen, ihre Medien- bzw. Inhaltsspezifität zu berücksichtigen und das Verhältnis zwischen positiven und negativen Gründen für Medienkonsum zu verstehen wird betont.
Schlüsselwörter
Uses and Gratifications, Gratifikationsforschung, Mediennutzung, Rezipientenmotive, Typologien, Methodenvergleich, McQuail, Blumler, Brown, Greenberg, Bedürfnisbefriedigung, Medienwirkung, Forschungsansätze, Kritik des Uses and Gratifications-Ansatzes.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleich zweier einflussreicher Studien zum Uses and Gratifications-Ansatz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht zwei einflussreiche Studien zum Uses and Gratifications-Ansatz von McQuail, Blumler und Brown (1972) und Greenberg (1974). Der Fokus liegt auf der Analyse der Typologien, der methodischen Ansätze und der Übereinstimmung bzw. Unterschiede beider Studien. Ziel ist es, die Stärken und Schwächen der jeweiligen Methoden zu beleuchten und ein besseres Verständnis der Gratifikationsforschung zu ermöglichen.
Welche Studien werden verglichen?
Im Zentrum des Vergleichs stehen die Studien "The Television Audience. A Revised Perspective" (McQuail, Blumler & Brown, 1972) und "Gratifications of Television Viewing and their Correlates for British Children" (Greenberg, 1974). Beide Studien gelten als einflussreich im Bereich der Uses and Gratifications Forschung.
Welche Aspekte der Studien werden analysiert?
Die Analyse umfasst den Vergleich der Typologien, die Untersuchung der Methoden zur Erfassung von Gratifikationen, die Bewertung der Stärken und Schwächen der jeweiligen Ansätze sowie eine Diskussion der Probleme bei der Erhebung von Gratifikationsdaten. Die Arbeit beleuchtet auch die verschiedenen Forschungsansätze innerhalb des Uses and Gratifications-Paradigmas.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Vergleich der Typologien von McQuail/Blumler/Brown und Greenberg; Analyse der Methoden zur Erfassung von Gratifikationen; Bewertung der Stärken und Schwächen des Uses and Gratifications-Ansatzes; Untersuchung der Probleme bei der Erhebung von Gratifikationsdaten; und Diskussion der verschiedenen Forschungsansätze innerhalb des Uses and Gratifications-Paradigmas.
Wie wird der Uses and Gratifications-Ansatz in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit bietet einen historischen Überblick über den Uses and Gratifications-Ansatz, einschließlich der Entwicklung von frühen, beschreibenden Studien zu komplexeren theoretischen Modellen. Die fünf grundlegenden Annahmen des Ansatzes werden hervorgehoben, insbesondere die aktive Rolle des Publikums und die Bedeutung des Rezipienten im Kommunikationsprozess. Methodische Herausforderungen bei der Erfassung von Gratifikationen werden ebenfalls diskutiert.
Welche Methoden zur Erfassung von Gratifikationen werden diskutiert?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Methoden und Ansätze zur Erfassung von Gratifikationen, darunter die von Katz, Blumler und Gurevitch vorgeschlagenen Ansätze und Beckers drei Methoden. Die Vor- und Nachteile, Stärken und Schwächen der jeweiligen Ansätze werden analysiert und kritisch diskutiert, einschließlich der Herausforderungen und Limitationen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen aus dem Vergleich der beiden Studien, beleuchtet die Stärken und Schwächen der verwendeten Methoden und trägt somit zu einem besseren Verständnis der Gratifikationsforschung und des Uses and Gratifications-Ansatzes bei. Die Schlussfolgerungen basieren auf einer detaillierten Analyse der Typologien und methodischen Ansätze beider Studien.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Uses and Gratifications, Gratifikationsforschung, Mediennutzung, Rezipientenmotive, Typologien, Methodenvergleich, McQuail, Blumler, Brown, Greenberg, Bedürfnisbefriedigung, Medienwirkung, Forschungsansätze, Kritik des Uses and Gratifications-Ansatzes.
- Citar trabajo
- Alexandra Sirtl (Autor), 2000, Das Erfassen von Gratifikationen. Ein Vergleich zweier Studien., Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/450