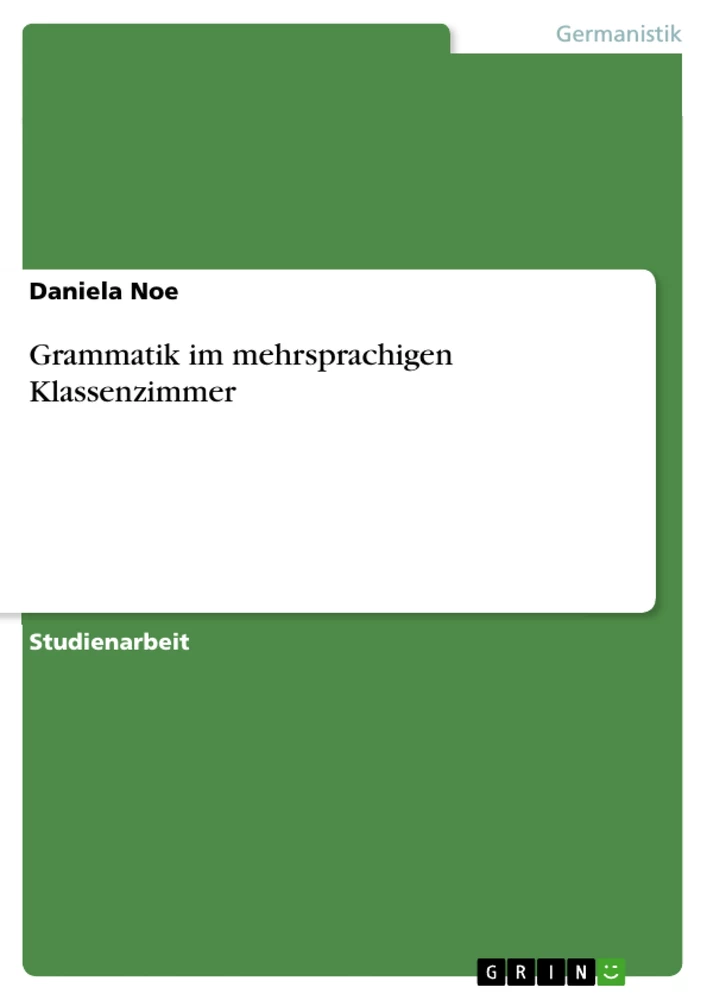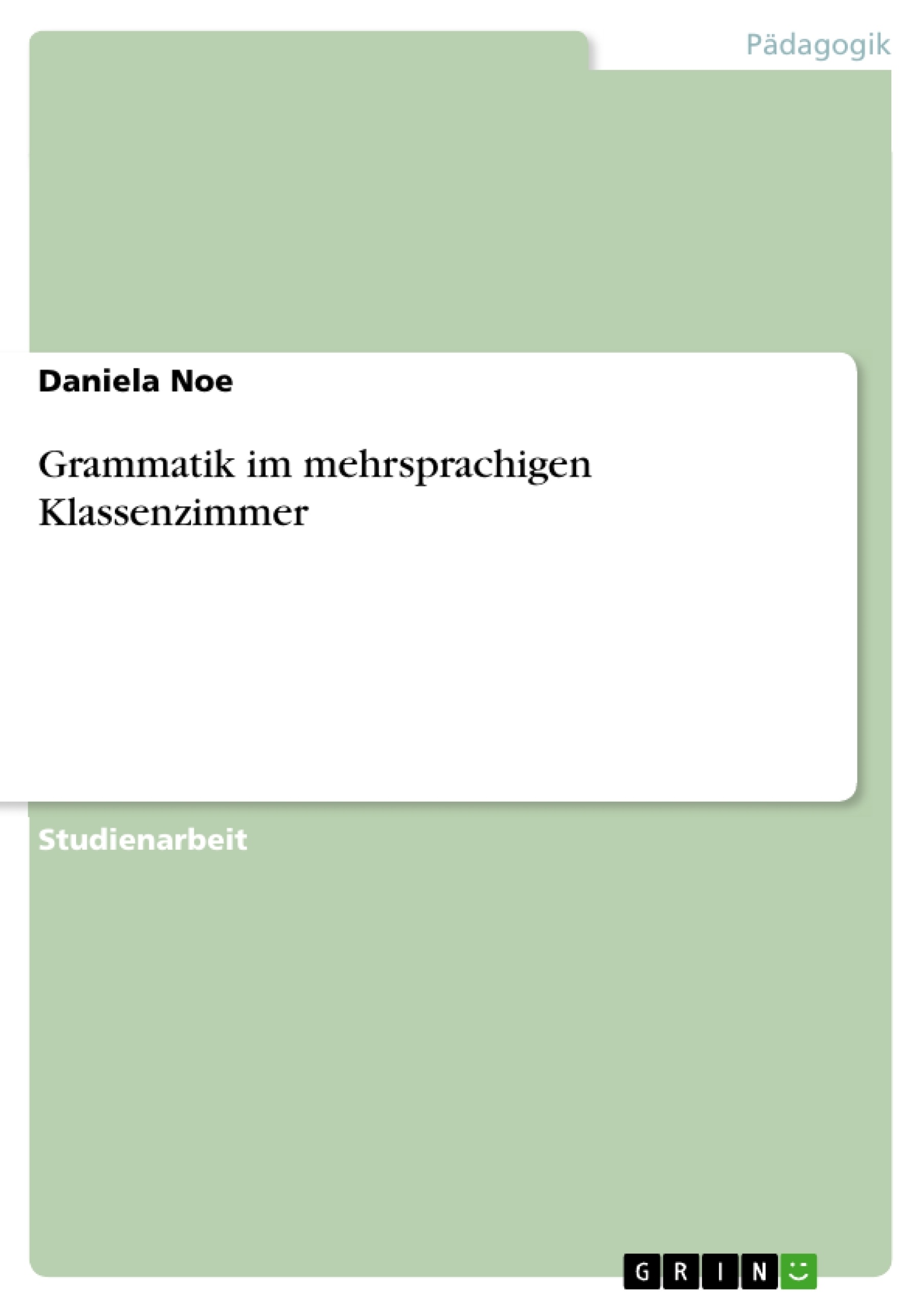Die Sprache der Menschen ist nicht angeboren. Ein Baby kommt nicht sprechend zur Welt. Es macht viele Prozesse durch, bis es schlussendlich sein erstes Wort spricht. Nach ca. 12-18 Monaten kann es Sätze mit einem Wort sprechen. Allerdings kann es dies auch nur, weil es seine Umgebung belauscht und die Worte vertraut sind. Dieses Phänomen lässt sich bei den stummen „Wilden“ nachweisen.
Es gibt verschiedene Kinder, die in unterschiedlichem Alter in der Wildnis entdeckt wurden. Viele dieser Kinder konnten weder sprechen noch hatten sie Erinnerungen. Sie waren motorisch eingeschränkt und auch unempfindlicher gegenüber Temperatureinflüssen. Da diese Kinder in einer sprachfreien Umgebung aufwuchsen, wurden sie nicht an die Sprache gewöhnt und können sie somit nicht nachahmen. Bei ihnen ist die sensible Phase des Spracherwerbs bereits vorüber. Nach dem nativistischen Ansatz haben sie zwar die angeborenen, grundlegenden Fähigkeiten der Universalgrammatik, allerdings unterliegen diese einem Reifeprozess, der von außen gefördert werden muss. Die grammatischen Regeln müssen erlernt werden, da die Kinder dies im Umweltangebot in der wilden Natur nicht finden konnten. Nach der psychologischen Theorie gibt es eine solche Universalgrammatik allerdings nicht und auch keine angeborenen sprachspezifischen Fähigkeiten. Das Emergenzmodell beschränkt sich auf den kommunikativen Kontext und der Theorie der „radikalen Mitte“. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Aufgabe 1
- a. Die Sprache der Menschen ist nicht angeboren.
- b. Grammatik ist das, was unsere Sprache ausmacht.
- c. In der Schule - auch in meiner schulischen Laufbahn - begegnete einem die Grammatik nur in Form von Arbeitsblättern oder Schulbüchern.
- Aufgabe 2
- a. Die Schülerin oder der Schüler befindet sich in der 12. Klasse und hat diese über den Seiteneinstieg erreicht.
- b. Nun muss er in den sich wiederholenden Fehlern geschult werden, um hier noch sicherer zu werden und nicht wegen grammatikalischer oder morpho-syntaktischer Fehler Gefahr zu laufen, dass er schlechter bewertet wird.
- Aufgabe 3
- a. Das Phänomen, welches im Unterrichtsmaterial thematisiert wird, nennt man Verbzweitstellung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der deutschen Grammatik und ihren verschiedenen Aspekten. Er untersucht die Entwicklung der Sprache bei Kindern und wie diese durch die Umgebung beeinflusst wird. Zudem wird die Bedeutung der Grammatik im schulischen und beruflichen Kontext diskutiert. Der Text analysiert die Sprachprobe eines Schülers und bietet Förderziele für die Verbesserung seiner Grammatikkenntnisse.
- Sprachentwicklung und der Einfluss der Umwelt
- Bedeutung der Grammatik im schulischen und beruflichen Kontext
- Analyse der Sprachprobe eines Schülers
- Förderziele zur Verbesserung von Grammatikkenntnissen
- Verbzweitstellung und das topologische Feldermodell
Zusammenfassung der Kapitel
Aufgabe 1
In diesem Kapitel wird die Frage nach der angeborenen Sprache untersucht. Es wird argumentiert, dass Kinder die Sprache durch Imitation ihrer Umgebung erlernen und dass die sensible Phase des Spracherwerbs begrenzt ist. Die verschiedenen Ansätze zur Erklärung der Sprachentwicklung, wie der nativistische Ansatz und das Emergenzmodell, werden vorgestellt. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Grammatik für die Struktur und den Sinn der Sprache.
Aufgabe 2
Das Kapitel analysiert die Sprachprobe eines Schülers in der 12. Klasse und identifiziert wiederkehrende Fehler. Die Analyse konzentriert sich auf morpho-syntaktische Aspekte, wie die Verbzweitstellung und die Kasus-Numerus-Genus-Kongruenz. Es werden Förderziele für die Verbesserung der Grammatikkenntnisse des Schülers vorgeschlagen, die sich auf die Arbeit mit topologischen Feldern und die Anwendung der KNG-Kongruenz konzentrieren.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Textes sind: Sprache, Grammatik, Spracherwerb, Sprachentwicklung, Verbzweitstellung, topologische Felder, Kasus-Numerus-Genus-Kongruenz, Sprachprobe, Förderziele, Analyse, Schulkontext, Berufskontext.
- Quote paper
- Daniela Noe (Author), 2018, Grammatik im mehrsprachigen Klassenzimmer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/451320