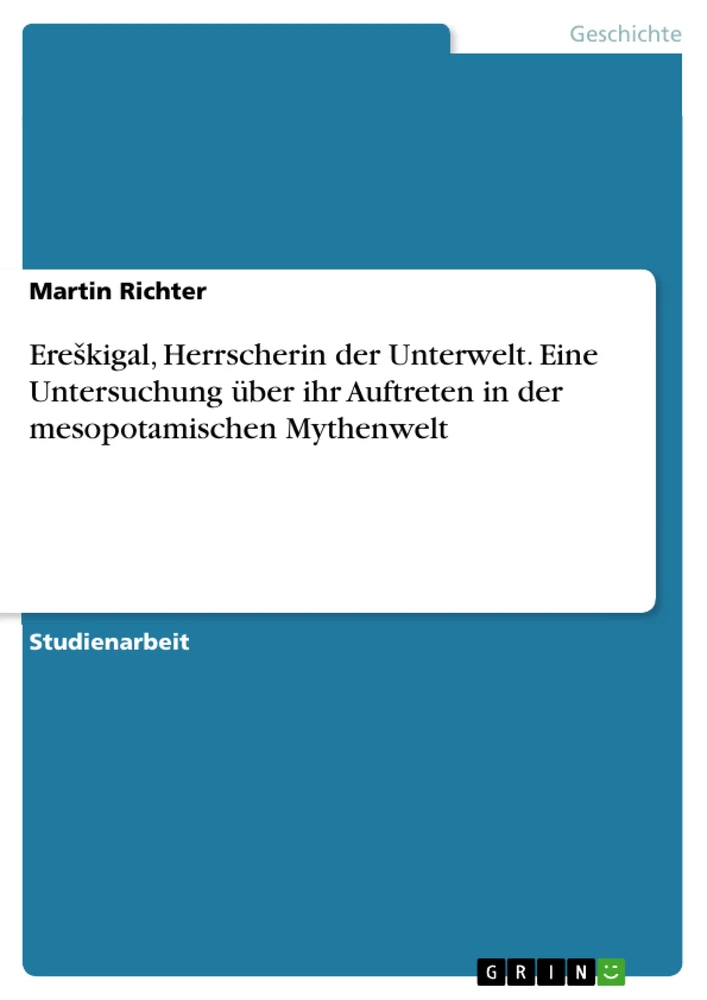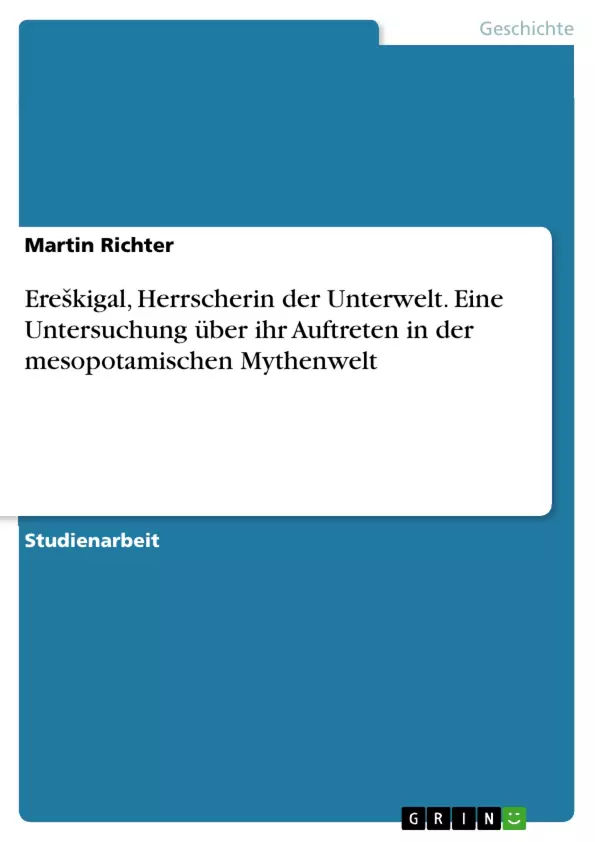In dieser Arbeit soll das Auftreten Ereškigals in den Mythen „Nergal und Ereškigal“, „Inannas/Ištars Gang in die Unterwelt“ und dem „Gilgameš-Epos“ untersucht werden, mit der vordergründigen Frage ob sie als abscheuliches Monster oder doch als ganz ‚normale‘ Göttin dargestellt wird. Hinzu kommt die Frage, wie es den Akteuren der Mythen gelang aus der Unterwelt wieder zu entkommen und der Macht der Ereškigal zu entrinnen. Des Weiteren soll die Unterwelt an sich auch kurze Beachtung finden, vor allem in Bezug auf ihre wichtigsten Bewohner, ihre Topographie und ihrem Aussehen, sowie dem Leben ihrer Bewohner.
Im mesopotamischen Glauben war die Unterwelt keinesfalls ein Ort des Chaos, in den die Verstorbenen nach ihrem Tod gegangen sind. Sie war vielmehr eine geordnete ‚Welt‘, in der aber kein vergleichbarer Lebensstandard vorherrschte wie in der oberirdischen Welt. Ihr konnte im Grunde keiner entkommen. Selbst unsterbliche Götter konnten ihr eigentlich nicht entrinnen, wodurch sie immer über ihre Boten, für die dies nicht galt, zur Kommunikation mit der Unterwelt benutzten. Für Ereškigal war die Situation nicht viel anders. Sie konnte nicht die oberirdische Welt betreten, weshalb sie mit Hilfe ihres Boten Namtar, mit den oberirdischen Göttern in Verbindung trat.
Die jenseitige Welt ist ein „Haus der Finsternis“, „ein Haus, dessen Bewohner des Lichtes entbehren“. Da es, wie bereits erwähnt, von diesem Ort kein Entrinnen gab, nannte man ihn auch kurnugi „das Land ohne Wiederkehr“. Andere Namen waren aber auch „das Haus des Geschickes“ eines jeden Menschen, „das große Haus“, „die Totenstadt“ oder auch „das Haus des Staubes“. Gelegentlich ist auch der Name Kutha zu finden, welches die Nekropole der Stadt Babylon war. Hier befand sich auch der Tempel der Ereškigal é.eri.gal, das „Haus der großen Stadt“.
Ereškigal nun war die Herrin der Unterwelt oder wie ihr sumerischer Name, Ereš-ki-gal bereits sagt, die „Herrin des großen Landes“. Ihr Auftreten in mesopotamischen Mythen und Epen ist zahlreich, aber vor allem im Zusammenhang mit dem Unterweltsgang einer bestimmten Person oder eines Gottes. Andere Namen für sie waren im Laufe der Zeit Al-la-tum, Ama-áb-zi-kur-ra, Gašan-ki-gal, Gù-a-nu-si und Kù-an-ni-si. Sie ist die Gemahlin des Nergal und des Nin-azu. Der Sohn, den sie mit Enlil hat, ist Namtar, welcher gleichzeitig ihr Bote und Wesir ist. Außerdem hat sie eine Tochter Nungalla.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Allgemeine Betrachtungen zur Unterwelt
- 2.1 Topographie und Aussehen der Unterwelt
- 2.2 Das Leben in der Unterwelt
- 2.3 Die wichtigsten Götter der Unterwelt
- 3. Der Gang in die Unterwelt
- 3.1 „Nergal und Ereškigal“
- 3.2 „Ištars Höllenfahrt“ bzw. „Inannas Gang in die Unterwelt“
- 3.3 „Der Gilgameš-Epos“ bzw. „Gilgameš, Enkidus und die Unterwelt“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Auftreten der mesopotamischen Unterweltsgöttin Ereškigal in verschiedenen Mythen. Das Hauptziel ist es, ihr Bild als Göttin zu analysieren und zu klären, ob sie als abscheuliches Monster oder als "normale" Göttin dargestellt wird. Weiterhin wird untersucht, wie die Protagonisten der Mythen der Macht Ereškigals entkommen konnten.
- Darstellung Ereškigals in mesopotamischen Mythen
- Topographie und Leben in der mesopotamischen Unterwelt
- Fluchtmechanismen aus der Unterwelt in den Mythen
- Vergleichende Analyse verschiedener Mythen
- Die Rolle wichtiger Unterweltsgötter
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die mesopotamische Vorstellung von der Unterwelt als geordnete, aber lebensfeindliche Welt ein. Sie betont die Unentrinnbarkeit der Unterwelt, selbst für Götter, und die Rolle von Boten wie Namtar für die Kommunikation zwischen der Ober- und Unterwelt. Ereškigal, als Herrin der Unterwelt, wird vorgestellt, und die zentralen Fragen der Arbeit, die sich auf ihre Darstellung und die Fluchtmöglichkeiten aus der Unterwelt beziehen, werden formuliert. Die Unterwelt wird als "Haus der Finsternis", "Land ohne Wiederkehr" und mit anderen Namen beschrieben, ihre Verbindung zu Kutha und dem Tempel der Ereškigal wird hervorgehoben.
2. Allgemeine Betrachtungen zur Unterwelt: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die mesopotamische Unterwelt. Es beschreibt die Topographie, einschließlich des weit entfernten Eingangs im Westen und der Stadt mit sieben oder vierzehn Toren, die jeweils von Pförtnern bewacht werden. Die Bedeutung der Tore als Schutz vor unerwünschten Besuchern und ihr möglicher magischer Aspekt werden diskutiert. Das Kapitel beschreibt die Reise des Verstorbenen in die Unterwelt, einschließlich der Verwendung von Modellbooten und Grabausrichtung, und den Unterweltsfluss Illurugu/Ḫubur mit seinen sieben Nebenarmen, sowie den Unterweltsozean Apsȗ, der von Ea beherrscht wird. Es beschreibt auch das Leben in der Unterwelt, das von Dunkelheit, Staub und Lehm als Nahrung geprägt ist, im Gegensatz zum Leben der Könige, die mit Reichtümern begraben wurden. Schließlich behandelt das Kapitel die wichtigsten Götter der Unterwelt: Ereškigal, Nergal und Erra, mit einem Fokus auf ihre Rollen und Funktionen.
3. Der Gang in die Unterwelt: Dieses Kapitel analysiert drei zentrale Mythen, die den Gang in die Unterwelt thematisieren: „Nergal und Ereškigal“, „Ištars Höllenfahrt“, und „Der Gilgameš-Epos“. Es werden die wiederkehrenden Protagonisten wie Held, Partner, Helfer etc. genannt, wobei der Feind und der Verfolger im Fokus stehen. Die Kapitel analysieren die unterschiedlichen Versionen der Mythen, hervorhebende die verschiedenen Darstellungen Ereškigals und die Strategien der Helden, um der Macht der Unterweltsgöttin zu entkommen oder ihre Herrschaft zu beeinflussen.
Schlüsselwörter
Ereškigal, mesopotamische Mythen, Unterwelt, Nergal, Inanna/Ištar, Gilgameš, Unterweltsgang, Namtar, Mesopotamien, Religion, Mythologie, Gottheiten, Jenseits, Totenreich
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Mesopotamische Unterweltsmythen und die Göttin Ereškigal
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die mesopotamische Unterweltsgöttin Ereškigal anhand verschiedener Mythen. Das Hauptziel ist die Untersuchung ihrer Darstellung – als abscheuliches Monster oder als "normale" Göttin – und die Analyse der Fluchtmechanismen der Mythenhelden vor ihrer Macht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Darstellung Ereškigals, die Topographie und das Leben in der mesopotamischen Unterwelt, Fluchtmechanismen aus der Unterwelt, einen vergleichenden Mythosvergleich und die Rolle wichtiger Unterweltsgötter wie Nergal und Erra.
Welche Mythen werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf drei zentrale Mythen: „Nergal und Ereškigal“, „Ištars Höllenfahrt“ (Inannas Gang in die Unterwelt) und „Der Gilgameš-Epos“. Die Analyse umfasst die verschiedenen Versionen dieser Mythen und die darin dargestellten Strategien der Helden, um Ereškigals Macht zu entkommen oder zu beeinflussen.
Wie wird die mesopotamische Unterwelt beschrieben?
Die Unterwelt wird als geordnete, aber lebensfeindliche Welt beschrieben, die selbst für Götter unentrinnbar ist. Sie wird topographisch detailliert dargestellt, inklusive des weit entfernten Eingangs im Westen, der Stadt mit sieben oder vierzehn Toren und dem Unterweltsfluss Illurugu/Ḫubur mit seinen sieben Nebenarmen. Das Leben in der Unterwelt ist von Dunkelheit, Staub und Lehm als Nahrung geprägt.
Welche Rolle spielt Ereškigal?
Ereškigal ist die Herrin der Unterwelt. Die Arbeit untersucht, ob sie als abscheuliches Monster oder als "normale" Göttin dargestellt wird und analysiert ihre Macht und ihren Einfluss auf die Protagonisten der verschiedenen Mythen.
Welche weiteren wichtigen Götter der Unterwelt werden erwähnt?
Neben Ereškigal werden Nergal und Erra als wichtige Götter der Unterwelt vorgestellt und ihre Rollen und Funktionen im Kontext der untersuchten Mythen erläutert. Namtar wird als Bote zwischen Ober- und Unterwelt erwähnt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ereškigal, mesopotamische Mythen, Unterwelt, Nergal, Inanna/Ištar, Gilgameš, Unterweltsgang, Namtar, Mesopotamien, Religion, Mythologie, Gottheiten, Jenseits, Totenreich.
Welche Struktur hat die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu allgemeinen Betrachtungen der Unterwelt und ein Kapitel zum Gang in die Unterwelt, welches drei zentrale Mythen analysiert. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke konzipiert und eignet sich für Wissenschaftler und Studierende, die sich mit mesopotamischer Mythologie, Religion und der Rolle von Göttinnen in antiken Kulturen befassen.
- Citar trabajo
- Martin Richter (Autor), 2011, Ereškigal, Herrscherin der Unterwelt. Eine Untersuchung über ihr Auftreten in der mesopotamischen Mythenwelt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/451401