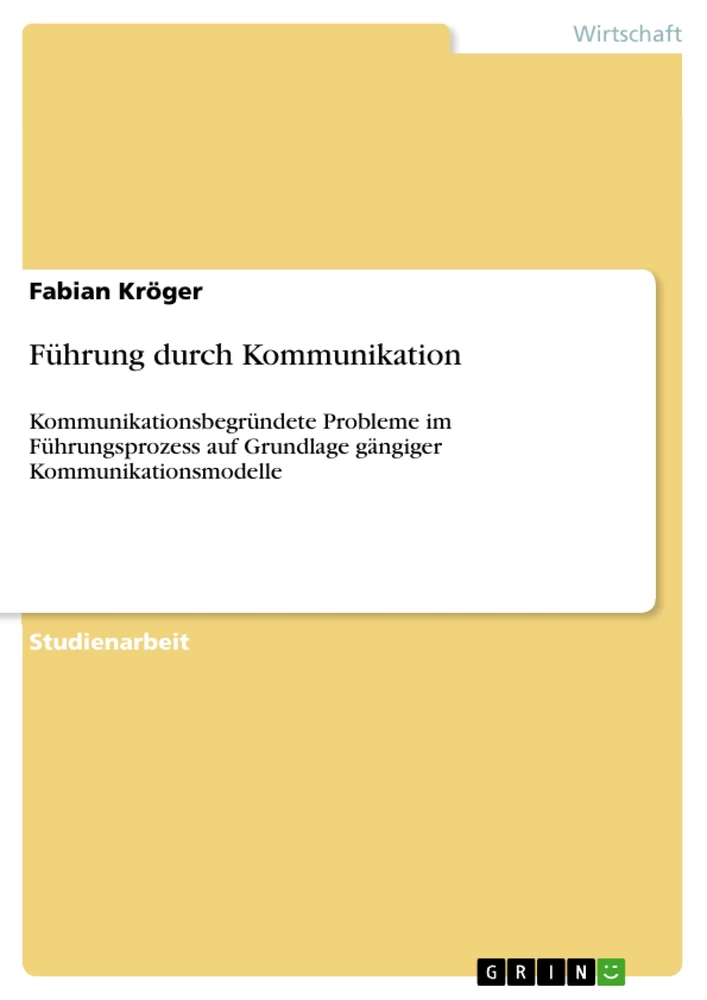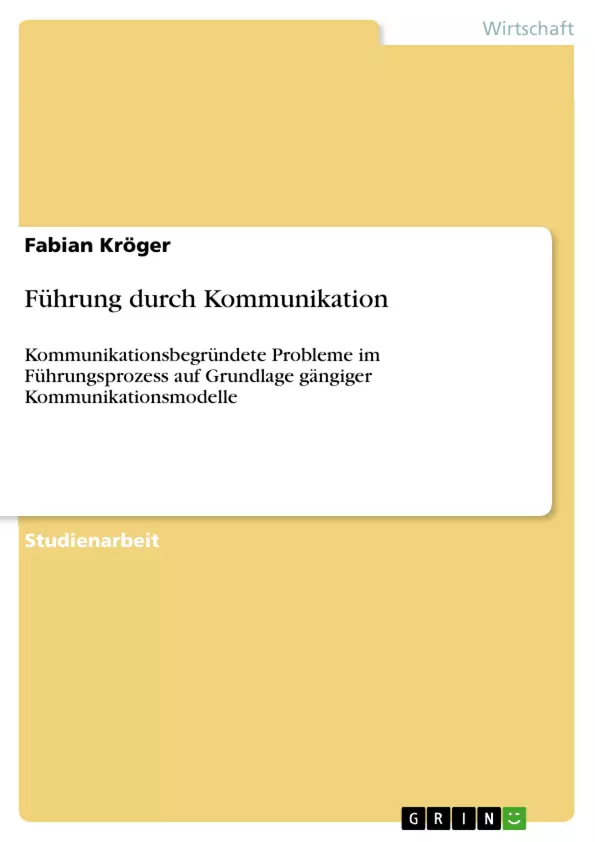Diese Arbeit stellt sich die Frage, ob sich generelle Grundsätze zur Kommunikation von Führungskräften festhalten lassen, welche aus unterschiedlichen Kommunikationsmodellen abgeleitet werden können. Was sollte eine Führungskraft im Rahmen der beruflichen Kommunikation berücksichtigen? Welche Grundsätze der Führungskommunikation lassen sich aus den untersuchten Modellen ableiten?
Die Bedeutung des Themas Kommunikation ist in den vergangenen Jahrzehnten signifikant gestiegen. Dies gilt für den privaten und insbesondere auch für den beruflichen Bereich. Die Kommunikation in Unternehmen hat sich stark gewandelt und zeichnet heute ein vollkommen neues Bild. Dies wirkt sich auch auf die Führungskräfte von Behörden und Wirtschaftsunternehmen aus: „Das Ende von Befehl und Gehorsam – Führungsaufgaben sind Kommunikationsaufgaben. Der Befund ist nicht neu – an Aktualität mangelt es ihm dennoch nicht.“ (Deekeling/ Barghop 2003: 94). Hier zeigt sich bereits, dass die Kommunikation eine äußerst wichtige Fähigkeit von Führungskräften darstellt. Manche Autoren gehen noch weiter und erklären: „In der wissenschaftlichen Fachliteratur wie auch in den untersuchten Ratgebern herrscht Einigkeit darüber, dass Führung zu großen Teilen aus Kommunikation bzw. kommunikationsintensiven Tätigkeiten besteht“ (Sternberg 2011: 43). An diesem Punkt werden Führungsaufgaben nahezu vollständig auf Kommunikation und solche Tätigkeiten beschränkt, die stark mit der Kommunikation verknüpft sind.
Weshalb die Kommunikationsfähigkeit einer Führungskraft einen derart hohen Stellenwert innehat, macht folgendes Zitat deutlich: „Niemand würde heute ernsthaft bestreiten, dass die Qualität der Kommunikation im Unternehmen entscheiden die Wettbewerbskraft bestimmt“ (Schlötter 2006: 7). Letztlich scheint die Kommunikation innerhalb eines Unternehmens über den Erfolg und Misserfolg einer Firma und gegebenenfalls auch einer Behörde zu entscheiden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kommunikationsmodelle im Portrait
- 4-Ohren Modell von Schulz von Thun
- Sender Empfänger Modell
- Mögliche Problemfelder der Modelle im Rahmen menschlicher Führung
- Kommunikationsprobleme des 4-Ohren Modells für Führungskräfte
- Kommunikationsprobleme des Sender-Empfänger Modells für Führungskräfte
- 4 Grundsätze der Führungskommunikation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Bedeutung von Kommunikation in Führungsprozessen und analysiert, wie gängige Kommunikationsmodelle zur Identifizierung von Problemen und zur Entwicklung von Führungskommunikationsprinzipien beitragen können.
- Die Bedeutung von Kommunikation in der Führung
- Analyse und Vergleich von Kommunikationsmodellen (4-Ohren Modell, Sender-Empfänger Modell)
- Herausforderungen und Problemfelder der Kommunikation in Führungsprozessen
- Entwicklung von Grundsätzen für effektive Führungskommunikation
- Zusammenhänge zwischen Kommunikation und Führungserfolg
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel stellt die Relevanz von Kommunikation in Führungsprozessen dar und beleuchtet die Notwendigkeit von Kommunikationsmodellen für ein besseres Verständnis der Führungskommunikation. Es werden Fragen aufgeworfen, die im Verlauf der Arbeit beantwortet werden sollen.
- Kommunikationsmodelle im Portrait: Dieses Kapitel präsentiert zwei wichtige Kommunikationsmodelle: Das 4-Ohren Modell von Schulz von Thun und das Sender-Empfänger Modell. Die Funktionsweise und die Anwendungsbereiche der Modelle werden erläutert.
- Mögliche Problemfelder der Modelle im Rahmen menschlicher Führung: Das Kapitel analysiert die spezifischen Herausforderungen, die die beiden Kommunikationsmodelle im Kontext der Führungs-kommunikation aufzeigen. Es werden mögliche Kommunikationsbarrieren und Schwierigkeiten in der Anwendung der Modelle beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit konzentriert sich auf die Analyse von Kommunikationsmodellen im Kontext der Führung. Schlüsselbegriffe sind: Führungskommunikation, 4-Ohren Modell, Sender-Empfänger Modell, Kommunikationsprobleme, Führungsprinzipien, effektive Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Kommunikation für Führungskräfte so wichtig?
Führungsaufgaben sind heute primär Kommunikationsaufgaben; die Qualität der Kommunikation entscheidet maßgeblich über die Wettbewerbskraft eines Unternehmens.
Welche Kommunikationsmodelle werden in der Arbeit vorgestellt?
Die Arbeit analysiert das 4-Ohren-Modell von Schulz von Thun sowie das klassische Sender-Empfänger-Modell.
Welche Probleme bietet das 4-Ohren-Modell für Führungskräfte?
Es zeigt auf, wie Missverständnisse entstehen können, wenn Nachrichten auf unterschiedlichen Ebenen (Sache, Beziehung, Selbstoffenbarung, Appell) gesendet oder empfangen werden.
Was sind die 4 Grundsätze der Führungskommunikation?
Die Arbeit leitet aus den untersuchten Modellen vier konkrete Prinzipien ab, die eine Führungskraft in der beruflichen Kommunikation berücksichtigen sollte.
Wie hat sich die Führungskommunikation in den letzten Jahrzehnten gewandelt?
Weg von "Befehl und Gehorsam" hin zu einem Modell, bei dem Führung fast vollständig aus kommunikationsintensiven Tätigkeiten besteht.
- Citar trabajo
- Fabian Kröger (Autor), 2017, Führung durch Kommunikation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/451622