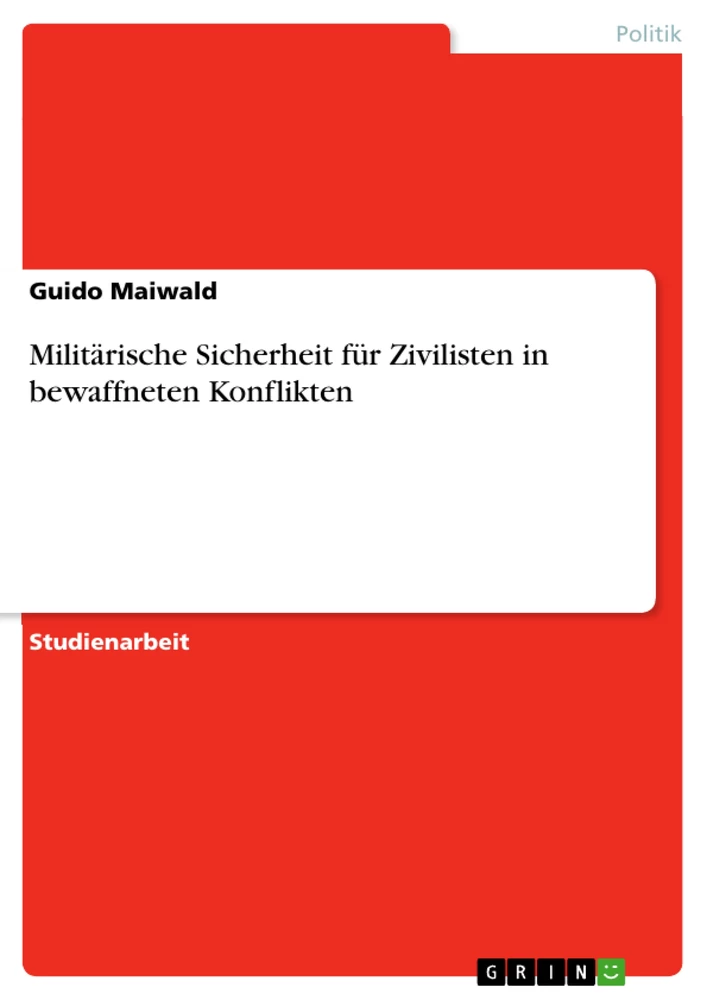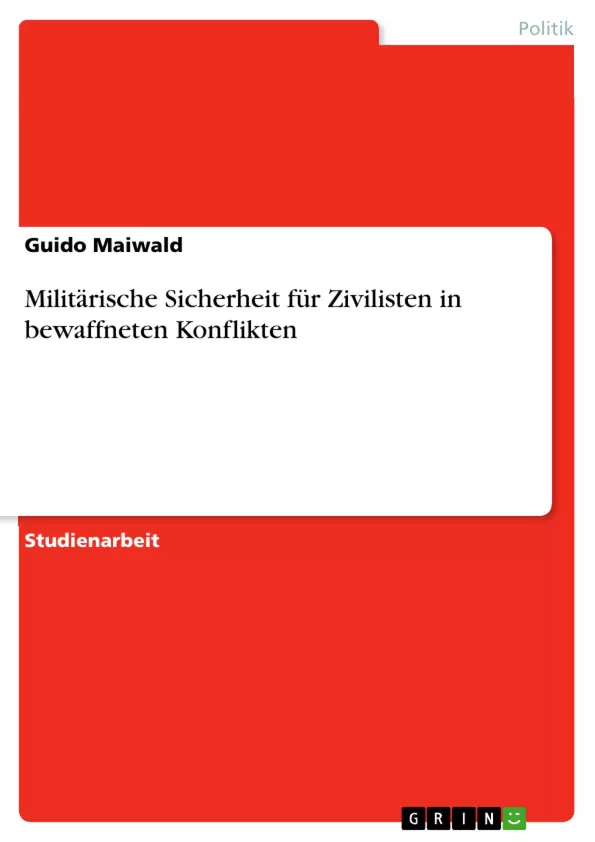Diese Arbeit soll die wesentlichen Eckpunkte der multilateralen Diskussion um die humanitäre Sicherheit mit dem Schwerpunkt der militärischen Sicherheit darstellen. Der Punkt der militärischen Sicherheit ist zumeist vom Ansatz her eng verbunden mit der Sicherheit von Staaten. Am ersten Mai 2003 stellte die Commission on Human Security (CHS) dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan, ihren „Final Report“ vor, der den Punkt der militärischen Sicherheit hingegen auf die Zivilbevölkerung und Flüchtlinge fokussiert. Im Folgenden werden die Ergebnisse des Final Reports bezüglich der Entstehung von bewaffneten Konfliktsituationen, Schwierigkeiten bezüglich der multilateralen Kenntnisnahme solcher Situationen sowie Strategien zur Vermeidung und Lösungsansätze dargestellt. Einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit stellt der „Open Letter“ von Kenneth Roth, Direktor der Organisation Human Rights Watch (HRW) dar, welcher sich mit dem Hintergrund des drohenden Irakkrieges an die Vereinten Nationen wendet und diese zur Kontrolle der strikten Umsetzung humanitärer Ziele mahnt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Statistische Erhebungen über bewaffnete Konflikte und Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung
- Schlüsselfaktoren für gewaltsame Auseinandersetzung
- Auswirkungen gewaltsamer Auseinandersetzungen
- Schwierigkeiten bei der Beobachtung von Konfliktsituationen
- Wege zur Verhinderung von bewaffneten Krisen
- Aufnahme humanitärer Sicherheit in die Sicherheitsagenda
- Stärkung humanitärer Maßnahmen
- Menschenrechtsbasierte Herangehensweisen
- Respekt vor den Menschenrechten und der internationalen humanitären Gesetzgebung
- Entwaffnung der Bevölkerung und Verbrechensbekämpfung
- Verhinderung gewalttätiger Konflikte und Anerkennung der Bürgerrechte
- Kenneth Roth: Open Letter for UN Security Council Debate (24.02.2003)
- Resumee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der multilateralen Diskussion um die humanitäre Sicherheit, insbesondere im Hinblick auf die militärische Sicherheit der Zivilbevölkerung. Sie analysiert die Entstehung von bewaffneten Konflikten, die Schwierigkeiten bei der Beobachtung solcher Situationen sowie Strategien zur Vermeidung und Lösung. Der Fokus liegt auf dem "Final Report" der Commission on Human Security und dem "Open Letter" von Kenneth Roth, Direktor von Human Rights Watch, der sich mit dem bevorstehenden Irakkrieg beschäftigt.
- Statistische Erhebungen über bewaffnete Konflikte und ihre Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung
- Schlüsselfaktoren für gewaltsame Auseinandersetzungen
- Schwierigkeiten bei der Beobachtung von Konfliktsituationen
- Strategien zur Verhinderung von bewaffneten Krisen
- Analyse des "Open Letter" von Kenneth Roth und dessen Kritik an der Umsetzung humanitärer Ziele durch die Vereinten Nationen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Hintergrund und die Zielsetzung der Arbeit dar. Sie erläutert, wie die Arbeit die Diskussion um die humanitäre Sicherheit mit dem Schwerpunkt auf der militärischen Sicherheit der Zivilbevölkerung beleuchtet. Die Arbeit bezieht sich dabei auf den "Final Report" der Commission on Human Security, der im Mai 2003 veröffentlicht wurde.
Statistische Erhebungen über bewaffnete Konflikte und Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung
Dieses Kapitel beleuchtet die Statistiken zu bewaffneten Konflikten des 20. Jahrhunderts. Es zeigt die Auswirkungen von Konflikten auf die Zivilbevölkerung auf, darunter die Zahl der Opfer, die Flucht vor gewaltsamen Auseinandersetzungen und die Verbreitung von Waffen.
Schlüsselfaktoren für gewaltsame Auseinandersetzung
Dieses Kapitel identifiziert Schlüsselfaktoren, die zu internen gewaltsamen Konflikten führen. Der Final Report nennt dabei Faktoren wie Konkurrenz um Ressourcen, ökonomische Veränderungen, Ungleichheit, Kriminalität, Korruption und schwache Regierungen. Es werden auch die Auswirkungen dieser Konflikte, wie z. B. Menschenrechtsverletzungen, Folter, Genozid und die Zerstörung von Staaten und Institutionen, dargelegt.
Auswirkungen gewaltsamer Auseinandersetzungen
Dieses Kapitel analysiert die Folgen gewaltsamer Auseinandersetzungen für die Zivilbevölkerung. Der Anstieg der Kriminalität, Gewalt gegen Kinder, ältere Menschen und Frauen sowie Selbstmorde werden als direkte Folgen des Zusammenbruchs von staatlichen Institutionen und sozialen Normen identifiziert.
Schwierigkeiten bei der Beobachtung von Konfliktsituationen
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Schwierigkeiten bei der Erfassung und Beobachtung von bewaffneten Konflikten. Die fehlende Transparenz in vielen Konflikten, die Fokussierung auf direkte Kampfhandlungen und die Schwierigkeiten bei der Unterscheidung zwischen Kämpfern und Zivilisten stellen zentrale Herausforderungen dar. Auch die Problematik des Kampfes gegen internationalen Terrorismus, die Gefahr der Kriminalisierung politischer Bewegungen und die Schwäche des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen werden beleuchtet.
Wege zur Verhinderung von bewaffneten Krisen
Dieses Kapitel untersucht die Notwendigkeit neuer multilateraler Strategien zur Verhinderung von bewaffneten Krisen, die auf die Sicherheit der Bevölkerung ausgerichtet sind. Die Arbeit analysiert den Übergang von einem staatlichen Sicherheitsmodell zu einem menschenzentrierten Ansatz und beschreibt, wie humanitäre Sicherheit in die Sicherheitsagenda integriert werden kann.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind humanitäre Sicherheit, bewaffnete Konflikte, Zivilbevölkerung, Menschenrechte, internationale humanitäre Gesetzgebung, internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen, der "Final Report" der Commission on Human Security, der "Open Letter" von Kenneth Roth, sowie die Auswirkungen von Konflikten auf die Menschenrechte und das Völkerrecht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus des „Final Reports“ der Commission on Human Security?
Der Report fokussiert die militärische Sicherheit auf die Zivilbevölkerung und Flüchtlinge statt nur auf die Sicherheit von Staaten.
Welche Faktoren führen laut Arbeit zu gewaltsamen Konflikten?
Wichtige Faktoren sind Ressourcenkonkurrenz, ökonomische Ungleichheit, Korruption und schwache staatliche Regierungen.
Wer ist Kenneth Roth und was kritisierte er 2003?
Kenneth Roth ist Direktor von Human Rights Watch; er mahnte die UN im Kontext des Irakkrieges zur strikten Einhaltung humanitärer Ziele an.
Wie kann man bewaffnete Krisen verhindern?
Durch die Stärkung von Menschenrechten, Entwaffnung der Bevölkerung und die Integration humanitärer Sicherheit in die globale Sicherheitsagenda.
Warum ist die Beobachtung von Konflikten oft schwierig?
Herausforderungen sind fehlende Transparenz, die schwierige Unterscheidung zwischen Kämpfern und Zivilisten sowie die Schwäche internationaler Gremien.
- Citation du texte
- MA Guido Maiwald (Auteur), 2009, Militärische Sicherheit für Zivilisten in bewaffneten Konflikten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/451852