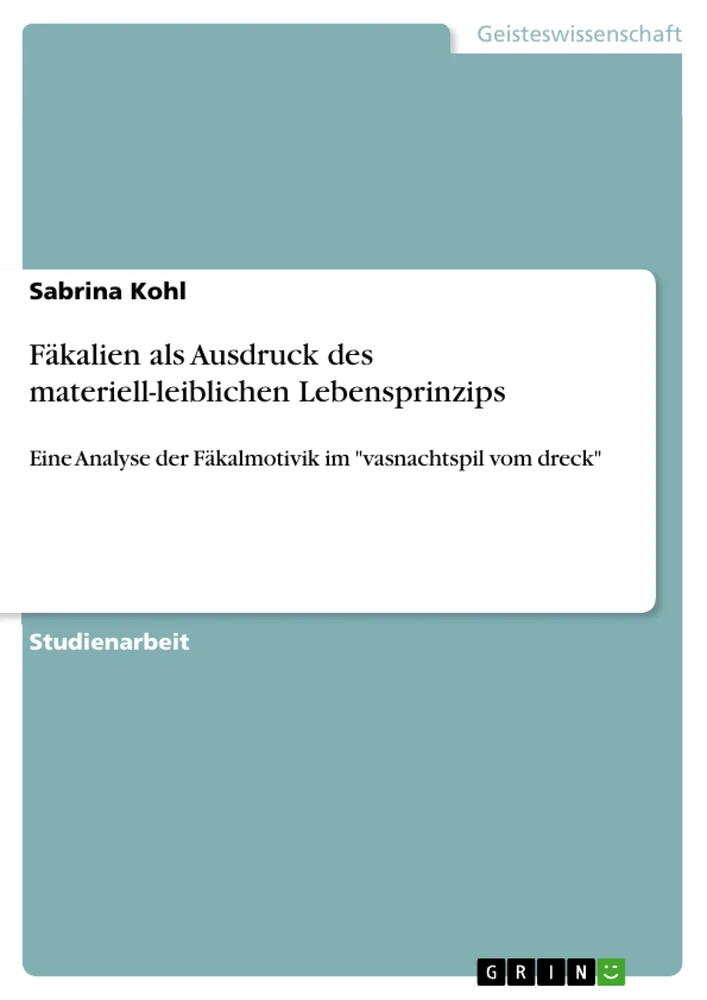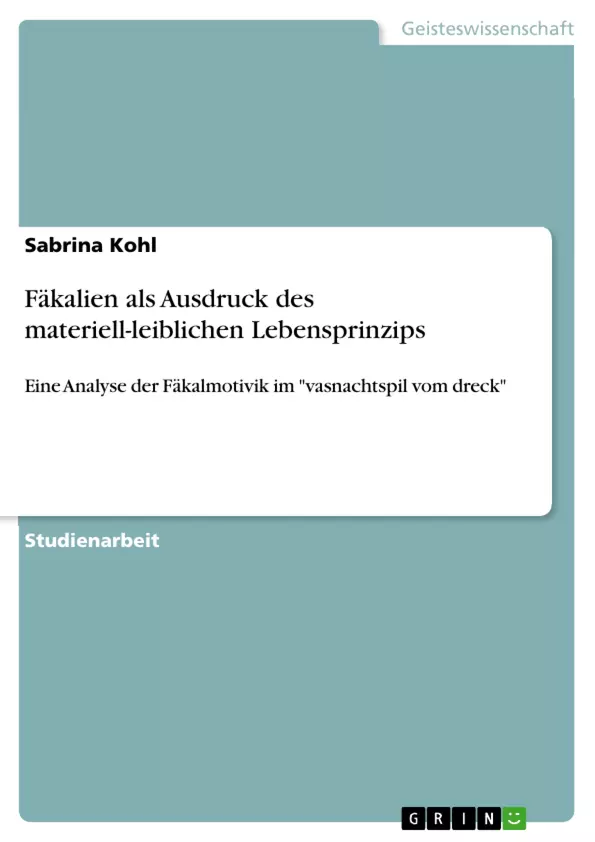„Exkremente sind nicht allzu sehr beliebt, doch geben sie ne prima Mahlzeit ab, wenn man ihnen eine Chance gibt“, singen die Ärzte in dem Lied „Richtig schön evil“. Wir wollen ihrem Beispiel folgen und ein Fastnachtspiel untersuchen, in dem die Masken einiger Bauern einem gewaltigen Exkrement, das vor dem Nürnberger Rathaus gefunden wird, eben diese Chance einräumen. Es wird erläutert, welche Rolle Fäkalien um das 15. Jahrhundert, in dem das zu untersuchende „vasnachtspil vom dreck“ aufgeschrieben wurde, zukommt und welches Körperkonzept dem Defäkieren in Fastnachtspielen und anderen Festlichkeiten zugrunde liegen mag. Da diese Körperpraxis natürlich schwerlich dokumentarisch erhalten sein kann, werden Bilder klerikaler Handschriften, Gemälde und Plastiken in Dorfkirchen oder an anderen Gebäuden, überlieferte Rituale verschiedener Kulturkreise und theoretische Körperkonzeptionen zu Hilfe gezogen. Vor dem Hintergrund dieser theoretischen Ansätze soll zuletzt das „vasnachtspil vom dreck“ untersucht werden.
Im 15. Jahrhundert, als das „vasnachtspil vom dreck“ in Nürnberg niedergeschrieben wurde, entstand dort gerade ein Überwachungssystem durch den Stadtrat. Handwerkszünfte und Geheimbühne wurden verboten und man versuchte, Feste zu kontrollieren und Tänze zu unterbinden. Es entwickelte sich ein neues Ethos von Arbeitsfleiß und Disziplin. Dabei wurden Handwerker mehr und mehr herabgewürdigt, ihre Selbstständigkeit als Meister schwand. Somit rückt das Auffinden des Haufens in der Tuchscherergasse, also vor dem Nürnberger Rathaus, in ein anderes Licht. Im Fastnachtspiel konnte man sich derartige Kritik am System in Form solch spielerisch-scherzhafter Gestikulationen erlauben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kontext
- 3. Unterschied: Theorie und Praxis
- 4. Bedeutung von Fäkalien in verschiedenen Kulturen
- 5. Bachtins materiell-leibliches Körperkonzept
- 5.1. Relative Unsterblichkeit durch den Zyklus des Lebens
- 5.2. Der offene Leib
- 5.3. Degradierung
- 5.4. Festmahlmotiv
- 5.5. Andere Körperkonzepte
- 5.6. Kosmische Angst überwinden
- 5.7. Bedeutung der Elemente
- 6. Motive im „vasnachtspil vom dreck“
- 6.1. Bedeutung des „Kunters“
- 6.2. Verwendung des „kunters“ im „vasnachtspil vom dreck“
- 6.2.1. Als Mahlzeit
- 6.2.1.1. Das Ei
- 6.2.1.2. Cucagne und Cocuce
- 6.2.2. Handwerksgegenstände
- 6.2.3. Spiel
- 6.2.4. Heilung in Form von Körperpflege
- 6.2.5. Nachtruhe und „S“-Symbolik
- 6.3. Namen der Bauern und Ärzte
- 6.4. Heilung mit Hilfe von Kot
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Fäkalmotivik im „vasnachtspil vom dreck“ und untersucht die Bedeutung von Fäkalien im Kontext des mittelalterlichen Körperverständnisses. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf Exkremente in verschiedenen Kulturen und setzt diese in Beziehung zu den im Fastnachtspiel dargestellten Motiven. Die Arbeit bezieht dabei insbesondere Michail Bachtins Theorie des materiell-leiblichen Körperkonzepts mit ein.
- Die Rolle von Fäkalien in verschiedenen Kulturen und Zeitperioden.
- Bachtins Konzept des materiell-leiblichen Körpers und seine Relevanz für das Verständnis des Fastnachtspiels.
- Die symbolische Bedeutung von Exkrementen im „vasnachtspil vom dreck“.
- Die Beziehung zwischen Fäkalien, Fest, Ritual und Heilung.
- Die Verwendung von Fäkalien als Nahrungsmittel, Handwerksmaterial und Heilmittel im Kontext des Spiels.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt das „vasnachtspil vom dreck“ als Untersuchungsobjekt. Sie skizziert den Forschungsansatz, der die Bedeutung von Fäkalien im 15. Jahrhundert und die zugrundeliegenden Körperkonzepte beleuchtet. Die Analyse des Stücks soll vor dem Hintergrund theoretischer Ansätze erfolgen.
2. Kontext: Dieses Kapitel beschreibt den historischen Kontext des „vasnachtspils vom dreck“ im 15. Jahrhundert Nürnberg. Es wird auf das repressive Überwachungssystem des Stadtrats, die Verbote von Handwerkszünften und Festen sowie das neue Ethos von Arbeitsfleiß und Disziplin hingewiesen. Das Auffinden des Kothaufens vor dem Rathaus wird in diesem Kontext als kritische Geste interpretiert, die im Rahmen des Fastnachtspiels erlaubt war.
3. Unterschied: Theorie und Praxis: Dieses Kapitel vergleicht die theoretische Auffassung der christlichen Kirche zur Leiblichkeit mit der tatsächlichen Praxis im Mittelalter. Die Kirche betonte die Überwindung der Leiblichkeit, während die orale Tradition heilige und profane Elemente vermischte. Anhand von Beispielen aus der klerikalen Bildkunst werden komplementäre Körperkonzepte aufgezeigt, die die Ambivalenz der Darstellung von Fäkalien verdeutlichen.
4. Bedeutung von Fäkalien in verschiedenen Kulturen: Dieses Kapitel beleuchtet die unterschiedliche Bedeutung von Fäkalien in verschiedenen Kulturen. Es werden Beispiele aus australischen und Inuit-Sagen sowie aus der römischen und ägyptischen Kultur angeführt, um zu zeigen, dass die Scham im Umgang mit Exkrementen gesellschaftlich konstruiert ist. Der Zusammenhang zwischen Kot, Leben und Fruchtbarkeit wird anhand von Hausmitteln aus der Antike verdeutlicht.
5. Bachtins materiell-leibliches Körperkonzept: Dieses Kapitel erläutert Bachtins Theorie des materiell-leiblichen Körperkonzepts. Es werden die zentralen Motive wie Essen, Trinken, Ausscheiden und Sexualität in ihrer übertriebenen Form im Kontext des Festes diskutiert. Der Zusammenhang zwischen dem Volkskörper, relativer Unsterblichkeit und der Überwindung von Angst wird herausgearbeitet. Die Konzepte des offenen Leibes, der Degradierung und des Festmahlmotivs werden im Detail beschrieben. Schließlich werden andere Körperkonzepte, wie das der Antike und das aristotelische Modell, mit Bachtins Theorie kontrastiert.
6. Motive im „vasnachtspil vom dreck“: Dieses Kapitel analysiert die im „vasnachtspil vom dreck“ dargestellten Motive vor dem Hintergrund der vorhergehenden Kapitel. Es wird die zentrale Rolle des „kunters“ und seine vielschichtigen Bedeutungen (Nahrungsmittel, Handwerksmaterial, Symbol) erläutert. Die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten des „kunters“ im Spiel werden detailliert untersucht und in den Kontext von Bachtins Theorie und der Bedeutung von Fäkalien in verschiedenen Kulturen gestellt.
Schlüsselwörter
Fäkalien, „vasnachtspil vom dreck“, Körperkonzept, Mittelalter, Bachtin, Fest, Ritual, Grotesker Realismus, Heilkunst, Symbol, Kulturvergleich.
Häufig gestellte Fragen zum "Vasnachtspil vom Dreck"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Fäkalmotivik im "Vasnachtspil vom Dreck" und untersucht die Bedeutung von Fäkalien im Kontext des mittelalterlichen Körperverständnisses. Sie beleuchtet unterschiedliche Perspektiven auf Exkremente in verschiedenen Kulturen und setzt diese in Beziehung zu den im Fastnachtspiel dargestellten Motiven. Die Arbeit bezieht dabei insbesondere Michail Bachtins Theorie des materiell-leiblichen Körperkonzepts mit ein.
Welche Themen werden im "Vasnachtspil vom Dreck" behandelt?
Das Stück thematisiert die Bedeutung von Fäkalien (speziell "Kunter") als Nahrungsmittel, Handwerksmaterial und Heilmittel. Es untersucht den symbolischen Gehalt von Exkrementen im Kontext des mittelalterlichen Festes und Rituals und beleuchtet die Beziehung zwischen Fäkalien, Fest, Ritual und Heilung.
Welche Rolle spielt Michail Bachtins Körperkonzept?
Bachtins Theorie des materiell-leiblichen Körperkonzepts bildet einen zentralen theoretischen Rahmen der Analyse. Konzepte wie der "offene Leib", die "Degradierung", das "Festmahlmotiv" und die "relative Unsterblichkeit" durch den Lebenszyklus werden herangezogen, um die Bedeutung der Fäkalien im Stück zu verstehen.
Wie wird der historische Kontext des Stücks berücksichtigt?
Die Arbeit beschreibt den historischen Kontext des "Vasnachtspils vom Dreck" im 15. Jahrhundert Nürnberg, einschließlich des repressiven Stadtrats, der Verbote von Handwerkszünften und Festen sowie des neuen Ethos von Arbeitsfleiß und Disziplin. Der Kothaufen vor dem Rathaus wird als kritische Geste interpretiert, die im Rahmen des Fastnachtspiels erlaubt war.
Wie werden unterschiedliche kulturelle Perspektiven auf Fäkalien berücksichtigt?
Die Arbeit vergleicht die Bedeutung von Fäkalien in verschiedenen Kulturen (australische und Inuit-Sagen, römische und ägyptische Kultur) und zeigt, dass die Scham im Umgang mit Exkrementen gesellschaftlich konstruiert ist. Der Zusammenhang zwischen Kot, Leben und Fruchtbarkeit wird anhand von Beispielen aus der Antike verdeutlicht.
Wie wird der Unterschied zwischen Theorie und Praxis im Mittelalter behandelt?
Die Arbeit vergleicht die theoretische Auffassung der christlichen Kirche zur Leiblichkeit mit der tatsächlichen Praxis im Mittelalter. Es wird gezeigt, wie die Kirche die Überwindung der Leiblichkeit betonte, während die orale Tradition heilige und profane Elemente vermischte. Klerikale Bildkunst wird als Beispiel für komplementäre Körperkonzepte herangezogen.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Schlüsselwörter sind: Fäkalien, "Vasnachtspil vom Dreck", Körperkonzept, Mittelalter, Bachtin, Fest, Ritual, Grotesker Realismus, Heilkunst, Symbol, Kulturvergleich.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus sechs Kapiteln: Einleitung, Kontext, Unterschied: Theorie und Praxis, Bedeutung von Fäkalien in verschiedenen Kulturen, Bachtins materiell-leibliches Körperkonzept und Motive im "Vasnachtspil vom Dreck". Jedes Kapitel wird in einer Zusammenfassung erläutert.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den Motiven im "Vasnachtspil vom Dreck"?
Kapitel 6 analysiert die im "Vasnachtspil vom Dreck" dargestellten Motive, insbesondere die zentrale Rolle des "kunters" und seine vielschichtigen Bedeutungen als Nahrungsmittel, Handwerksmaterial und Symbol. Die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten des "kunters" werden detailliert untersucht.
- Quote paper
- Sabrina Kohl (Author), 2013, Fäkalien als Ausdruck des materiell-leiblichen Lebensprinzips, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/451863